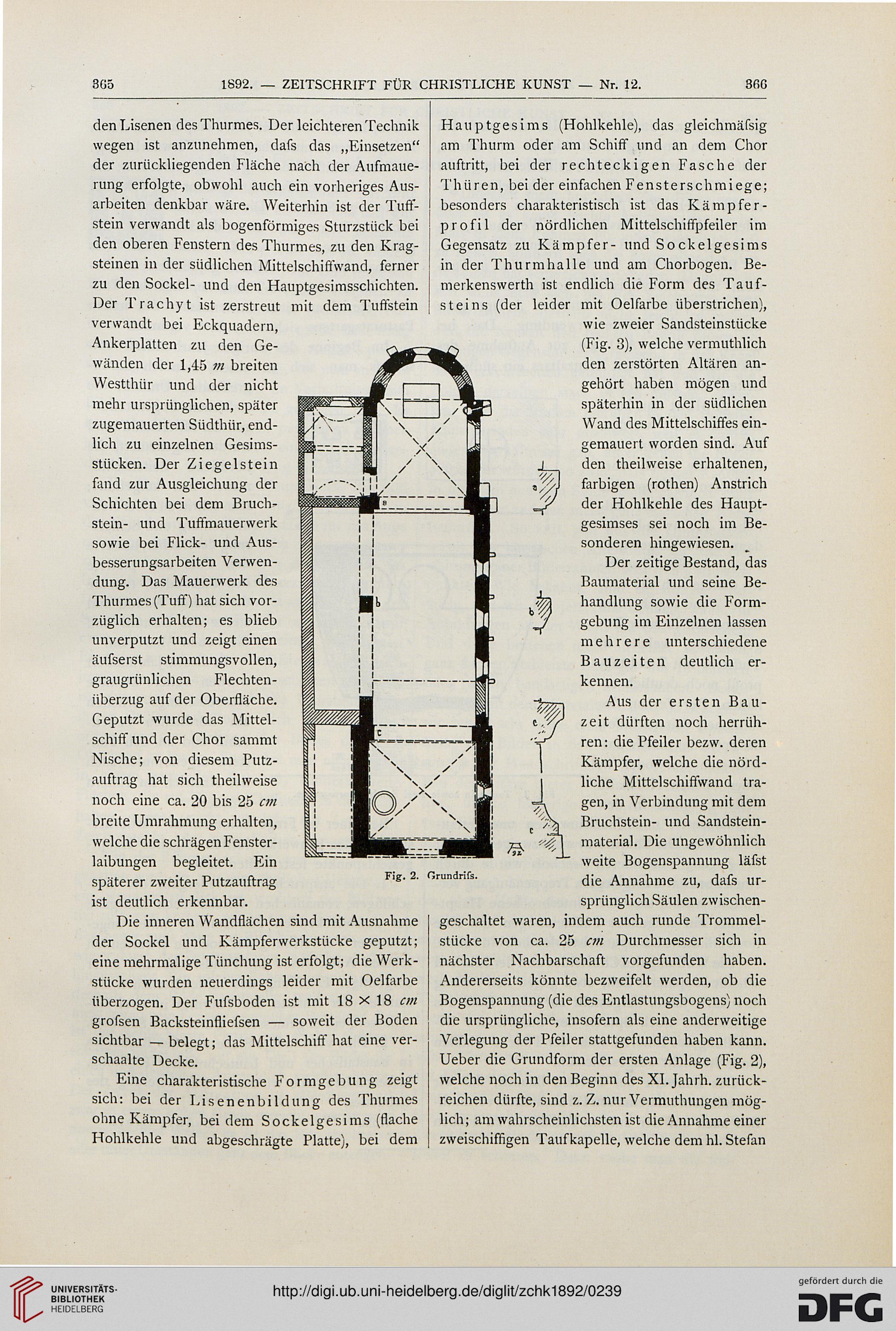3G5
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
3f,G
denLisenen desThurmes. Der leichteren Technik
wegen ist anzunehmen, dafs das „Einsetzen"
der zurückliegenden Fläche nach der Aufmaue-
rung erfolgte, obwohl auch ein vorheriges Aus-
arbeiten denkbar wäre. Weiterhin ist der Tuff-
stein verwandt als bogenförmiges Sturzstück bei
den oberen Fenstern des Thurmes, zu den Krag-
steinen in der südlichen Mittelschiffwand, ferner
zu den Sockel- und den Hauptgesimsschichten.
Der Trachyt ist zerstreut mit dem Tuffstein
verwandt bei Eckquadern,
Ankerplatten zu den Ge-
wänden der 1,45 m breiten
Westthür und der nicht
mehr ursprünglichen, später
zugemauerten Südthür, end-
lich zu einzelnen Gesims-
stücken. Der Ziegelstein
fand zur Ausgleichung der
Schichten bei dem Bruch-
stein- und Tuffmauerwerk
sowie bei Flick- und Aus-
besserungsarbeiten Verwen-
dung. Das Mauerwerk des
Thurmes (Tuff) hat sich vor-
züglich erhalten; es blieb
unverputzt und zeigt einen
äufserst stimmungsvollen,
graugrünlichen Flechten-
überzug auf der Oberfläche.
Geputzt wurde das Mittel-
schiff und der Chor sammt
Nische; von diesem Putz-
auftrag hat sich theilweise
noch eine ca. 20 bis 25 cm
breite Umrahmung erhalten,
welche die schrägen Fenster-
laibungen begleitet. Ein
späterer zweiter Putzauftrag
ist deutlich erkennbar.
Die inneren Wandflächen sind mit Ausnahme
der Sockel und Kämpferwerkstücke geputzt;
eine mehrmalige Tünchung ist erfolgt; die Werk-
stücke wurden neuerdings leider mit Oelfarbe
überzogen. Der Fufsboden ist mit 18 x 18 cm
grofsen Backsteinfliefsen — soweit der Boden
sichtbar — belegt; das Mittelschiff hat eine ver-
schaalte Decke.
Eine charakteristische Formgebung zeigt
sich: bei der Lisenenbildung des Thurmes
ohne Kämpfer, bei dem Sockelgesims (flache
Hohlkehle und abgeschrägte Platte), bei dem
Fig. 2.
Hauptgesims (Hohlkehle), das gleichmäfsig
am Thurm oder am Schiff und an dem Chor
auftritt, bei der rechteckigen Fasche der
Thüren, bei der einfachen Fensterschmiege;
besonders charakteristisch ist das Kämpfer-
profil der nördlichen Mittelschiffpfeiler im
Gegensatz zu Kämpfer- und Sockelgesims
in der Thurmhalle und am Chorbogen. Be-
merkenswerth ist endlich die Form des Tauf-
steins (der leider mit Oelfarbe überstrichen),
wie zweier Sandsteinstücke
(Fig. 3), welche vermuthlich
den zerstörten Altären an-
gehört haben mögen und
späterhin in der südlichen
Wand des Mittelschiffes ein-
gemauert worden sind. Auf
den theilweise erhaltenen,
farbigen (rothen) Anstrich
der Hohlkehle des Haupt-
gesimses sei noch im Be-
sonderen hingewiesen.
Der zeitige Bestand, das
Baumaterial und seine Be-
handlung sowie die Form-
gebung im Einzelnen lassen
mehrere unterschiedene
Bauzeiten deutlich er-
kennen.
Aus der ersten Bau-
zeit dürften noch herrüh-
ren: die Pfeiler bezw. deren
Kämpfer, welche die nörd-
liche Mittelschiffwand tra-
gen, in Verbindung mit dem
Bruchstein- und Sandstein-
material. Die ungewöhnlich
weite Bogenspannung läfst
die Annahme zu, dafs ur-
sprünglich Säulen zwischen-
geschaltet waren, indem auch runde Trommel-
stücke von ca. 25 cm Durchmesser sich in
nächster Nachbarschaft vorgefunden haben.
Andererseits könnte bezweifelt werden, ob die
Bogenspannung (die des Entlastungsbogens) noch
die ursprüngliche, insofern als eine anderweitige
Verlegung der Pfeiler stattgefunden haben kann.
Ueber die Grundform der ersten Anlage (Fig. 2),
welche noch in den Beginn des XI. Jahrh. zurück-
reichen dürfte, sind z. Z. nur Vermuthungen mög-
lich; am wahrscheinlichsten ist die Annahme einer
zweischiffigen Taufkapelle, welche dem hl. Stefan
ndrifs.
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
3f,G
denLisenen desThurmes. Der leichteren Technik
wegen ist anzunehmen, dafs das „Einsetzen"
der zurückliegenden Fläche nach der Aufmaue-
rung erfolgte, obwohl auch ein vorheriges Aus-
arbeiten denkbar wäre. Weiterhin ist der Tuff-
stein verwandt als bogenförmiges Sturzstück bei
den oberen Fenstern des Thurmes, zu den Krag-
steinen in der südlichen Mittelschiffwand, ferner
zu den Sockel- und den Hauptgesimsschichten.
Der Trachyt ist zerstreut mit dem Tuffstein
verwandt bei Eckquadern,
Ankerplatten zu den Ge-
wänden der 1,45 m breiten
Westthür und der nicht
mehr ursprünglichen, später
zugemauerten Südthür, end-
lich zu einzelnen Gesims-
stücken. Der Ziegelstein
fand zur Ausgleichung der
Schichten bei dem Bruch-
stein- und Tuffmauerwerk
sowie bei Flick- und Aus-
besserungsarbeiten Verwen-
dung. Das Mauerwerk des
Thurmes (Tuff) hat sich vor-
züglich erhalten; es blieb
unverputzt und zeigt einen
äufserst stimmungsvollen,
graugrünlichen Flechten-
überzug auf der Oberfläche.
Geputzt wurde das Mittel-
schiff und der Chor sammt
Nische; von diesem Putz-
auftrag hat sich theilweise
noch eine ca. 20 bis 25 cm
breite Umrahmung erhalten,
welche die schrägen Fenster-
laibungen begleitet. Ein
späterer zweiter Putzauftrag
ist deutlich erkennbar.
Die inneren Wandflächen sind mit Ausnahme
der Sockel und Kämpferwerkstücke geputzt;
eine mehrmalige Tünchung ist erfolgt; die Werk-
stücke wurden neuerdings leider mit Oelfarbe
überzogen. Der Fufsboden ist mit 18 x 18 cm
grofsen Backsteinfliefsen — soweit der Boden
sichtbar — belegt; das Mittelschiff hat eine ver-
schaalte Decke.
Eine charakteristische Formgebung zeigt
sich: bei der Lisenenbildung des Thurmes
ohne Kämpfer, bei dem Sockelgesims (flache
Hohlkehle und abgeschrägte Platte), bei dem
Fig. 2.
Hauptgesims (Hohlkehle), das gleichmäfsig
am Thurm oder am Schiff und an dem Chor
auftritt, bei der rechteckigen Fasche der
Thüren, bei der einfachen Fensterschmiege;
besonders charakteristisch ist das Kämpfer-
profil der nördlichen Mittelschiffpfeiler im
Gegensatz zu Kämpfer- und Sockelgesims
in der Thurmhalle und am Chorbogen. Be-
merkenswerth ist endlich die Form des Tauf-
steins (der leider mit Oelfarbe überstrichen),
wie zweier Sandsteinstücke
(Fig. 3), welche vermuthlich
den zerstörten Altären an-
gehört haben mögen und
späterhin in der südlichen
Wand des Mittelschiffes ein-
gemauert worden sind. Auf
den theilweise erhaltenen,
farbigen (rothen) Anstrich
der Hohlkehle des Haupt-
gesimses sei noch im Be-
sonderen hingewiesen.
Der zeitige Bestand, das
Baumaterial und seine Be-
handlung sowie die Form-
gebung im Einzelnen lassen
mehrere unterschiedene
Bauzeiten deutlich er-
kennen.
Aus der ersten Bau-
zeit dürften noch herrüh-
ren: die Pfeiler bezw. deren
Kämpfer, welche die nörd-
liche Mittelschiffwand tra-
gen, in Verbindung mit dem
Bruchstein- und Sandstein-
material. Die ungewöhnlich
weite Bogenspannung läfst
die Annahme zu, dafs ur-
sprünglich Säulen zwischen-
geschaltet waren, indem auch runde Trommel-
stücke von ca. 25 cm Durchmesser sich in
nächster Nachbarschaft vorgefunden haben.
Andererseits könnte bezweifelt werden, ob die
Bogenspannung (die des Entlastungsbogens) noch
die ursprüngliche, insofern als eine anderweitige
Verlegung der Pfeiler stattgefunden haben kann.
Ueber die Grundform der ersten Anlage (Fig. 2),
welche noch in den Beginn des XI. Jahrh. zurück-
reichen dürfte, sind z. Z. nur Vermuthungen mög-
lich; am wahrscheinlichsten ist die Annahme einer
zweischiffigen Taufkapelle, welche dem hl. Stefan
ndrifs.