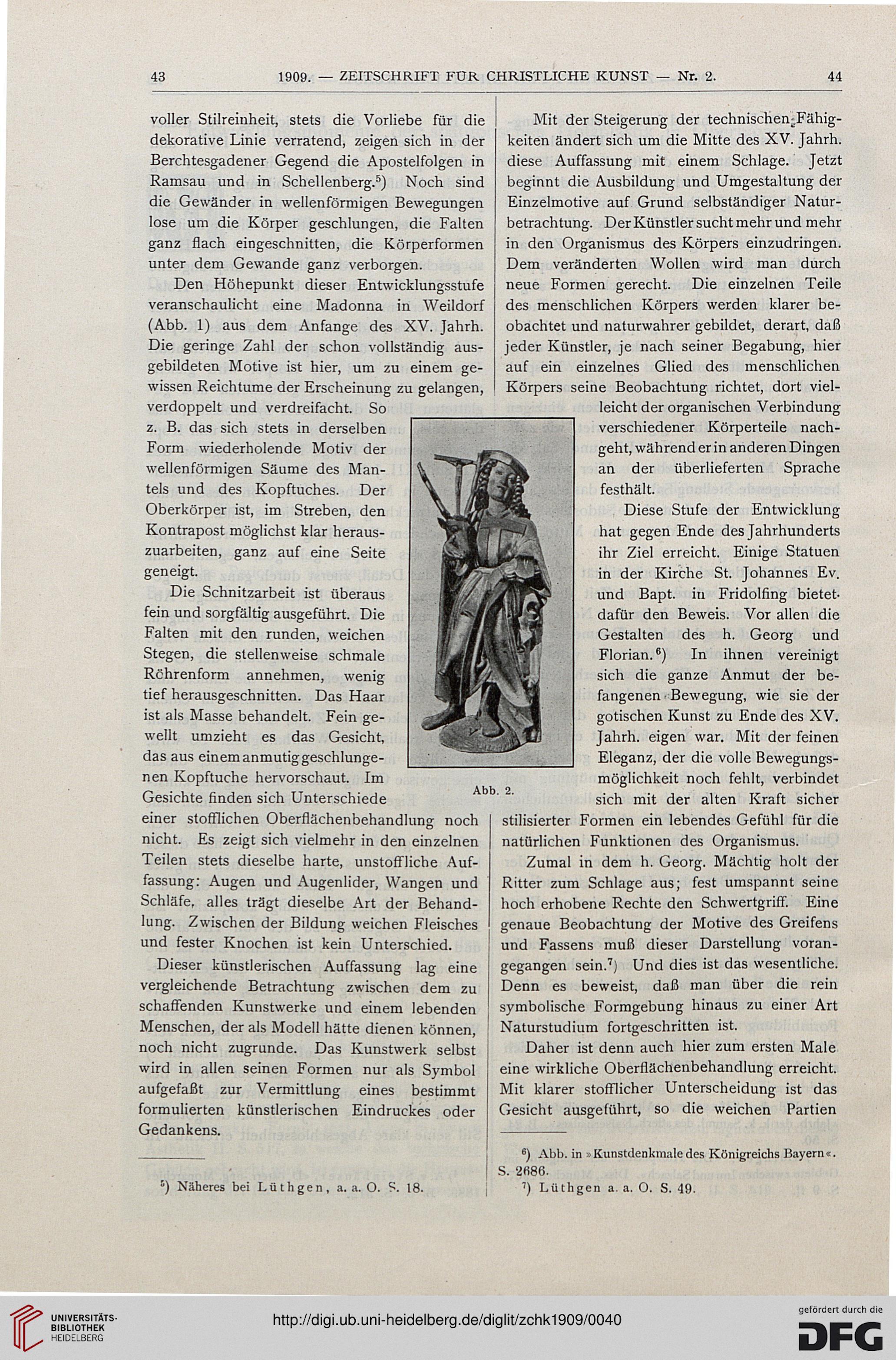43
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
voller Stilreinheit, stets die Vorliebe für die
dekorative Linie verratend, zeigen sich in der
Berchtesgadener Gegend die Apostelfolgen in
Ramsau und in Schellenberg.5) Noch sind
die Gewänder in wellenförmigen Bewegungen
lose um die Körper geschlungen, die Falten
ganz flach eingeschnitten, die Körperformen
unter dem Gewände ganz verborgen.
Den Höhepunkt dieser Entwicklungsstufe
veranschaulicht eine Madonna in Weildorf
(Abb. 1) aus dem Anfange des XV. Jahrh.
Die geringe Zahl der schon vollständig aus-
gebildeten Motive ist hier, um zu einem ge-
wissen Reichtume der Erscheinung zu gelangen,
verdoppelt und verdreifacht. So
z. B. das sich stets in derselben
Form wiederholende Motiv der
wellenförmigen Säume des Man-
tels und des Kopftuches. Der
Oberkörper ist, im Streben, den
Kontrapost möglichst klar heraus-
zuarbeiten, ganz auf eine Seite
geneigt.
Die Schnitzarbeit ist überaus
fein und sorgfältig ausgeführt. Die
Falten mit den runden, weichen
Stegen, die stellenweise schmale
Rchrenform annehmen, wenig
tief herausgeschnitten. Das Haar
ist als Masse behandelt. Fein ge-
wellt umzieht es das Gesicht,
das aus einem anmutig geschlunge-
nen Kopftuche hervorschaut. Im
Gesichte finden sich Unterschiede
einer stofflichen Oberflächenbehandlung noch
nicht. Es zeigt sich vielmehr in den einzelnen
Teilen stets dieselbe harte, unstoffliche Auf-
fassung: Augen und Augenlider, Wangen und
Schläfe, alles trägt dieselbe Art der Behand-
lung. Zwischen der Bildung weichen Fleisches
und fester Knochen ist kein Unterschied.
Dieser künstlerischen Auffassung lag eine
vergleichende Betrachtung zwischen dem zu
schaffenden Kunstwerke und einem lebenden
Menschen, der als Modell hätte dienen können,
noch nicht zugrunde. Das Kunstwerk selbst
wird in allen seinen Formen nur als Symbol
aufgefaßt zur Vermittlung eines bestimmt
formulierten künstlerischen Eindruckes oder
Gedankens.
&Ju
jJ^^^
f/ä
ili
HRj
Abb. 2
'") Näheres bei Lüthgen, a. a. O. S. 18.
Mit der Steigerung der technischen^Fähig-
keiten ändert sich um die Mitte des XV. Jahrh.
diese Auffassung mit einem Schlage. Jetzt
beginnt die Ausbildung und Umgestaltung der
Einzelmotive auf Grund selbständiger Natur-
betrachtung. Der Künstler sucht mehr und mehr
in den Organismus des Körpers einzudringen.
Dem veränderten Wollen wird man durch
neue Formen gerecht. Die einzelnen Teile
des menschlichen Körpers werden klarer be-
obachtet und naturwahrer gebildet, derart, daß
jeder Künstler, je nach seiner Begabung, hier
auf ein einzelnes Glied des menschlichen
Körpers seine Beobachtung richtet, dort viel-
leicht der organischen Verbindung
verschiedener Körperteile nach-
geht, während er in anderen Dingen
an der überlieferten Sprache
festhält.
Diese Stufe der Entwicklung
hat gegen Ende des Jahrhunderts
ihr Ziel erreicht. Einige Statuen
in der Kirche St. Johannes Ev.
und Bapt. in Fridolfing bietet-
dafür den Beweis. Vor allen die
Gestalten des h. Georg und
Florian.6) In ihnen vereinigt
sich die ganze Anmut der be-
fangenen • Bewegung, wie sie der
gotischen Kunst zu Ende des XV.
Jahrh. eigen war. Mit der feinen
Eleganz, der die volle Bewegungs-
möglichkeit noch fehlt, verbindet
sich mit der alten Kraft sicher
stilisierter Formen ein lebendes Gefühl für die
natürlichen Funktionen des Organismus.
Zumal in dem h. Georg. Mächtig holt der
Ritter zum Schlage aus; fest umspannt seine
hoch erhobene Rechte den Schwertgriff. Eine
genaue Beobachtung der Motive des Greifens
und Fassens muß dieser Darstellung voran-
gegangen sein.7) Und dies ist das wesentliche.
Denn es beweist, daß man über die rein
symbolische Formgebung hinaus zu einer Art
Naturstudium fortgeschritten ist.
Daher ist denn auch hier zum ersten Male
eine wirkliche Oberflächenbehandlung erreicht.
Mit klarer stofflicher Unterscheidung ist das
Gesicht ausgeführt, so die weichen Partien
6) Abb. in » Kunstdenkmale des Königreichs Bayern«.
S. 2H86.
7) Lüthgen a. a. O. S. 49.
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
44
voller Stilreinheit, stets die Vorliebe für die
dekorative Linie verratend, zeigen sich in der
Berchtesgadener Gegend die Apostelfolgen in
Ramsau und in Schellenberg.5) Noch sind
die Gewänder in wellenförmigen Bewegungen
lose um die Körper geschlungen, die Falten
ganz flach eingeschnitten, die Körperformen
unter dem Gewände ganz verborgen.
Den Höhepunkt dieser Entwicklungsstufe
veranschaulicht eine Madonna in Weildorf
(Abb. 1) aus dem Anfange des XV. Jahrh.
Die geringe Zahl der schon vollständig aus-
gebildeten Motive ist hier, um zu einem ge-
wissen Reichtume der Erscheinung zu gelangen,
verdoppelt und verdreifacht. So
z. B. das sich stets in derselben
Form wiederholende Motiv der
wellenförmigen Säume des Man-
tels und des Kopftuches. Der
Oberkörper ist, im Streben, den
Kontrapost möglichst klar heraus-
zuarbeiten, ganz auf eine Seite
geneigt.
Die Schnitzarbeit ist überaus
fein und sorgfältig ausgeführt. Die
Falten mit den runden, weichen
Stegen, die stellenweise schmale
Rchrenform annehmen, wenig
tief herausgeschnitten. Das Haar
ist als Masse behandelt. Fein ge-
wellt umzieht es das Gesicht,
das aus einem anmutig geschlunge-
nen Kopftuche hervorschaut. Im
Gesichte finden sich Unterschiede
einer stofflichen Oberflächenbehandlung noch
nicht. Es zeigt sich vielmehr in den einzelnen
Teilen stets dieselbe harte, unstoffliche Auf-
fassung: Augen und Augenlider, Wangen und
Schläfe, alles trägt dieselbe Art der Behand-
lung. Zwischen der Bildung weichen Fleisches
und fester Knochen ist kein Unterschied.
Dieser künstlerischen Auffassung lag eine
vergleichende Betrachtung zwischen dem zu
schaffenden Kunstwerke und einem lebenden
Menschen, der als Modell hätte dienen können,
noch nicht zugrunde. Das Kunstwerk selbst
wird in allen seinen Formen nur als Symbol
aufgefaßt zur Vermittlung eines bestimmt
formulierten künstlerischen Eindruckes oder
Gedankens.
&Ju
jJ^^^
f/ä
ili
HRj
Abb. 2
'") Näheres bei Lüthgen, a. a. O. S. 18.
Mit der Steigerung der technischen^Fähig-
keiten ändert sich um die Mitte des XV. Jahrh.
diese Auffassung mit einem Schlage. Jetzt
beginnt die Ausbildung und Umgestaltung der
Einzelmotive auf Grund selbständiger Natur-
betrachtung. Der Künstler sucht mehr und mehr
in den Organismus des Körpers einzudringen.
Dem veränderten Wollen wird man durch
neue Formen gerecht. Die einzelnen Teile
des menschlichen Körpers werden klarer be-
obachtet und naturwahrer gebildet, derart, daß
jeder Künstler, je nach seiner Begabung, hier
auf ein einzelnes Glied des menschlichen
Körpers seine Beobachtung richtet, dort viel-
leicht der organischen Verbindung
verschiedener Körperteile nach-
geht, während er in anderen Dingen
an der überlieferten Sprache
festhält.
Diese Stufe der Entwicklung
hat gegen Ende des Jahrhunderts
ihr Ziel erreicht. Einige Statuen
in der Kirche St. Johannes Ev.
und Bapt. in Fridolfing bietet-
dafür den Beweis. Vor allen die
Gestalten des h. Georg und
Florian.6) In ihnen vereinigt
sich die ganze Anmut der be-
fangenen • Bewegung, wie sie der
gotischen Kunst zu Ende des XV.
Jahrh. eigen war. Mit der feinen
Eleganz, der die volle Bewegungs-
möglichkeit noch fehlt, verbindet
sich mit der alten Kraft sicher
stilisierter Formen ein lebendes Gefühl für die
natürlichen Funktionen des Organismus.
Zumal in dem h. Georg. Mächtig holt der
Ritter zum Schlage aus; fest umspannt seine
hoch erhobene Rechte den Schwertgriff. Eine
genaue Beobachtung der Motive des Greifens
und Fassens muß dieser Darstellung voran-
gegangen sein.7) Und dies ist das wesentliche.
Denn es beweist, daß man über die rein
symbolische Formgebung hinaus zu einer Art
Naturstudium fortgeschritten ist.
Daher ist denn auch hier zum ersten Male
eine wirkliche Oberflächenbehandlung erreicht.
Mit klarer stofflicher Unterscheidung ist das
Gesicht ausgeführt, so die weichen Partien
6) Abb. in » Kunstdenkmale des Königreichs Bayern«.
S. 2H86.
7) Lüthgen a. a. O. S. 49.