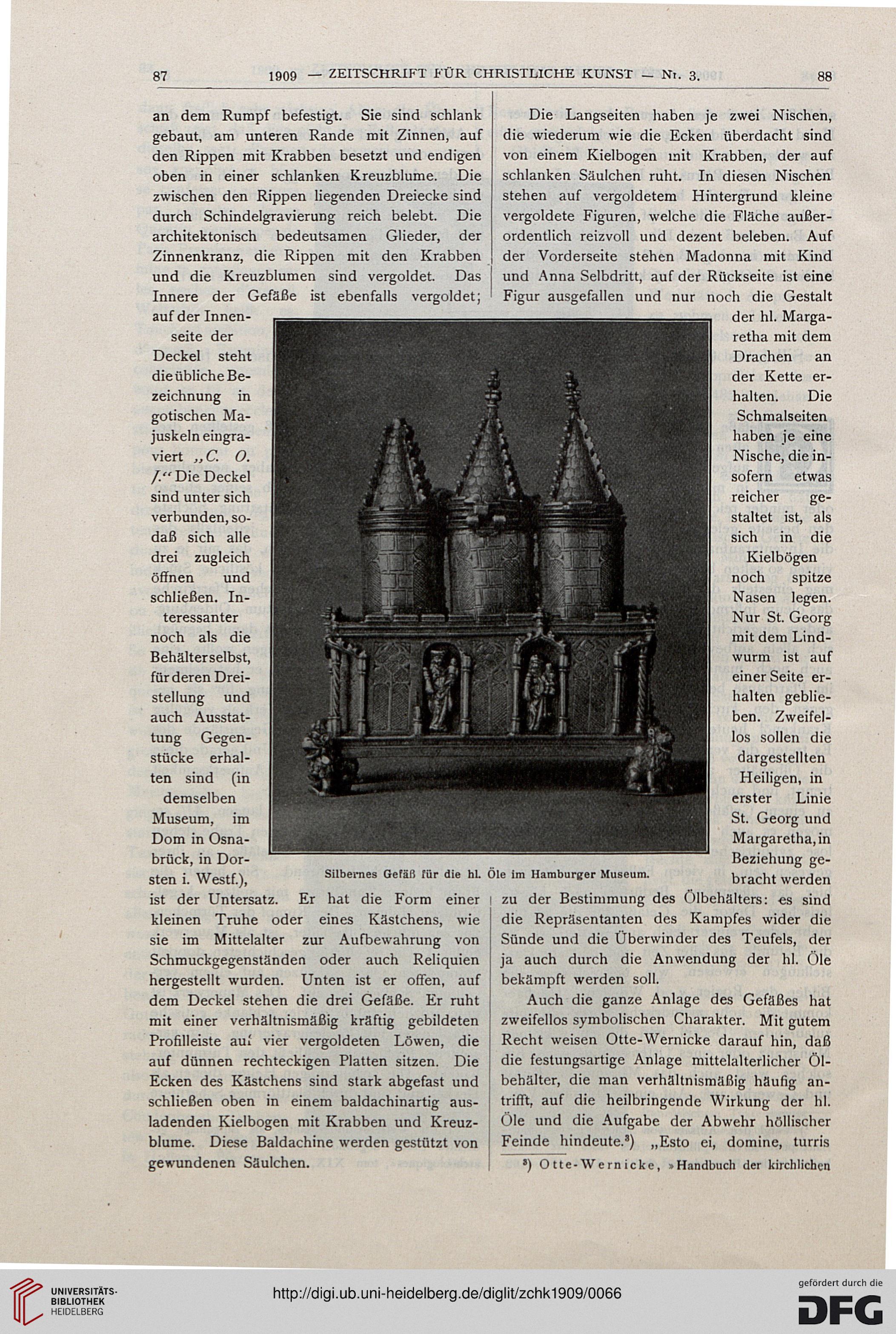87
1909 — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 3.
88
an dem Rumpf befestigt. Sie sind schlank
gebaut, am unteren Rande mit Zinnen, auf
den Rippen mit Krabben besetzt und endigen
oben in einer schlanken Kreuzblume. Die
zwischen den Rippen liegenden Dreiecke sind
durch Schindelgravierung reich belebt. Die
architektonisch bedeutsamen Glieder, der
Zinnenkranz, die Rippen mit den Krabben
und die Kreuzblumen sind vergoldet. Das
Innere der Gefäße ist ebenfalls vergoldet;
auf der Innen-
seite der
Deckel steht
die übliche Be-
zeichnung in
gotischen Ma-
juskelneingra-
viert „C. O.
/."Die Deckel
sind unter sich
verbunden, so-
daß sich alle
drei zugleich
öffnen und
schließen. In-
teressanter
noch als die
Behälterselbst,
für deren Drei-
stellung und
auch Ausstat-
tung Gegen-
stücke erhal-
ten sind (in
demselben
Museum, im
Dom in Osna-
brück, in Dor-
sten i. Westf.), Silbernes Gefäß für die hL
ist der Untersatz. Er hat die Form einer
kleinen Truhe oder eines Kästchens, wie
sie im Mittelalter zur Aufbewahrung von
Schmuckgegenständen oder auch Reliquien
hergestellt wurden. Unten ist er offen, auf
dem Deckel stehen die drei Gefäße. Er ruht
mit einer verhältnismäßig kräftig gebildeten
Profilleiste aul vier vergoldeten Löwen, die
auf dünnen rechteckigen Platten sitzen. Die
Ecken des Kästchens sind stark abgefast und
schließen oben in einem baldachinartig aus-
ladenden Kielbogen mit Krabben und Kreuz-
blume. Diese Baldachine werden gestützt von
gewundenen Säulchen.
Die Langseiten haben je zwei Nischen,
die wiederum wie die Ecken überdacht sind
von einem Kielbogen mit Krabben, der auf
schlanken Säulchen ruht. In diesen Nischen
stehen auf vergoldetem Hintergrund kleine
vergoldete Figuren, welche die Fläche außer-
ordentlich reizvoll und dezent beleben. Auf
der Vorderseite stehen Madonna mit Kind
und Anna Selbdritt, auf der Rückseite ist eine
Figur ausgefallen und nur noch die Gestalt
der hl. Marga-
retha mit dem
Drachen an
der Kette er-
halten. Die
Schmalseiten
haben je eine
Nische, die in-
sofern etwas
reicher ge-
staltet ist, als
sich in die
Kielbögen
noch spitze
Nasen legen.
Nur St. Georg
mit dem Lind-
wurm ist auf
einer Seite er-
halten geblie-
ben. Zweifel-
los sollen die
dargestellten
Heiligen, in
erster Linie
St. Georg und
Margaretha,in
Beziehung ge-
Öle im Hamburger Museum. bracht werden
I zu der Bestimmung des Ölbehälters: es sind
die Repräsentanten des Kampfes wider die
Sünde und die Überwinder des Teufels, der
ja auch durch die Anwendung der hl. Öle
bekämpft werden soll.
Auch die ganze Anlage des Gefäßes hat
zweifellos symbolischen Charakter. Mit gutem
Recht weisen Otte-Wernicke darauf hin, daß
die festungsartige Anlage mittelalterlicher Öl-
behälter, die man verhältnismäßig häufig an-
trifft, auf die heilbringende Wirkung der hl.
Öle und die Aufgabe der Abwehr höllischer
Feinde hindeute.3) „Esto ei, domine, turris
») Otte-Wernicke, »Handbuch der kirchlichen
1909 — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 3.
88
an dem Rumpf befestigt. Sie sind schlank
gebaut, am unteren Rande mit Zinnen, auf
den Rippen mit Krabben besetzt und endigen
oben in einer schlanken Kreuzblume. Die
zwischen den Rippen liegenden Dreiecke sind
durch Schindelgravierung reich belebt. Die
architektonisch bedeutsamen Glieder, der
Zinnenkranz, die Rippen mit den Krabben
und die Kreuzblumen sind vergoldet. Das
Innere der Gefäße ist ebenfalls vergoldet;
auf der Innen-
seite der
Deckel steht
die übliche Be-
zeichnung in
gotischen Ma-
juskelneingra-
viert „C. O.
/."Die Deckel
sind unter sich
verbunden, so-
daß sich alle
drei zugleich
öffnen und
schließen. In-
teressanter
noch als die
Behälterselbst,
für deren Drei-
stellung und
auch Ausstat-
tung Gegen-
stücke erhal-
ten sind (in
demselben
Museum, im
Dom in Osna-
brück, in Dor-
sten i. Westf.), Silbernes Gefäß für die hL
ist der Untersatz. Er hat die Form einer
kleinen Truhe oder eines Kästchens, wie
sie im Mittelalter zur Aufbewahrung von
Schmuckgegenständen oder auch Reliquien
hergestellt wurden. Unten ist er offen, auf
dem Deckel stehen die drei Gefäße. Er ruht
mit einer verhältnismäßig kräftig gebildeten
Profilleiste aul vier vergoldeten Löwen, die
auf dünnen rechteckigen Platten sitzen. Die
Ecken des Kästchens sind stark abgefast und
schließen oben in einem baldachinartig aus-
ladenden Kielbogen mit Krabben und Kreuz-
blume. Diese Baldachine werden gestützt von
gewundenen Säulchen.
Die Langseiten haben je zwei Nischen,
die wiederum wie die Ecken überdacht sind
von einem Kielbogen mit Krabben, der auf
schlanken Säulchen ruht. In diesen Nischen
stehen auf vergoldetem Hintergrund kleine
vergoldete Figuren, welche die Fläche außer-
ordentlich reizvoll und dezent beleben. Auf
der Vorderseite stehen Madonna mit Kind
und Anna Selbdritt, auf der Rückseite ist eine
Figur ausgefallen und nur noch die Gestalt
der hl. Marga-
retha mit dem
Drachen an
der Kette er-
halten. Die
Schmalseiten
haben je eine
Nische, die in-
sofern etwas
reicher ge-
staltet ist, als
sich in die
Kielbögen
noch spitze
Nasen legen.
Nur St. Georg
mit dem Lind-
wurm ist auf
einer Seite er-
halten geblie-
ben. Zweifel-
los sollen die
dargestellten
Heiligen, in
erster Linie
St. Georg und
Margaretha,in
Beziehung ge-
Öle im Hamburger Museum. bracht werden
I zu der Bestimmung des Ölbehälters: es sind
die Repräsentanten des Kampfes wider die
Sünde und die Überwinder des Teufels, der
ja auch durch die Anwendung der hl. Öle
bekämpft werden soll.
Auch die ganze Anlage des Gefäßes hat
zweifellos symbolischen Charakter. Mit gutem
Recht weisen Otte-Wernicke darauf hin, daß
die festungsartige Anlage mittelalterlicher Öl-
behälter, die man verhältnismäßig häufig an-
trifft, auf die heilbringende Wirkung der hl.
Öle und die Aufgabe der Abwehr höllischer
Feinde hindeute.3) „Esto ei, domine, turris
») Otte-Wernicke, »Handbuch der kirchlichen