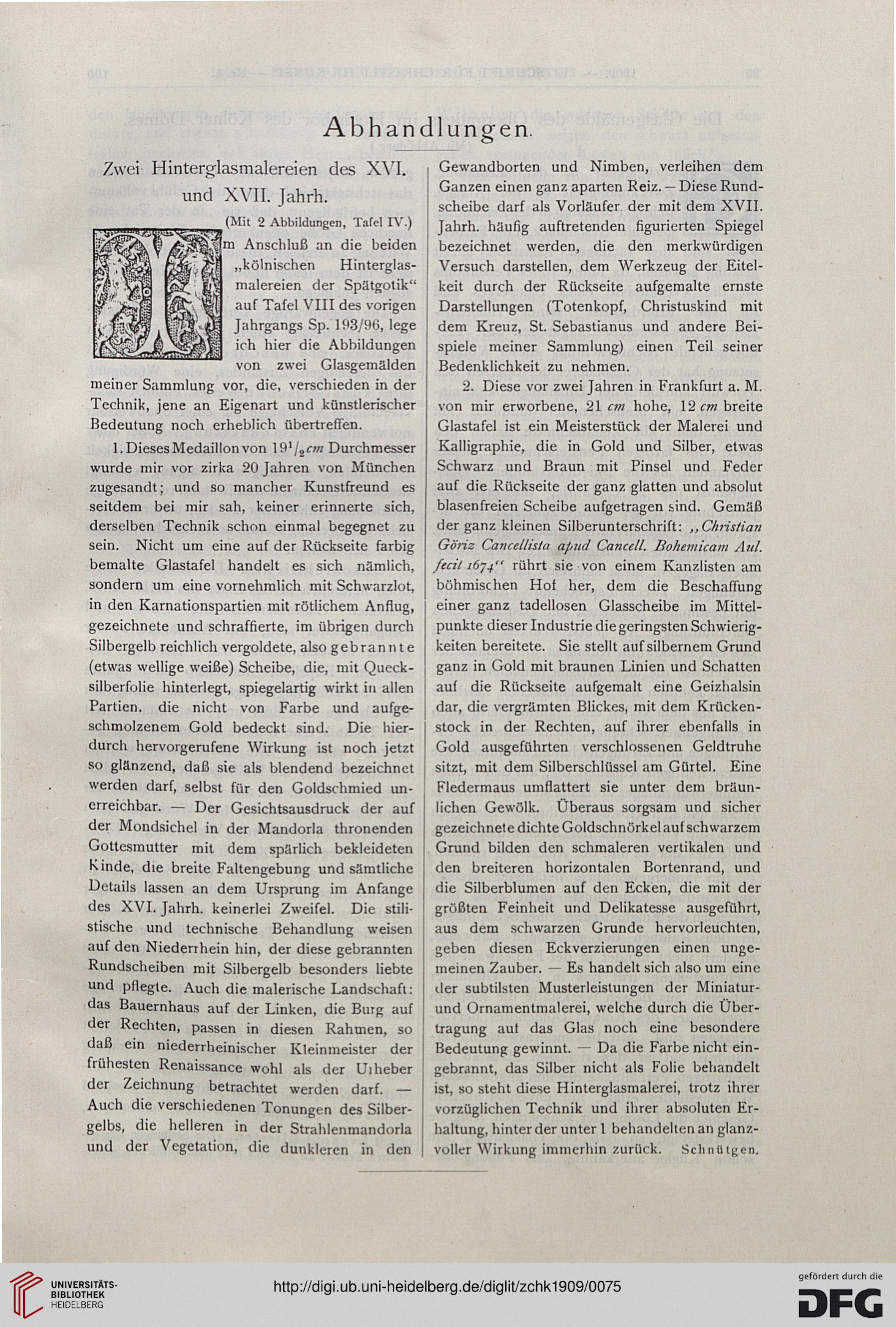Abhandlungen.
Zwei Hinterglasmalereien des XVI.
und XVII. Jahrh.
(Mit 2 Abbildungen, Tafel IV.)
m Anschluß an die beiden
„kölnischen Hinterglas-
malereien der Spätgotik"
Ä". 'Wt auf Tafel VIII des vorigen
gWiß Jahrgangs Sp. 193/96, lege
ich hier die Abbildungen
von zwei Glasgemälden
meiner Sammlung vor, die, verschieden in der
Technik, jene an Eigenart und künstlerischer
Bedeutung noch erheblich übertreffen.
1. Dieses Medaillon von I9*l2cm Durchmesser
wurde mir vor zirka 20 Jahren von München
zugesandt; und so mancher Kunstfreund es
seitdem bei mir sah, keiner erinnerte sich,
derselben Technik schon einmal begegnet zu
sein. Nicht um eine auf der Rückseite farbig
bemalte Glastafel handelt es sich nämlich,
sondern um eine vornehmlich mit Schwarzlot,
in den Karnationspartien mit rötlichem Anflug,
gezeichnete und schraffierte, im übrigen durch
Silbergelb reichlich vergoldete, also gebrannte
(etwas wellige weiße) Scheibe, die, mit Queck-
silberfolie hinterlegt, spiegelartig wirkt in allen
Partien, die nicht von Farbe und aufge-
schmolzenem Gold bedeckt sind. Die hier-
durch hervorgerufene Wirkung ist noch jetzt
so glänzend, daß sie als blendend bezeichnet
werden darf, selbst für den Goldschmied un-
erreichbar. — Der Gesichtsausdruck der auf
der Mondsichel in der Mandorla thronenden
Gottesmutter mit dem spärlich bekleideten
Kinde, die breite Faltengebung und sämtliche
Details lassen an dem Ursprung im Anfange
des XVI. Jahrh. keinerlei Zweifel. Die stili-
stische und technische Behandlung weisen
auf den Niederrhein hin, der diese gebrannten
Rundscheiben mit Silbergelb besonders liebte
und pflegte. Auch die malerische Landschaft:
das Bauernhaus auf der Linken, die Burg auf
der Rechten, passen in diesen Rahmen, so
daß ein niederrheinischer Kleinmeister der
frühesten Renaissance wohl als der Uiheber
der Zeichnung betrachtet werden darf. —
Auch die verschiedenen Tonungen des Silber-
gelbs, die helleren in der Strahlenmandorla
und der Vegetation, die dunkleren in den
Gewandborten und Nimben, verleihen dem
Ganzen einen ganz aparten Reiz. — Diese Rund-
scheibe darf als Vorläufer der mit dem XVII.
Jahrh. häufig auftretenden figurierten Spiegel
bezeichnet werden, die den merkwürdigen
Versuch darstellen, dem Werkzeug der Eitel-
keit durch der Rückseite aufgemalte ernste
Darstellungen (Totenkopf, Christuskind mit
dem Kreuz, St. Sebastianus und andere Bei-
spiele meiner Sammlung) einen Teil seiner
Bedenklichkeit zu nehmen.
2. Diese vor zwei Jahren in Frankfurt a. M.
von mir erworbene, 21 cm hohe, \2 cm breite
Glastafel ist ein Meisterstück der Malerei und
Kalligraphie, die in Gold und Silber, etwas
Schwarz und Braun mit Pinsel und Feder
auf die Rückseite der ganz glatten und absolut
blasenfreien Scheibe aufgetragen sind. Gemäß
der ganz kleinen Silberunterschrift: ,,Christian
Göriz Canccllista apud Cancell. Bohemkam Aul.
fecil 1674" rührt sie von einem Kanzlisten am
böhmischen Hof her, dem die Beschaffung
einer ganz tadellosen Glasscheibe im Mittel-
punkte dieser Industrie die geringsten Schwierig-
keiten bereitete. Sie stellt auf silbernem Grund
ganz in Gold mit braunen Linien und Schatten
auf die Rückseite aufgemalt eine Geizhalsin
dar, die vergrämten Blickes, mit dem Krücken-
stock in der Rechten, auf ihrer ebenfalls in
Gold ausgeführten verschlossenen Geldtruhe
sitzt, mit dem Silberschlüssel am Gürtel. Eine
Fledermaus umflattert sie unter dem bräun-
lichen Gewölk. Überaus sorgsam und sicher
gezeichnete dichte Goldschnörkel auf schwarzem
Grund bilden den schmaleren vertikalen und
den breiteren horizontalen Bortenrand, und
die Silberblumen auf den Ecken, die mit der
größten Feinheit und Delikatesse ausgeführt,
aus dem schwarzen Grunde hervorleuchten,
geben diesen Eckverzierungen einen unge-
meinen Zauber. — Es handelt sich also um eine
der subtilsten Musterleislungen der Miniatur-
und Ornamentmalerei, welche durch die Über-
tragung auf das Glas noch eine besondere
Bedeutung gewinnt. — Da die Farbe nicht ein-
gebrannt, das Silber nicht als Folie behandelt
ist, so steht diese Hinterglasmalerei, trotz ihrer
vorzüglichen Technik und ihrer absoluten Er-
haltung, hinter der unter 1 behandelten an glanz-
voller Wirkung immerhin zurück. Seh nützen.
Zwei Hinterglasmalereien des XVI.
und XVII. Jahrh.
(Mit 2 Abbildungen, Tafel IV.)
m Anschluß an die beiden
„kölnischen Hinterglas-
malereien der Spätgotik"
Ä". 'Wt auf Tafel VIII des vorigen
gWiß Jahrgangs Sp. 193/96, lege
ich hier die Abbildungen
von zwei Glasgemälden
meiner Sammlung vor, die, verschieden in der
Technik, jene an Eigenart und künstlerischer
Bedeutung noch erheblich übertreffen.
1. Dieses Medaillon von I9*l2cm Durchmesser
wurde mir vor zirka 20 Jahren von München
zugesandt; und so mancher Kunstfreund es
seitdem bei mir sah, keiner erinnerte sich,
derselben Technik schon einmal begegnet zu
sein. Nicht um eine auf der Rückseite farbig
bemalte Glastafel handelt es sich nämlich,
sondern um eine vornehmlich mit Schwarzlot,
in den Karnationspartien mit rötlichem Anflug,
gezeichnete und schraffierte, im übrigen durch
Silbergelb reichlich vergoldete, also gebrannte
(etwas wellige weiße) Scheibe, die, mit Queck-
silberfolie hinterlegt, spiegelartig wirkt in allen
Partien, die nicht von Farbe und aufge-
schmolzenem Gold bedeckt sind. Die hier-
durch hervorgerufene Wirkung ist noch jetzt
so glänzend, daß sie als blendend bezeichnet
werden darf, selbst für den Goldschmied un-
erreichbar. — Der Gesichtsausdruck der auf
der Mondsichel in der Mandorla thronenden
Gottesmutter mit dem spärlich bekleideten
Kinde, die breite Faltengebung und sämtliche
Details lassen an dem Ursprung im Anfange
des XVI. Jahrh. keinerlei Zweifel. Die stili-
stische und technische Behandlung weisen
auf den Niederrhein hin, der diese gebrannten
Rundscheiben mit Silbergelb besonders liebte
und pflegte. Auch die malerische Landschaft:
das Bauernhaus auf der Linken, die Burg auf
der Rechten, passen in diesen Rahmen, so
daß ein niederrheinischer Kleinmeister der
frühesten Renaissance wohl als der Uiheber
der Zeichnung betrachtet werden darf. —
Auch die verschiedenen Tonungen des Silber-
gelbs, die helleren in der Strahlenmandorla
und der Vegetation, die dunkleren in den
Gewandborten und Nimben, verleihen dem
Ganzen einen ganz aparten Reiz. — Diese Rund-
scheibe darf als Vorläufer der mit dem XVII.
Jahrh. häufig auftretenden figurierten Spiegel
bezeichnet werden, die den merkwürdigen
Versuch darstellen, dem Werkzeug der Eitel-
keit durch der Rückseite aufgemalte ernste
Darstellungen (Totenkopf, Christuskind mit
dem Kreuz, St. Sebastianus und andere Bei-
spiele meiner Sammlung) einen Teil seiner
Bedenklichkeit zu nehmen.
2. Diese vor zwei Jahren in Frankfurt a. M.
von mir erworbene, 21 cm hohe, \2 cm breite
Glastafel ist ein Meisterstück der Malerei und
Kalligraphie, die in Gold und Silber, etwas
Schwarz und Braun mit Pinsel und Feder
auf die Rückseite der ganz glatten und absolut
blasenfreien Scheibe aufgetragen sind. Gemäß
der ganz kleinen Silberunterschrift: ,,Christian
Göriz Canccllista apud Cancell. Bohemkam Aul.
fecil 1674" rührt sie von einem Kanzlisten am
böhmischen Hof her, dem die Beschaffung
einer ganz tadellosen Glasscheibe im Mittel-
punkte dieser Industrie die geringsten Schwierig-
keiten bereitete. Sie stellt auf silbernem Grund
ganz in Gold mit braunen Linien und Schatten
auf die Rückseite aufgemalt eine Geizhalsin
dar, die vergrämten Blickes, mit dem Krücken-
stock in der Rechten, auf ihrer ebenfalls in
Gold ausgeführten verschlossenen Geldtruhe
sitzt, mit dem Silberschlüssel am Gürtel. Eine
Fledermaus umflattert sie unter dem bräun-
lichen Gewölk. Überaus sorgsam und sicher
gezeichnete dichte Goldschnörkel auf schwarzem
Grund bilden den schmaleren vertikalen und
den breiteren horizontalen Bortenrand, und
die Silberblumen auf den Ecken, die mit der
größten Feinheit und Delikatesse ausgeführt,
aus dem schwarzen Grunde hervorleuchten,
geben diesen Eckverzierungen einen unge-
meinen Zauber. — Es handelt sich also um eine
der subtilsten Musterleislungen der Miniatur-
und Ornamentmalerei, welche durch die Über-
tragung auf das Glas noch eine besondere
Bedeutung gewinnt. — Da die Farbe nicht ein-
gebrannt, das Silber nicht als Folie behandelt
ist, so steht diese Hinterglasmalerei, trotz ihrer
vorzüglichen Technik und ihrer absoluten Er-
haltung, hinter der unter 1 behandelten an glanz-
voller Wirkung immerhin zurück. Seh nützen.