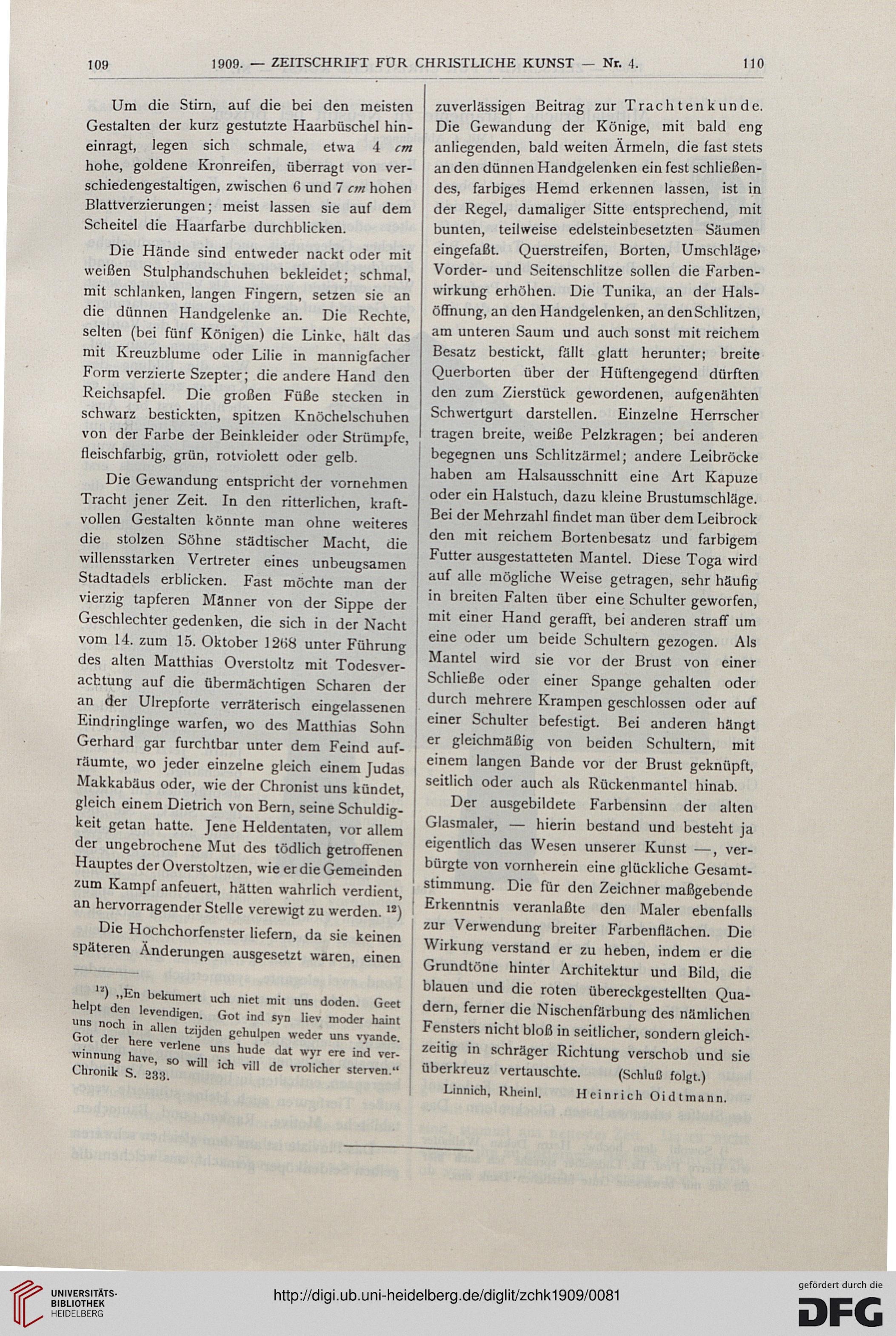109
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 4.
110
Um die Stirn, auf die bei den meisten
Gestalten der kurz gestutzte Haarbüschel hin-
einragt, legen sich schmale, etwa 4 cm
hohe, goldene Kronreifen, überragt von ver-
schiedengestaltigen, zwischen 6 und 7 cm hohen
Blattverzierungen; meist lassen sie auf dem
Scheitel die Haarfarbe durchblicken.
Die Hände sind entweder nackt oder mit
weißen Stulphandschuhen bekleidet; schmal,
mit schlanken, langen Fingern, setzen sie an
die dünnen Handgelenke an. Die Rechte,
selten (bei fünf Königen) die Linke, hält das
mit Kreuzblume oder Lilie in mannigfacher
Form verzierte Szepter; die andere Hand den
Reichsapfel. Die großen Füße stecken in
schwarz bestickten, spitzen Knöchelschuhen
von der Farbe der Beinkleider oder Strümpfe,
fleischfarbig, grün, rotviolett oder gelb.
Die Gewandung entspricht der vornehmen
Tracht jener Zeit. In den ritterlichen, kraft-
vollen Gestalten könnte man ohne weiteres
die stolzen Söhne städtischer Macht, die
willensstarken Vertreter eines unbeugsamen
Stadtadels erblicken. Fast möchte man der
vierzig tapferen Männer von der Sippe der
Geschlechter gedenken, die sich in der Nacht
vom 14. zum 15. Oktober 12t>8 unter Führung
des alten Matthias Overstoltz mit Todesver-
achtung auf die übermächtigen Scharen der
an der Ulrepforte verräterisch eingelassenen
Eindringlinge warfen, wo des Matthias Sohn
Gerhard gar furchtbar unter dem Feind auf-
räumte, wo jeder einzelne gleich einem Judas
Makkabäus oder, wie der Chronist uns kündet,
gleich einem Dietrich von Bern, seine Schuldig-
keit getan hatte. Jene Heldentaten, vor allem
der ungebrochene Mut des tödlich getroffenen
Hauptes derOverstoltzen, wie er die Gemeinden
zum Kampf anfeuert, hätten wahrlich verdient,
an hervorragenderStelle verewigt zu werden. IS)
Die Hochchorfenster liefern, da sie keinen
späteren Änderungen ausgesetzt waren, einen
") „En bekumert uch niet mit uns doden. Geet
nelpt den levendigen. Got ind syn liev moder haint
uns noch in allen tzijden gehulpen weder uns wände
der °ere ver'ene uns hude dat wyr ere in'd ver-
as";M wiu ich viu * —*- —■■•
zuverlässigen Beitrag zur Trachtenkunde.
Die Gewandung der Könige, mit bald eng
anliegenden, bald weiten Ärmeln, die fast stets
an den dünnen Handgelenken ein fest schließen-
des, farbiges Hemd erkennen lassen, ist in
der Regel, damaliger Sitte entsprechend, mit
bunten, teilweise edelsteinbesetzten Säumen
eingefaßt. Querstreifen, Borten, Umschläge.
Vorder- und Seitenschlitze sollen die Farben-
wirkung erhöhen. Die Tunika, an der Hals-
öffnung, an den Handgelenken, an den Schlitzen,
am unteren Saum und auch sonst mit reichem
Besatz bestickt, fällt glatt herunter; breite
Querborten über der Hüftengegend dürften
den zum Zierstück gewordenen, aufgenähten
Schwertgurt darstellen. Einzelne Herrscher
tragen breite, weiße Pelzkragen; bei anderen
begegnen uns Schlitzärmel; andere Leibröcke
haben am Halsausschnitt eine Art Kapuze
oder ein Halstuch, dazu kleine Brustumschläge.
Bei der Mehrzahl findet man über dem Leibrock
den mit reichem Bortenbesatz und farbigem
Futter ausgestatteten Mantel. Diese Toga wird
auf alle mögliche Weise getragen, sehr häufig
in breiten Falten über eine Schulter geworfen,
mit einer Hand gerafft, bei anderen straff um
eine oder um beide Schultern gezogen. Als
Mantel wird sie vor der Brust von einer
Schließe oder einer Spange gehalten oder
durch mehrere Krampen geschlossen oder auf
einer Schulter befestigt. Bei anderen hängt
er gleichmäßig von beiden Schultern, mit
einem langen Bande vor der Brust geknüpft,
seitlich oder auch als Rückenmantel hinab.
Der ausgebildete Farbensinn der alten
Glasmaler, — hierin bestand und besteht ja
eigentlich das Wesen unserer Kunst —, ver-
bürgte von vornherein eine glückliche Gesamt-
stimmung. Die für den Zeichner maßgebende
; Erkenntnis veranlaßte den Maler ebenfalls
| zur Verwendung breiter Farbenflächen. Die
Wirkung verstand er zu heben, indem er die
Grundtöne hinter Architektur und Bild, die
blauen und die roten übereckgestellten Qua-
dern, ferner die Nischenfärbung des nämlichen
Fensters nicht bloß in seitlicher, sondern gleich-
zeitig in schräger Richtung verschob und sie
überkreuz vertauschte. (Schluß folgt.)
Linnich, Rheinl. Heinrich Oidtmann.
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 4.
110
Um die Stirn, auf die bei den meisten
Gestalten der kurz gestutzte Haarbüschel hin-
einragt, legen sich schmale, etwa 4 cm
hohe, goldene Kronreifen, überragt von ver-
schiedengestaltigen, zwischen 6 und 7 cm hohen
Blattverzierungen; meist lassen sie auf dem
Scheitel die Haarfarbe durchblicken.
Die Hände sind entweder nackt oder mit
weißen Stulphandschuhen bekleidet; schmal,
mit schlanken, langen Fingern, setzen sie an
die dünnen Handgelenke an. Die Rechte,
selten (bei fünf Königen) die Linke, hält das
mit Kreuzblume oder Lilie in mannigfacher
Form verzierte Szepter; die andere Hand den
Reichsapfel. Die großen Füße stecken in
schwarz bestickten, spitzen Knöchelschuhen
von der Farbe der Beinkleider oder Strümpfe,
fleischfarbig, grün, rotviolett oder gelb.
Die Gewandung entspricht der vornehmen
Tracht jener Zeit. In den ritterlichen, kraft-
vollen Gestalten könnte man ohne weiteres
die stolzen Söhne städtischer Macht, die
willensstarken Vertreter eines unbeugsamen
Stadtadels erblicken. Fast möchte man der
vierzig tapferen Männer von der Sippe der
Geschlechter gedenken, die sich in der Nacht
vom 14. zum 15. Oktober 12t>8 unter Führung
des alten Matthias Overstoltz mit Todesver-
achtung auf die übermächtigen Scharen der
an der Ulrepforte verräterisch eingelassenen
Eindringlinge warfen, wo des Matthias Sohn
Gerhard gar furchtbar unter dem Feind auf-
räumte, wo jeder einzelne gleich einem Judas
Makkabäus oder, wie der Chronist uns kündet,
gleich einem Dietrich von Bern, seine Schuldig-
keit getan hatte. Jene Heldentaten, vor allem
der ungebrochene Mut des tödlich getroffenen
Hauptes derOverstoltzen, wie er die Gemeinden
zum Kampf anfeuert, hätten wahrlich verdient,
an hervorragenderStelle verewigt zu werden. IS)
Die Hochchorfenster liefern, da sie keinen
späteren Änderungen ausgesetzt waren, einen
") „En bekumert uch niet mit uns doden. Geet
nelpt den levendigen. Got ind syn liev moder haint
uns noch in allen tzijden gehulpen weder uns wände
der °ere ver'ene uns hude dat wyr ere in'd ver-
as";M wiu ich viu * —*- —■■•
zuverlässigen Beitrag zur Trachtenkunde.
Die Gewandung der Könige, mit bald eng
anliegenden, bald weiten Ärmeln, die fast stets
an den dünnen Handgelenken ein fest schließen-
des, farbiges Hemd erkennen lassen, ist in
der Regel, damaliger Sitte entsprechend, mit
bunten, teilweise edelsteinbesetzten Säumen
eingefaßt. Querstreifen, Borten, Umschläge.
Vorder- und Seitenschlitze sollen die Farben-
wirkung erhöhen. Die Tunika, an der Hals-
öffnung, an den Handgelenken, an den Schlitzen,
am unteren Saum und auch sonst mit reichem
Besatz bestickt, fällt glatt herunter; breite
Querborten über der Hüftengegend dürften
den zum Zierstück gewordenen, aufgenähten
Schwertgurt darstellen. Einzelne Herrscher
tragen breite, weiße Pelzkragen; bei anderen
begegnen uns Schlitzärmel; andere Leibröcke
haben am Halsausschnitt eine Art Kapuze
oder ein Halstuch, dazu kleine Brustumschläge.
Bei der Mehrzahl findet man über dem Leibrock
den mit reichem Bortenbesatz und farbigem
Futter ausgestatteten Mantel. Diese Toga wird
auf alle mögliche Weise getragen, sehr häufig
in breiten Falten über eine Schulter geworfen,
mit einer Hand gerafft, bei anderen straff um
eine oder um beide Schultern gezogen. Als
Mantel wird sie vor der Brust von einer
Schließe oder einer Spange gehalten oder
durch mehrere Krampen geschlossen oder auf
einer Schulter befestigt. Bei anderen hängt
er gleichmäßig von beiden Schultern, mit
einem langen Bande vor der Brust geknüpft,
seitlich oder auch als Rückenmantel hinab.
Der ausgebildete Farbensinn der alten
Glasmaler, — hierin bestand und besteht ja
eigentlich das Wesen unserer Kunst —, ver-
bürgte von vornherein eine glückliche Gesamt-
stimmung. Die für den Zeichner maßgebende
; Erkenntnis veranlaßte den Maler ebenfalls
| zur Verwendung breiter Farbenflächen. Die
Wirkung verstand er zu heben, indem er die
Grundtöne hinter Architektur und Bild, die
blauen und die roten übereckgestellten Qua-
dern, ferner die Nischenfärbung des nämlichen
Fensters nicht bloß in seitlicher, sondern gleich-
zeitig in schräger Richtung verschob und sie
überkreuz vertauschte. (Schluß folgt.)
Linnich, Rheinl. Heinrich Oidtmann.