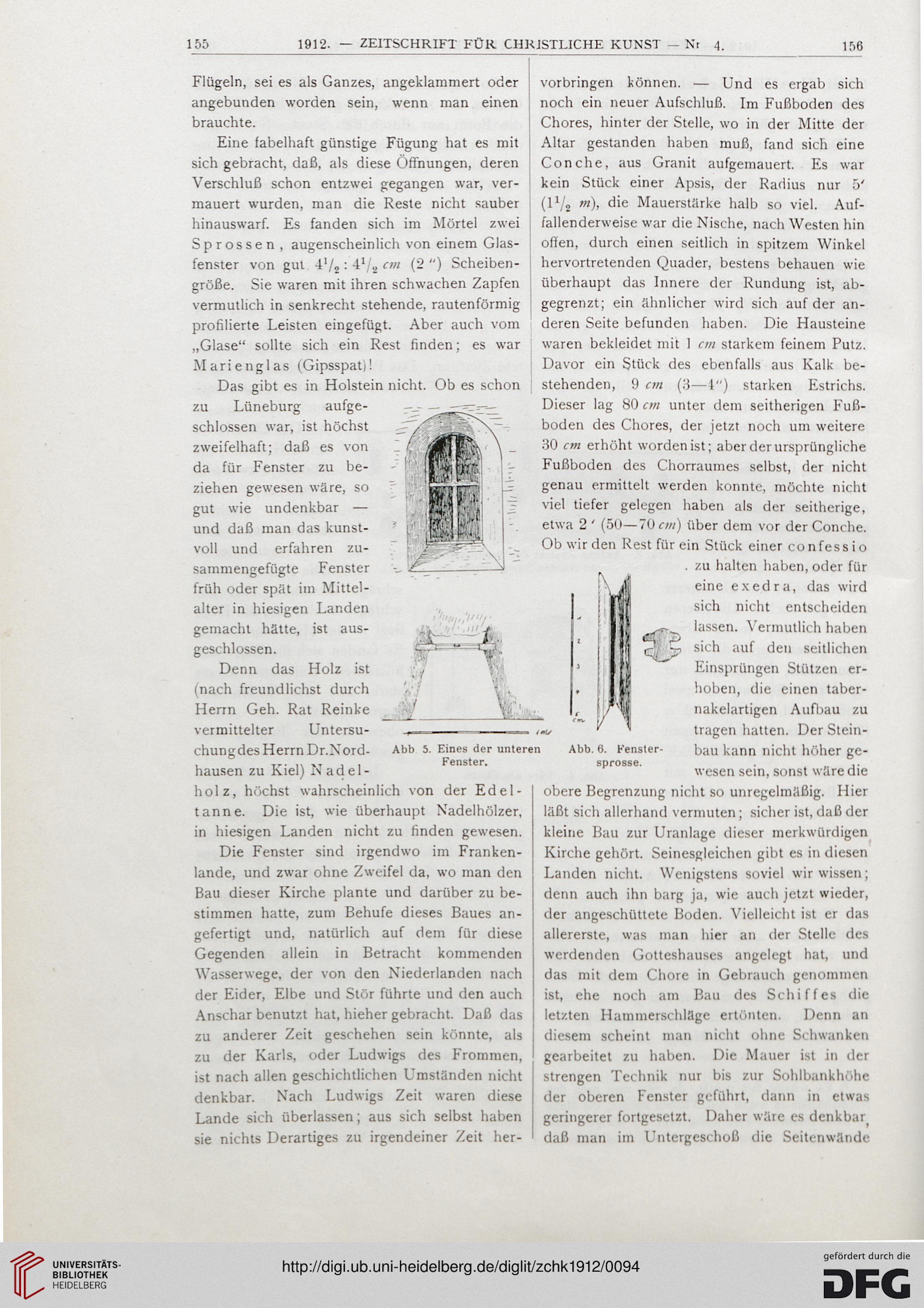155
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 4.
156
Flügeln, sei es als Ganzes, angeklammert oder
angebunden worden sein, wenn man einen
brauchte.
Eine fabelhaft günstige Fügung hat es mit
sich gebracht, daß, als diese Öffnungen, deren
Verschluß schon entzwei gegangen war, ver-
mauert wurden, man die Reste nicht sauber
hinauswarf. Es fanden sich im Mörtel zwei
Sprossen , augenscheinlich von einem Glas-
fenster von gut 4'/2 : 41 , cm (2 ") Scheiben-
größe. Sie waren mit ihren schwachen Zapfen
vermutlich in senkrecht stehende, rautenförmig
profilierte Leisten eingefügt. Aber auch vom
„Glase" sollte sich ein Rest finden; es war
.Marienglas (Gipsspatj!
Das gibt es in Holstein nicht. Ob es schon
zu Lüneburg aufge-
schlossen war, ist höchst
zweifelhaft; daß es von
da für Fenster zu be-
ziehen gewesen wäre, so
gut wie undenkbar —
und daß man das kunst-
voll und erfahren zu-
sammengefügte Fenster
früh oder spät im Mittel-
alter in hiesigen Landen
gemacht hätte, ist aus-
geschlossen.
Denn das Holz ist
(nach freundlichst durch
Herrn Geh. Rat Reinke
vermittelter Untersu-
chungdes Herrn Dr.Nord-
hausen zu Kiel) Nadel-
holz, höchst wahrscheinlich von der Edel-
tanne. Die ist, wie überhaupt Nadelhölzer,
in hiesigen Landen nicht zu finden gewesen.
Die Fenster sind irgendwo im Franken-
lande, und zwar ohne Zweifel da, wo man den
Bau dieser Kirche plante und darüber zu be-
stimmen hatte, zum Behufe dieses Baues an-
gefertigt und, natürlich auf dem für diese
Gegenden allein in Betracht kommenden
Wasserwege, der von den Niederlanden na< li
der Eider, Elbe und Stör führte und den auch
Anscharbenutzt hat, hiehergebracht. Daß das
zu anderer Zeit geschehen sein könnte, als
zu der Karls, oder Ludwigs des Frommen,
ist nach allen geschichtlichen Umständen nicht
denkbar. Nach Ludwigs Zeit waren diese
Lande sich überlassen; aus sich selbst haben
sie nichts Derartiges zu irgendeiner Zeit her-
Abb 5. Eines der unteren
Fenster.
vorbringen können. — Und es ergab sich
noch ein neuer Aufschluß. Im Fußboden des
Chores, hinter der Stelle, wo in der Mitte der
Altar gestanden haben muß, fand sich eine
Conche, aus Granit aufgemauert. Es war
kein Stück einer Apsis, der Radius nur .V
(lVi m)> dle Mauerstärke halb so viel. Auf-
fallenderweise war die Nische, nach Westen hin
offen, durch einen seitlich in spitzem Winkel
hervortretenden Quader, bestens behauen wie
überhaupt das Innere der Rundung ist, ab-
gegrenzt; ein ähnlicher wird sich auf der an-
deren Seite befunden haben. Die Hausteine
waren bekleidet mit 1 cm starkem feinem Putz.
Davor ein Stück des ebenfalls aus Kalk be-
stehenden, 9 cm (3—4") starken Estrichs.
Dieser lag 80 cm unter dem seitherigen Fuß-
boden des Chores, der jetzt noch um weitere
30 cm erhöht worden ist; aber der ursprüngliche
Fußboden des Chorraumes selbst, der nicht
genau ermittelt werden konnte, möchte nicht
viel tiefer gelegen haben als der seitherige,
etwa 2 ' (50—70 cm) über dem vor der Conche.
Ob wir den Rest für ein Stück einer confessio
zu halten haben, oder für
eine e x e d r a, das wird
sich nicht entscheiden
lassen. Vermutlich haben
sich auf den seitlichen
Einsprüngen Stützen er-
hoben, die einen taber-
nakelartigen Aufbau zu
tragen hatten. Der Stein-
bau kann nicht höher ge-
wesen sein, sonst wäre die
obere Begrenzung nicht so unregelmäßig. Hier
läßt sich allerhand vermuten ; sicher ist, daß der
kleine Bau zur Uranlage dieser merkwürdigen
Kirche gehört. Seinesgleichen gibt es in diesen
Landen nicht. Wenigstens soviel wir wi
denn auch ihn barg ja, wie au< h jetzt wieder,
der angeschüttete Boden, Vielleicht ist er das
allererste, was man hier an der Stelle dei
werdenden Gotteshauses angelegt hat, und
das mit dem Chore in Gebrauch genommen
ist, ehe noch am Bau des Schiffet die
letzten Ilammers< hläge ertönten. Denn an
m scheint man nicht ohne Schwanken
gearbeitet zu haben. Die Mauei ist in dei
strengen Technik nur bis zur Sohlbankhöhe
der oberen Fenstei geführt, dann in etwas
geringerer fortgesetzt, Daher wäre es denkbar
d.ii'i man im Untergeschoß die Seitenwände
cf £>
Abb. 6. Kenster-
sprosse.
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 4.
156
Flügeln, sei es als Ganzes, angeklammert oder
angebunden worden sein, wenn man einen
brauchte.
Eine fabelhaft günstige Fügung hat es mit
sich gebracht, daß, als diese Öffnungen, deren
Verschluß schon entzwei gegangen war, ver-
mauert wurden, man die Reste nicht sauber
hinauswarf. Es fanden sich im Mörtel zwei
Sprossen , augenscheinlich von einem Glas-
fenster von gut 4'/2 : 41 , cm (2 ") Scheiben-
größe. Sie waren mit ihren schwachen Zapfen
vermutlich in senkrecht stehende, rautenförmig
profilierte Leisten eingefügt. Aber auch vom
„Glase" sollte sich ein Rest finden; es war
.Marienglas (Gipsspatj!
Das gibt es in Holstein nicht. Ob es schon
zu Lüneburg aufge-
schlossen war, ist höchst
zweifelhaft; daß es von
da für Fenster zu be-
ziehen gewesen wäre, so
gut wie undenkbar —
und daß man das kunst-
voll und erfahren zu-
sammengefügte Fenster
früh oder spät im Mittel-
alter in hiesigen Landen
gemacht hätte, ist aus-
geschlossen.
Denn das Holz ist
(nach freundlichst durch
Herrn Geh. Rat Reinke
vermittelter Untersu-
chungdes Herrn Dr.Nord-
hausen zu Kiel) Nadel-
holz, höchst wahrscheinlich von der Edel-
tanne. Die ist, wie überhaupt Nadelhölzer,
in hiesigen Landen nicht zu finden gewesen.
Die Fenster sind irgendwo im Franken-
lande, und zwar ohne Zweifel da, wo man den
Bau dieser Kirche plante und darüber zu be-
stimmen hatte, zum Behufe dieses Baues an-
gefertigt und, natürlich auf dem für diese
Gegenden allein in Betracht kommenden
Wasserwege, der von den Niederlanden na< li
der Eider, Elbe und Stör führte und den auch
Anscharbenutzt hat, hiehergebracht. Daß das
zu anderer Zeit geschehen sein könnte, als
zu der Karls, oder Ludwigs des Frommen,
ist nach allen geschichtlichen Umständen nicht
denkbar. Nach Ludwigs Zeit waren diese
Lande sich überlassen; aus sich selbst haben
sie nichts Derartiges zu irgendeiner Zeit her-
Abb 5. Eines der unteren
Fenster.
vorbringen können. — Und es ergab sich
noch ein neuer Aufschluß. Im Fußboden des
Chores, hinter der Stelle, wo in der Mitte der
Altar gestanden haben muß, fand sich eine
Conche, aus Granit aufgemauert. Es war
kein Stück einer Apsis, der Radius nur .V
(lVi m)> dle Mauerstärke halb so viel. Auf-
fallenderweise war die Nische, nach Westen hin
offen, durch einen seitlich in spitzem Winkel
hervortretenden Quader, bestens behauen wie
überhaupt das Innere der Rundung ist, ab-
gegrenzt; ein ähnlicher wird sich auf der an-
deren Seite befunden haben. Die Hausteine
waren bekleidet mit 1 cm starkem feinem Putz.
Davor ein Stück des ebenfalls aus Kalk be-
stehenden, 9 cm (3—4") starken Estrichs.
Dieser lag 80 cm unter dem seitherigen Fuß-
boden des Chores, der jetzt noch um weitere
30 cm erhöht worden ist; aber der ursprüngliche
Fußboden des Chorraumes selbst, der nicht
genau ermittelt werden konnte, möchte nicht
viel tiefer gelegen haben als der seitherige,
etwa 2 ' (50—70 cm) über dem vor der Conche.
Ob wir den Rest für ein Stück einer confessio
zu halten haben, oder für
eine e x e d r a, das wird
sich nicht entscheiden
lassen. Vermutlich haben
sich auf den seitlichen
Einsprüngen Stützen er-
hoben, die einen taber-
nakelartigen Aufbau zu
tragen hatten. Der Stein-
bau kann nicht höher ge-
wesen sein, sonst wäre die
obere Begrenzung nicht so unregelmäßig. Hier
läßt sich allerhand vermuten ; sicher ist, daß der
kleine Bau zur Uranlage dieser merkwürdigen
Kirche gehört. Seinesgleichen gibt es in diesen
Landen nicht. Wenigstens soviel wir wi
denn auch ihn barg ja, wie au< h jetzt wieder,
der angeschüttete Boden, Vielleicht ist er das
allererste, was man hier an der Stelle dei
werdenden Gotteshauses angelegt hat, und
das mit dem Chore in Gebrauch genommen
ist, ehe noch am Bau des Schiffet die
letzten Ilammers< hläge ertönten. Denn an
m scheint man nicht ohne Schwanken
gearbeitet zu haben. Die Mauei ist in dei
strengen Technik nur bis zur Sohlbankhöhe
der oberen Fenstei geführt, dann in etwas
geringerer fortgesetzt, Daher wäre es denkbar
d.ii'i man im Untergeschoß die Seitenwände
cf £>
Abb. 6. Kenster-
sprosse.