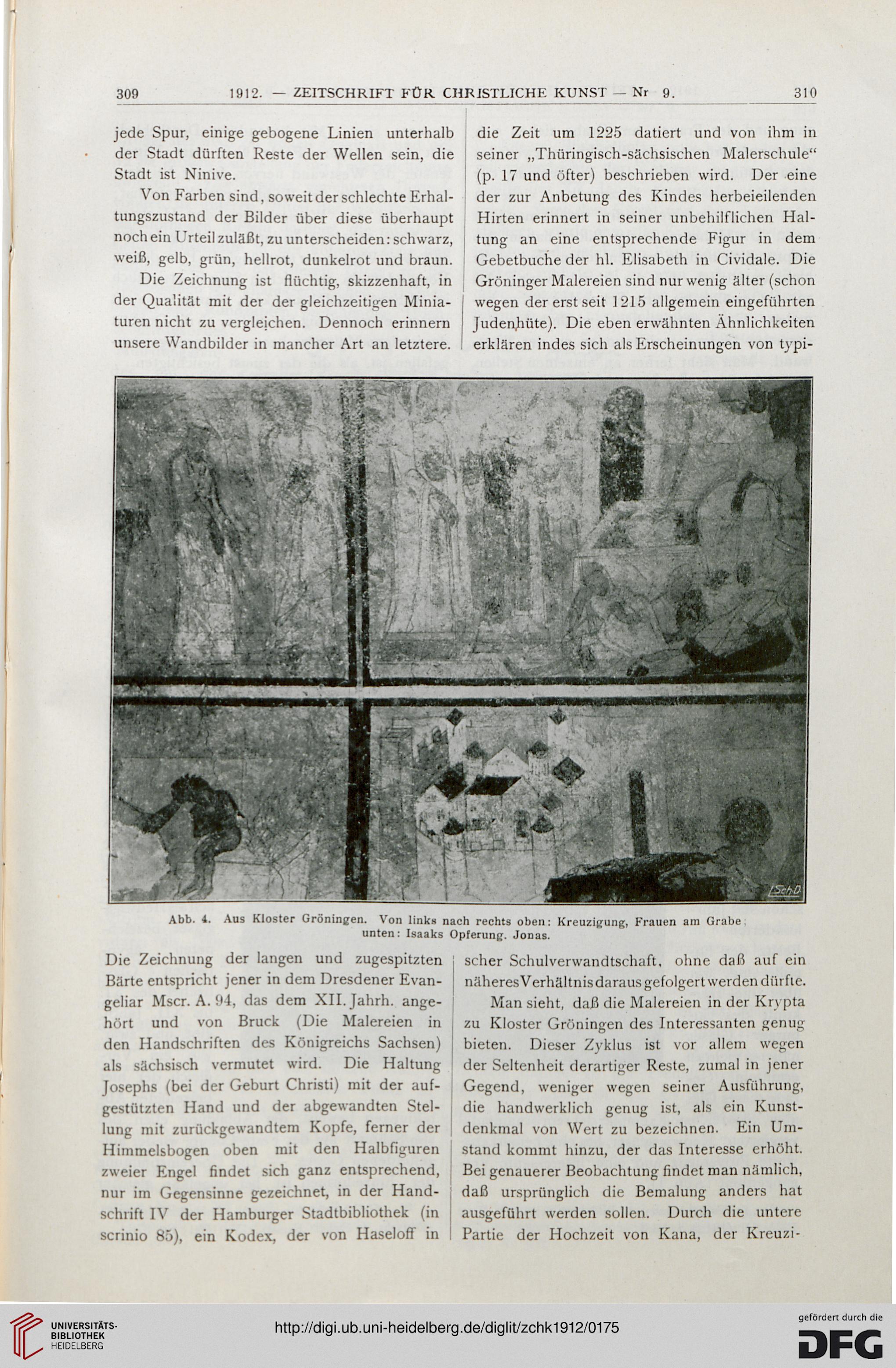309
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 9.
310
jede Spur, einige gebogene Linien unterhalb
der Stadt dürften Reste der Wellen sein, die
Stadt ist Ninive.
Von Farben sind, soweit der schlechte Erhal-
tungszustand der Bilder über diese überhaupt
noch ein Urteil zuläßt, zu unterscheiden: schwarz,
weiß, gelb, grün, hellrot, dunkelrot und braun.
Die Zeichnung ist flüchtig, skizzenhaft, in
der Qualität mit der der gleichzeitigen Minia-
turen nicht zu vergleichen. Dennoch erinnern
unsere Wandbilder in mancher Art an letztere.
die Zeit um 1225 datiert und von ihm in
seiner „Thüringisch-sächsischen Malerschule"
(p. 17 und öfter) beschrieben wird. Der eine
der zur Anbetung des Kindes herbeieilenden
Hirten erinnert in seiner unbehilflichen Hal-
tung an eine entsprechende Figur in dem
Gebetbuche der hl. Elisabeth in Cividale. Die
Gröninger Malereien sind nur wenig älter (schon
wegen der erst seit 1215 allgemein eingeführten
Juden,hüte). Die eben erwähnten Ähnlichkeiten
erklären indes sich als Erscheinungen von typi-
Uta
Abb. i. Aus Kloster Groningen. Von links nach rechts oben: Kreuzigung, Frauen am Grabe
unten: Isaaks Opferung. Jonas.
Die Zeichnung der langen und zugespitzten
Barte entspricht jener in dem Dresdener Evan-
geliar Mscr. A. 94, das dem XILJahrh. ange-
hurt und von Brück (Die Malereien in
den Handschriften des Königreichs Sachsen)
als sächsisch vermutet wird. Die Haltung
Josephs (bei der Geburt Christi) mit der auf-
gestützten Hand und der abgewandten Stel-
lung mit zurückgewandtem Kopfe, ferner der
Himmelsbogen oben mit den Halbfiguren
zweier Engel findet sich ganz entsprechend,
nur im Gegensinne gezeichnet, in der Hand-
schrift IV der Hamburger Stadtbibliothek (in
scrinio M.">), ein Kodex, der von Haseloff in
scher Schulverwandtschaft, ohne daß auf ein
näheres Verhältnis daraus gefolgert werden dürfte.
Man sieht, daß die Malereien in der Krypta
zu Kloster Groningen des Interessanten genug
bieten. Dieser Zyklus ist vor allem wegen
der Seltenheit derartiger Reste, zumal in jener
Gegend, weniger wegen seiner Ausführung,
die handwerklich genug ist, als ein Kunst-
denkmal von Wert zu bezeichnen. Ein Um-
stand kommt hinzu, der das Interesse erhöht.
Bei genauerer Beobachtung findet man nämlich,
daß ursprünglich die Bemalung anders hat
ausgeführt werden sollen. Durch die untere
Partie der Hochzeit von Kana, der Kreuzi-
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 9.
310
jede Spur, einige gebogene Linien unterhalb
der Stadt dürften Reste der Wellen sein, die
Stadt ist Ninive.
Von Farben sind, soweit der schlechte Erhal-
tungszustand der Bilder über diese überhaupt
noch ein Urteil zuläßt, zu unterscheiden: schwarz,
weiß, gelb, grün, hellrot, dunkelrot und braun.
Die Zeichnung ist flüchtig, skizzenhaft, in
der Qualität mit der der gleichzeitigen Minia-
turen nicht zu vergleichen. Dennoch erinnern
unsere Wandbilder in mancher Art an letztere.
die Zeit um 1225 datiert und von ihm in
seiner „Thüringisch-sächsischen Malerschule"
(p. 17 und öfter) beschrieben wird. Der eine
der zur Anbetung des Kindes herbeieilenden
Hirten erinnert in seiner unbehilflichen Hal-
tung an eine entsprechende Figur in dem
Gebetbuche der hl. Elisabeth in Cividale. Die
Gröninger Malereien sind nur wenig älter (schon
wegen der erst seit 1215 allgemein eingeführten
Juden,hüte). Die eben erwähnten Ähnlichkeiten
erklären indes sich als Erscheinungen von typi-
Uta
Abb. i. Aus Kloster Groningen. Von links nach rechts oben: Kreuzigung, Frauen am Grabe
unten: Isaaks Opferung. Jonas.
Die Zeichnung der langen und zugespitzten
Barte entspricht jener in dem Dresdener Evan-
geliar Mscr. A. 94, das dem XILJahrh. ange-
hurt und von Brück (Die Malereien in
den Handschriften des Königreichs Sachsen)
als sächsisch vermutet wird. Die Haltung
Josephs (bei der Geburt Christi) mit der auf-
gestützten Hand und der abgewandten Stel-
lung mit zurückgewandtem Kopfe, ferner der
Himmelsbogen oben mit den Halbfiguren
zweier Engel findet sich ganz entsprechend,
nur im Gegensinne gezeichnet, in der Hand-
schrift IV der Hamburger Stadtbibliothek (in
scrinio M.">), ein Kodex, der von Haseloff in
scher Schulverwandtschaft, ohne daß auf ein
näheres Verhältnis daraus gefolgert werden dürfte.
Man sieht, daß die Malereien in der Krypta
zu Kloster Groningen des Interessanten genug
bieten. Dieser Zyklus ist vor allem wegen
der Seltenheit derartiger Reste, zumal in jener
Gegend, weniger wegen seiner Ausführung,
die handwerklich genug ist, als ein Kunst-
denkmal von Wert zu bezeichnen. Ein Um-
stand kommt hinzu, der das Interesse erhöht.
Bei genauerer Beobachtung findet man nämlich,
daß ursprünglich die Bemalung anders hat
ausgeführt werden sollen. Durch die untere
Partie der Hochzeit von Kana, der Kreuzi-