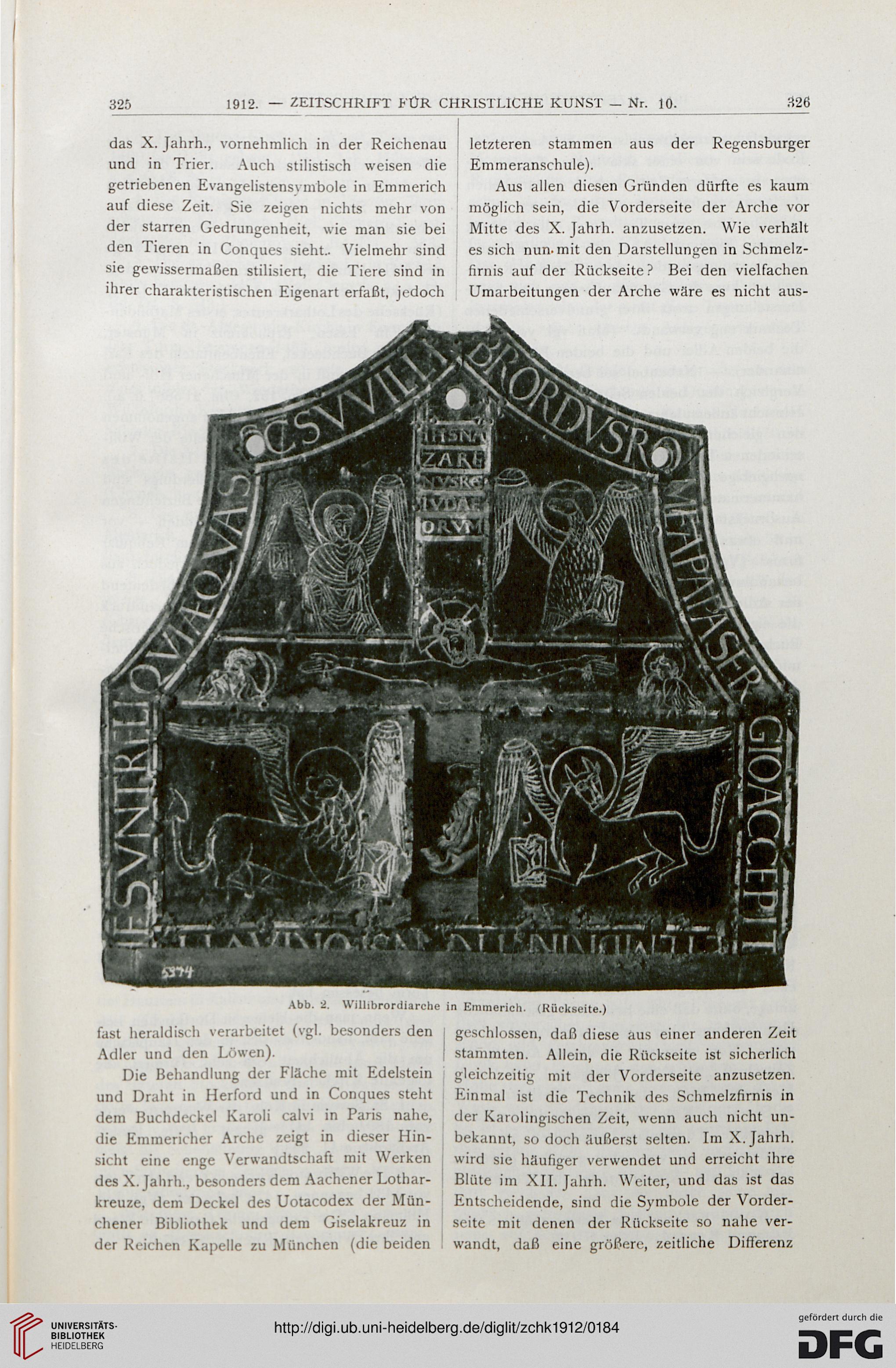325
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.
326
das X. Jahrh., vornehmlich in der Reichenau
und in Trier. Auch stilistisch weisen die
getriebenen Evangelistens\ mbole in Emmerich
auf diese Zeit. Sie zeigen nichts mehr von
der starren Gedrungenheit, wie man sie bei
den Tieren in Conques sieht.. Vielmehr sind
sie gewissermaßen stilisiert, die Tiere sind in
ihrer charakteristischen Eigenart erfaßt, jedoch
letzteren stammen aus der Regensburger
Emmeranschule).
Aus allen diesen Gründen dürfte es kaum
möglich sein, die Vorderseite der Arche vor
Mitte des X. Jahrh. anzusetzen. Wie verhält
es sich nun. mit den Darstellungen in Schmelz-
firnis auf der Rückseite ? Bei den vielfachen
Umarbeitungen der Arche wäre es nicht aus-
Abb. 2. Willibrordiarche
fast heraldisch verarbeitet (vgl. besonders den
Adler und den Löwen).
Die Behandlung der Fläche mit Edelstein
und Draht in Herford und in Conques steht
dem Buchdeckel Karoli calvi in Paris nahe,
die Emmericher Arche zeigt in dieser Hin-
si< ht eine enge Verwandtschaft mit Werken
des X. Jahrh., besonders dem Aachener Lothar- !
kreuze, dem Deckel des Uotacodex der Mün-
chener Bibliothek und dem Giselakreuz in
der Reichen Kapelle zu München (die beiden
in Emmerich. (Rückseite.)
geschlossen, daß diese aus einer anderen Zeit
stammten. Allein, die Rückseite ist sicherlich
gleichzeitig mit der Vorderseite anzusetzen.
Einmal ist die Technik des Schmelzfirnis in
der Karolingischen Zeit, wenn auch nicht un-
bekannt, so doch äußerst selten. Im X. Jahrh.
wird sie häufiger verwendet und erreicht ihre
Blüte im XII. Jahrh. Weiter, und das ist das
Entscheidende, sind die Symbole der Vorder-
seite mit denen der Rückseite so nahe ver-
wandt, daß eine größere, zeitliche Differenz
1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.
326
das X. Jahrh., vornehmlich in der Reichenau
und in Trier. Auch stilistisch weisen die
getriebenen Evangelistens\ mbole in Emmerich
auf diese Zeit. Sie zeigen nichts mehr von
der starren Gedrungenheit, wie man sie bei
den Tieren in Conques sieht.. Vielmehr sind
sie gewissermaßen stilisiert, die Tiere sind in
ihrer charakteristischen Eigenart erfaßt, jedoch
letzteren stammen aus der Regensburger
Emmeranschule).
Aus allen diesen Gründen dürfte es kaum
möglich sein, die Vorderseite der Arche vor
Mitte des X. Jahrh. anzusetzen. Wie verhält
es sich nun. mit den Darstellungen in Schmelz-
firnis auf der Rückseite ? Bei den vielfachen
Umarbeitungen der Arche wäre es nicht aus-
Abb. 2. Willibrordiarche
fast heraldisch verarbeitet (vgl. besonders den
Adler und den Löwen).
Die Behandlung der Fläche mit Edelstein
und Draht in Herford und in Conques steht
dem Buchdeckel Karoli calvi in Paris nahe,
die Emmericher Arche zeigt in dieser Hin-
si< ht eine enge Verwandtschaft mit Werken
des X. Jahrh., besonders dem Aachener Lothar- !
kreuze, dem Deckel des Uotacodex der Mün-
chener Bibliothek und dem Giselakreuz in
der Reichen Kapelle zu München (die beiden
in Emmerich. (Rückseite.)
geschlossen, daß diese aus einer anderen Zeit
stammten. Allein, die Rückseite ist sicherlich
gleichzeitig mit der Vorderseite anzusetzen.
Einmal ist die Technik des Schmelzfirnis in
der Karolingischen Zeit, wenn auch nicht un-
bekannt, so doch äußerst selten. Im X. Jahrh.
wird sie häufiger verwendet und erreicht ihre
Blüte im XII. Jahrh. Weiter, und das ist das
Entscheidende, sind die Symbole der Vorder-
seite mit denen der Rückseite so nahe ver-
wandt, daß eine größere, zeitliche Differenz