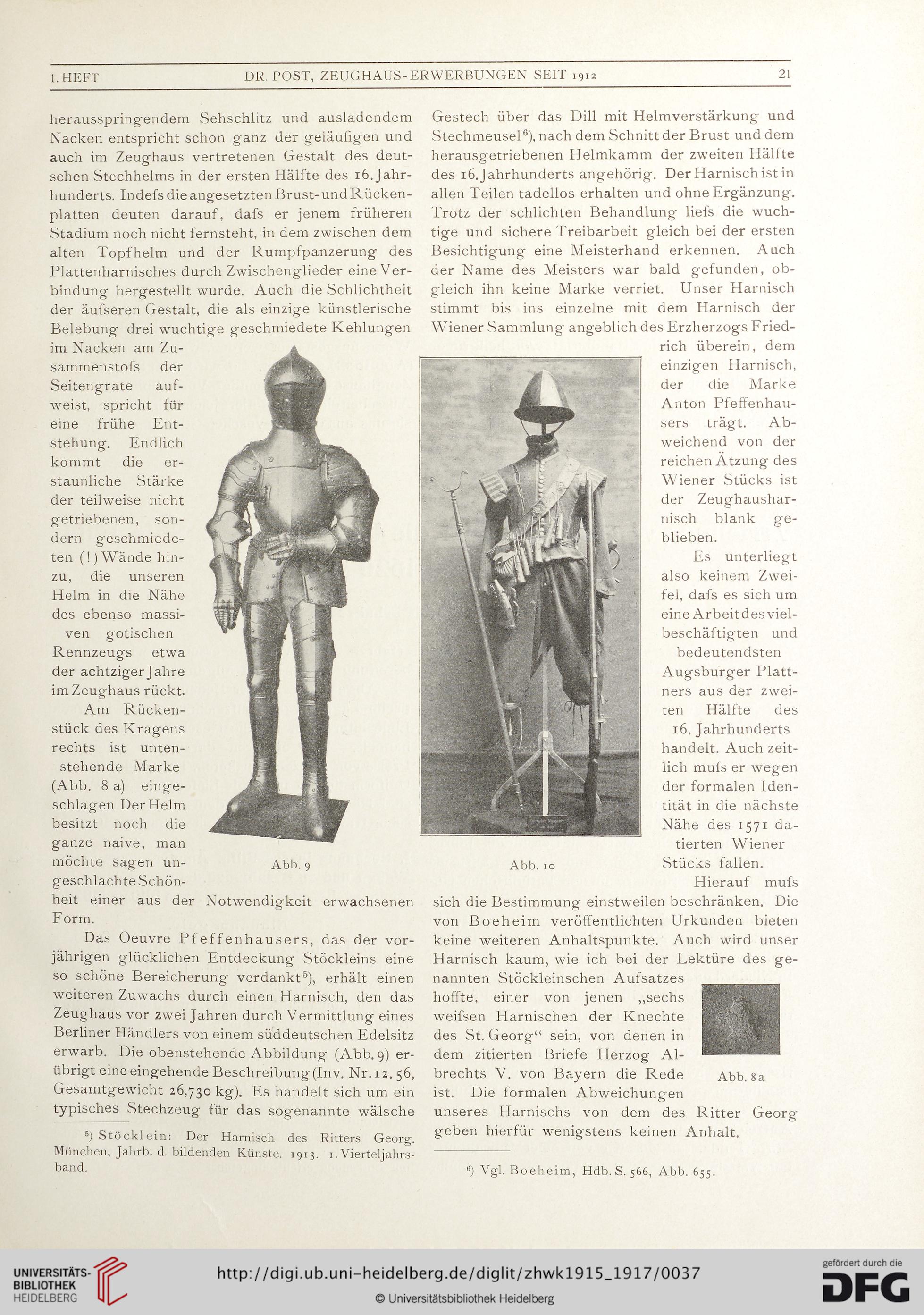1. HEFT
21
DR. POST, ZEUGHAUS-ERWERBUNGEN SEIT 1912
herausspringendem Sehschlitz und ausladendem
Nacken entspricht schon ganz der geläufigen und
auch im Zeughaus vertretenen Gestalt des deut-
schen Stechhelms in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Indefs dieangesetztenßrust-undRücken-
platten deuten darauf, dafs er jenem früheren
Stadium noch nicht fernsteht, in dem zwischen dem
alten Topfhelm und der Rumpfpanzerung des
Plattenharnisches durch Zwischenglieder eine Ver-
bindung hergestellt wurde. Auch die Schlichtheit
der äufseren Gestalt, die als einzige künstlerische
Belebung drei wuchtige geschmiedete Kehlungen
ganze naive, man “■'"'■»-W
möchte sagen un- Abb. 9
geschlachte Schön-
heit einer aus der Notwendigkeit erwachsenen
Form.
Das Oeuvre Pfeffenhausers, das der vor-
jährigen glücklichen Entdeckung Stöckleins eine
so schöne Bereicherung verdankt5), erhält einen
weiteren Zuwachs durch einen Harnisch, den das
Zeughaus vor zwei Jahren durch Vermittlung eines
Berliner Händlers von einem süddeutschen Edelsitz
erwarb. Die obenstehende Abbildung (Abb. 9) er-
übrigt eine eingehende Beschreibung (In v. Nr. 12. 56,
Gesamtgewicht 26,730 kg). Es handelt sich um ein
typisches Stechzeug für das sogenannte wälsche
5) Stöcklein: Der Harnisch des Ritters Georg.
München, Jahrb. d. bildenden Künste. 1913. 1. Vierteljahrs-
band.
Gestech über das Dill mit Helmverstärkung und
Stechmeusel6), nach dem Schnitt der Brust und dem
herausgetriebenen Helmkamm der zweiten Plälfte
des 16. Jahrhunderts angehörig. Der Harnisch ist in
allen Teilen tadellos erhalten und ohne Ergänzung.
Trotz der schlichten Behandlung liefs die wuch-
tige und sichere Treibarbeit gleich bei der ersten
Besichtigung eine Meisterhand erkennen. Auch
der Name des Meisters war bald gefunden, ob-
gleich ihn keine Marke verriet. Unser Harnisch
stimmt bis ins einzelne mit dem Harnisch der
Wierier Sammlung angeblich des Erzherzogs Fried-
rich überein, dem
einzigen Harnisch,
der die Marke
Anton Pfeffenhau-
sers trägt. Ab-
weichend von der
reichen Atzung des
Wiener Stücks ist
der Zeughaushar-
nisch blank ge-
blieben.
Es unterliegt
also keinem Zwei-
fel, dafs es sich um
eine Arbeitdes viel-
beschäftigten und
bedeutendsten
Augsburger Platt-
ners aus der zwei-
ten Hälfte des
16. Jahrhunderts
handelt. Auch zeit-
lich mufs er wegen
der formalen Iden-
tität in die nächste
Nähe des 1571 da-
tierten Wiener
Stücks fallen.
Hierauf mufs
sich die Bestimmung einstweilen beschränken. Die
von Boeheim veröffentlichten Urkunden bieten
keine weiteren Anhaltspunkte. Auch wird unser
Harnisch kaum, wie ich bei der Lektüre des ge-
nannten Stöckleinschen Aufsatzes
hoffte, einer von jenen „sechs
weifsen Harnischen der Knechte
des St. Georg“ sein, von denen in
dem zitierten Briefe Herzog Al-
brechts V. von Bayern die Rede
ist. Die formalen Abweichungen
unseres Harnischs von dem des Ritter
Abb. 10
Abb. 8 a
geben hierfür wenigstens keinen Anhalt.
Georg
6) Vgl. Boeheim, Hdb. S. 566, Abb. 655.
21
DR. POST, ZEUGHAUS-ERWERBUNGEN SEIT 1912
herausspringendem Sehschlitz und ausladendem
Nacken entspricht schon ganz der geläufigen und
auch im Zeughaus vertretenen Gestalt des deut-
schen Stechhelms in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Indefs dieangesetztenßrust-undRücken-
platten deuten darauf, dafs er jenem früheren
Stadium noch nicht fernsteht, in dem zwischen dem
alten Topfhelm und der Rumpfpanzerung des
Plattenharnisches durch Zwischenglieder eine Ver-
bindung hergestellt wurde. Auch die Schlichtheit
der äufseren Gestalt, die als einzige künstlerische
Belebung drei wuchtige geschmiedete Kehlungen
ganze naive, man “■'"'■»-W
möchte sagen un- Abb. 9
geschlachte Schön-
heit einer aus der Notwendigkeit erwachsenen
Form.
Das Oeuvre Pfeffenhausers, das der vor-
jährigen glücklichen Entdeckung Stöckleins eine
so schöne Bereicherung verdankt5), erhält einen
weiteren Zuwachs durch einen Harnisch, den das
Zeughaus vor zwei Jahren durch Vermittlung eines
Berliner Händlers von einem süddeutschen Edelsitz
erwarb. Die obenstehende Abbildung (Abb. 9) er-
übrigt eine eingehende Beschreibung (In v. Nr. 12. 56,
Gesamtgewicht 26,730 kg). Es handelt sich um ein
typisches Stechzeug für das sogenannte wälsche
5) Stöcklein: Der Harnisch des Ritters Georg.
München, Jahrb. d. bildenden Künste. 1913. 1. Vierteljahrs-
band.
Gestech über das Dill mit Helmverstärkung und
Stechmeusel6), nach dem Schnitt der Brust und dem
herausgetriebenen Helmkamm der zweiten Plälfte
des 16. Jahrhunderts angehörig. Der Harnisch ist in
allen Teilen tadellos erhalten und ohne Ergänzung.
Trotz der schlichten Behandlung liefs die wuch-
tige und sichere Treibarbeit gleich bei der ersten
Besichtigung eine Meisterhand erkennen. Auch
der Name des Meisters war bald gefunden, ob-
gleich ihn keine Marke verriet. Unser Harnisch
stimmt bis ins einzelne mit dem Harnisch der
Wierier Sammlung angeblich des Erzherzogs Fried-
rich überein, dem
einzigen Harnisch,
der die Marke
Anton Pfeffenhau-
sers trägt. Ab-
weichend von der
reichen Atzung des
Wiener Stücks ist
der Zeughaushar-
nisch blank ge-
blieben.
Es unterliegt
also keinem Zwei-
fel, dafs es sich um
eine Arbeitdes viel-
beschäftigten und
bedeutendsten
Augsburger Platt-
ners aus der zwei-
ten Hälfte des
16. Jahrhunderts
handelt. Auch zeit-
lich mufs er wegen
der formalen Iden-
tität in die nächste
Nähe des 1571 da-
tierten Wiener
Stücks fallen.
Hierauf mufs
sich die Bestimmung einstweilen beschränken. Die
von Boeheim veröffentlichten Urkunden bieten
keine weiteren Anhaltspunkte. Auch wird unser
Harnisch kaum, wie ich bei der Lektüre des ge-
nannten Stöckleinschen Aufsatzes
hoffte, einer von jenen „sechs
weifsen Harnischen der Knechte
des St. Georg“ sein, von denen in
dem zitierten Briefe Herzog Al-
brechts V. von Bayern die Rede
ist. Die formalen Abweichungen
unseres Harnischs von dem des Ritter
Abb. 10
Abb. 8 a
geben hierfür wenigstens keinen Anhalt.
Georg
6) Vgl. Boeheim, Hdb. S. 566, Abb. 655.