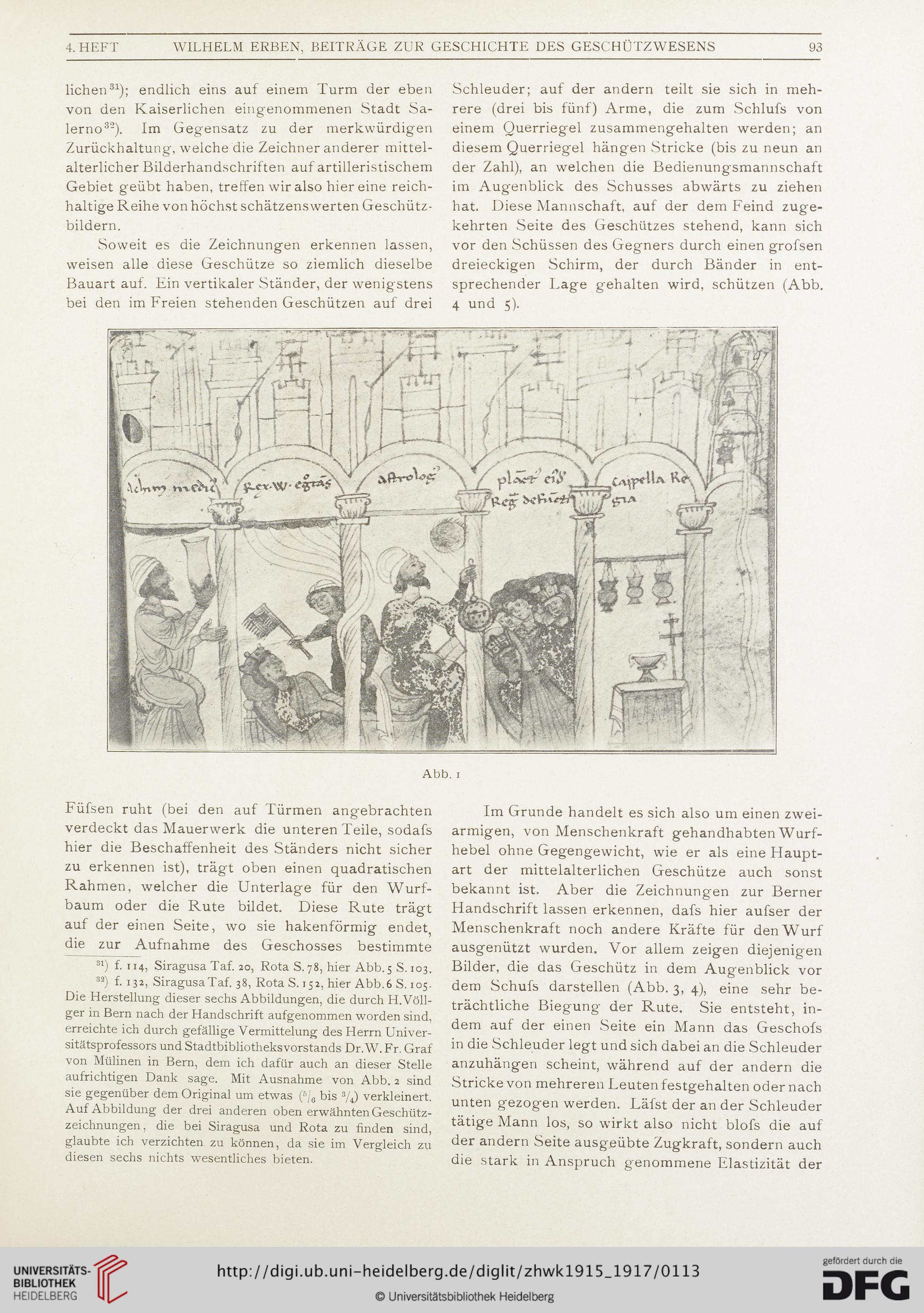4. HEFT
WILHELM ERBEN, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES GESCHÜTZWESENS
93
liehen31); endlich eins auf einem Turm der eben
von den Kaiserlichen eingenommenen Stadt Sa-
lerno32). Im Gegensatz zu der merkwürdigen
Zurückhaltung, welche die Zeichner anderer mittel-
alterlicher Bilderhandschriften auf artilleristischem
Gebiet geübt haben, treffen wir also hier eine reich-
haltige Reihe von höchst schätzenswerten Geschütz-
bildern.
Soweit es die Zeichnungen erkennen lassen,
weisen alle diese Geschütze so ziemlich dieselbe
Bauart auf. Ein vertikaler Ständer, der wenigstens
bei den im Freien stehenden Geschützen auf drei
Schleuder; auf der andern teilt sie sich in meh-
rere (drei bis fünf) Arme, die zum Schlufs von
einem Querriegel zusammengehalten werden; an
diesem Querriegel hängen Stricke (bis zu neun an
der Zahl), an welchen die Bedienungsmannschaft
im Augenblick des Schusses abwärts zu ziehen
hat. Diese Mannschaft, auf der dem Feind zuge-
kehrten Seite des Geschützes stehend, kann sich
vor den Schüssen des Gegners durch einen grofsen
dreieckigen Schirm, der durch Bänder in ent-
sprechender Tage gehalten wird, schützen (Abb.
4 und 5).
Abb. i
Füfsen ruht (bei den auf Türmen angebrachten
verdeckt das Mauerwerk die unteren Teile, sodafs
hier die Beschaffenheit des Ständers nicht sicher
zu erkennen ist), trägt oben einen quadratischen
Rahmen, welcher die Unterlage für den Wurf-
baum oder die Rute bildet. Diese Rute trägt
auf der einen Seite, wo sie hakenförmig endet,
die zur Aufnahme des Geschosses bestimmte
31) f. 114, SiragusaTaf. 20, Rota S. 78, hier Abb. 5 S. 103.
32) f. 132, SiragusaTaf. 38, Rota S. 152, hier Abb.6 S. 105.
Die Herstellung dieser sechs Abbildungen, die durch H.Völl-
ger in Bern nach der Handschrift aufgenommen worden sind,
erreichte ich durch gefällige Vermittelung des Herrn Univer-
sitätsprofessors und Stadtbibliotheksvorstands Dr.W. Fr. Graf
von Mülinen in Bern, dem ich dafür auch an dieser Stelle
aufrichtigen Dank sage. Mit Ausnahme von Abb. 2 sind
sie gegenüber dem Original um etwas (6/0 bis 3/4) verkleinert.
Auf Abbildung der drei anderen oben erwähnten Geschütz-
zeichnungen, die bei Siragusa und Rota zu finden sind,
glaubte ich verzichten zu können, da sie im Vergleich zu
diesen sechs nichts wesentliches bieten.
Im Grunde handelt es sich also um einen zwei-
armigen, von Menschenkraft gehandhabten Wurf-
hebel ohne Gegengewicht, wie er als eine Haupt-
art der mittelalterlichen Geschütze auch sonst
bekannt ist. Aber die Zeichnungen zur Berner
Handschrift lassen erkennen, dafs hier aufser der
Menschenkraft noch andere Kräfte für den Wurf
ausgenützt wurden. Vor allem zeigen diejenigen
Bilder, die das Geschütz in dem Augenblick vor
dem Schufs darstellen (Abb. 3, 4), eine sehr be-
trächtliche Biegung der Rute. Sie entsteht, in-
dem auf der einen Seite ein Mann das Geschofs
in die Schleuder legt und sich dabei an die Schleuder
anzuhängen scheint, während auf der andern die
Stricke von mehreren Leuten festgehalten oder nach
unten gezogen werden. Läfst der an der Schleuder
tätige Mann los, so wirkt also nicht blofs die auf
der andern Seite ausgeübte Zugkraft, sondern auch
die stark in Anspruch genommene Elastizität der
WILHELM ERBEN, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES GESCHÜTZWESENS
93
liehen31); endlich eins auf einem Turm der eben
von den Kaiserlichen eingenommenen Stadt Sa-
lerno32). Im Gegensatz zu der merkwürdigen
Zurückhaltung, welche die Zeichner anderer mittel-
alterlicher Bilderhandschriften auf artilleristischem
Gebiet geübt haben, treffen wir also hier eine reich-
haltige Reihe von höchst schätzenswerten Geschütz-
bildern.
Soweit es die Zeichnungen erkennen lassen,
weisen alle diese Geschütze so ziemlich dieselbe
Bauart auf. Ein vertikaler Ständer, der wenigstens
bei den im Freien stehenden Geschützen auf drei
Schleuder; auf der andern teilt sie sich in meh-
rere (drei bis fünf) Arme, die zum Schlufs von
einem Querriegel zusammengehalten werden; an
diesem Querriegel hängen Stricke (bis zu neun an
der Zahl), an welchen die Bedienungsmannschaft
im Augenblick des Schusses abwärts zu ziehen
hat. Diese Mannschaft, auf der dem Feind zuge-
kehrten Seite des Geschützes stehend, kann sich
vor den Schüssen des Gegners durch einen grofsen
dreieckigen Schirm, der durch Bänder in ent-
sprechender Tage gehalten wird, schützen (Abb.
4 und 5).
Abb. i
Füfsen ruht (bei den auf Türmen angebrachten
verdeckt das Mauerwerk die unteren Teile, sodafs
hier die Beschaffenheit des Ständers nicht sicher
zu erkennen ist), trägt oben einen quadratischen
Rahmen, welcher die Unterlage für den Wurf-
baum oder die Rute bildet. Diese Rute trägt
auf der einen Seite, wo sie hakenförmig endet,
die zur Aufnahme des Geschosses bestimmte
31) f. 114, SiragusaTaf. 20, Rota S. 78, hier Abb. 5 S. 103.
32) f. 132, SiragusaTaf. 38, Rota S. 152, hier Abb.6 S. 105.
Die Herstellung dieser sechs Abbildungen, die durch H.Völl-
ger in Bern nach der Handschrift aufgenommen worden sind,
erreichte ich durch gefällige Vermittelung des Herrn Univer-
sitätsprofessors und Stadtbibliotheksvorstands Dr.W. Fr. Graf
von Mülinen in Bern, dem ich dafür auch an dieser Stelle
aufrichtigen Dank sage. Mit Ausnahme von Abb. 2 sind
sie gegenüber dem Original um etwas (6/0 bis 3/4) verkleinert.
Auf Abbildung der drei anderen oben erwähnten Geschütz-
zeichnungen, die bei Siragusa und Rota zu finden sind,
glaubte ich verzichten zu können, da sie im Vergleich zu
diesen sechs nichts wesentliches bieten.
Im Grunde handelt es sich also um einen zwei-
armigen, von Menschenkraft gehandhabten Wurf-
hebel ohne Gegengewicht, wie er als eine Haupt-
art der mittelalterlichen Geschütze auch sonst
bekannt ist. Aber die Zeichnungen zur Berner
Handschrift lassen erkennen, dafs hier aufser der
Menschenkraft noch andere Kräfte für den Wurf
ausgenützt wurden. Vor allem zeigen diejenigen
Bilder, die das Geschütz in dem Augenblick vor
dem Schufs darstellen (Abb. 3, 4), eine sehr be-
trächtliche Biegung der Rute. Sie entsteht, in-
dem auf der einen Seite ein Mann das Geschofs
in die Schleuder legt und sich dabei an die Schleuder
anzuhängen scheint, während auf der andern die
Stricke von mehreren Leuten festgehalten oder nach
unten gezogen werden. Läfst der an der Schleuder
tätige Mann los, so wirkt also nicht blofs die auf
der andern Seite ausgeübte Zugkraft, sondern auch
die stark in Anspruch genommene Elastizität der