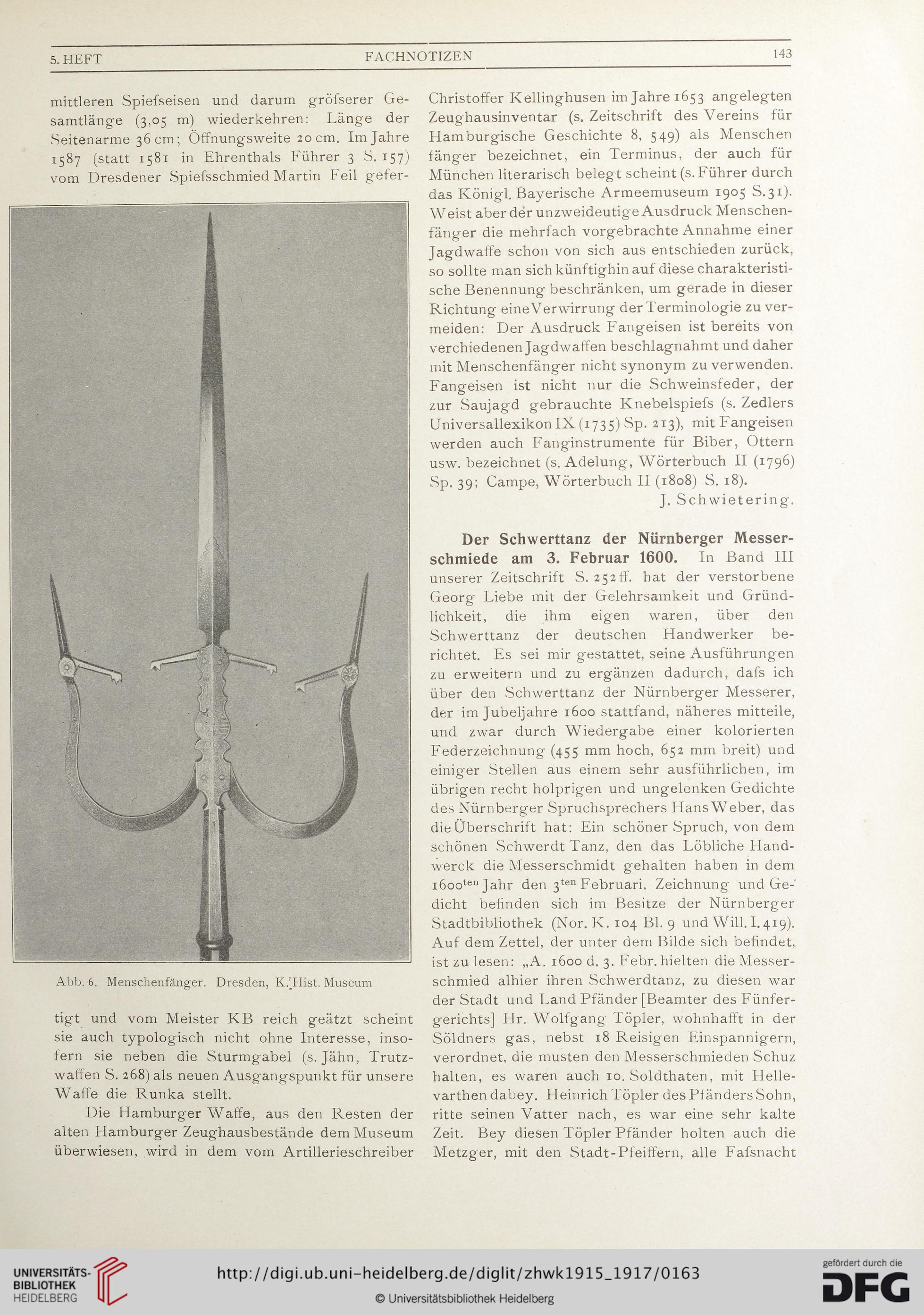5. HEFT
FACHNOTIZEN
143
Christoffer Kellinghusen im Jahre 1653 angelegten
Zeughausinventar (s. Zeitschrift des Vereins für
Hamburgische Geschichte 8, 549) als Menschen
fänger bezeichnet, ein Terminus, der auch für
München literarisch belegt scheint (s. Führer durch
das Königl. Bayerische Armeemuseum 1905 S.31).
Weist aber der unzweideutige Ausdruck Menschen-
fänger die mehrfach vorgebrachte Annahme einer
Jagdwaffe schon von sich aus entschieden zurück,
so sollte man sich künftighin auf diese charakteristi-
sche Benennung beschränken, um gerade in dieser
Richtung eineVer wirrung der Terminologie zu ver-
meiden: Der Ausdruck Fangeisen ist bereits von
verchiedenen Jagdwaffen beschlagnahmt und daher
mit Menschenfänger nicht synonym zu verwenden.
Fangeisen ist nicht nur die Schweinsfeder, der
zur Saujagd gebrauchte Knebelspiefs (s. Zedlers
Universallexikon IX (1735) Sp. 213), mit Fangeisen
werden auch Fanginstrumente für Biber, Ottern
usw. bezeichnet (s. Adelung, Wörterbuch II (1796)
Sp. 39; Campe, Wörterbuch II (1808) S. 18).
J. Schwietering.
Der Schwerttanz der Nürnberger Messer-
schmiede am 3. Februar 1600. In Band III
unserer Zeitschrift S. 252!!. hat der verstorbene
Georg Liebe mit der Gelehrsamkeit und Gründ-
lichkeit, die ihm eigen waren, über den
Schwerttanz der deutschen Handwerker be-
richtet. Es sei mir gestattet, seine Ausführungen
zu erweitern und zu ergänzen dadurch, dafs ich
über den Schwerttanz der Nürnberger Messerer,
der im Jubeljahre 1600 stattfand, näheres mitteile,
und zwar durch Wiedergabe einer kolorierten
Federzeichnung (455 mm hoch, 652 mm breit) und
einiger Stellen aus einem sehr ausführlichen, im
übrigen recht holprigen und ungelenken Gedichte
des Nürnberger Spruchsprechers Hans Weber, das
die Überschrift hat: Ein schöner Spruch, von dem
schönen Schwerdt Tanz, den das Löbliche Hand-
werck die Messerschmidt gehalten haben in dem
i6ootenJahr den 3ten Februari. Zeichnung und Ge-'
dicht befinden sich im Besitze der Nürnberger
Stadtbibliothek (Nor. K. 104 Bl. 9 und Will. 1.419).
Auf dem Zettel, der unter dem Bilde sich befindet,
ist zu lesen: „A. 1600 d. 3. Febr. hielten die Messer-
schmied alhier ihren Schwerdtanz, zu diesen war
der Stadt und Land Pfänder [Beamter des Fünfer-
gerichts] Hr. Wolfgang Töpler, wohnhafft in der
Söldners gas, nebst 18 Reisigen Einspännigem,
verordnet, die musten den Messerschmieden Schuz
halten, es waren auch 10. Soldthaten, mit Helle-
varthen dabey. Heinrich Töpler des PländersSohn,
ritte seinen Vatter nach, es war eine sehr kalte
Zeit. Bey diesen Töpler Pfänder holten auch die
Metzger, mit den Stadt-Pfeiffern, alle Fafsnacht
mittleren Spiefseisen und darum gröfserer Ge-
samtlänge (3,05 m) wiederkehren: Länge der
Seitenarme 36 cm ; Öffnungsweite 20 cm. Im Jahre
1587 (statt 1581 in Ehrenthals Führer 3 S. 157)
vom Dresdener Spiefsschmied Martin Feil gefer-
Abb. 6. Menschenfänger. Dresden, K/Hist. Museum
tigt und vom Meister KB reich geätzt scheint
sie auch typologisch nicht ohne Interesse, inso-
fern sie neben die Sturmgabel (s. Jähn, Trutz-
waffen S. 268) als neuen Ausgangspunkt für unsere
Waffe die Runka stellt.
Die Hamburger Waffe, aus den Resten der
alten Hamburger Zeughausbestände dem Museum
überwiesen, .wird in dem vom Artillerieschreiber
FACHNOTIZEN
143
Christoffer Kellinghusen im Jahre 1653 angelegten
Zeughausinventar (s. Zeitschrift des Vereins für
Hamburgische Geschichte 8, 549) als Menschen
fänger bezeichnet, ein Terminus, der auch für
München literarisch belegt scheint (s. Führer durch
das Königl. Bayerische Armeemuseum 1905 S.31).
Weist aber der unzweideutige Ausdruck Menschen-
fänger die mehrfach vorgebrachte Annahme einer
Jagdwaffe schon von sich aus entschieden zurück,
so sollte man sich künftighin auf diese charakteristi-
sche Benennung beschränken, um gerade in dieser
Richtung eineVer wirrung der Terminologie zu ver-
meiden: Der Ausdruck Fangeisen ist bereits von
verchiedenen Jagdwaffen beschlagnahmt und daher
mit Menschenfänger nicht synonym zu verwenden.
Fangeisen ist nicht nur die Schweinsfeder, der
zur Saujagd gebrauchte Knebelspiefs (s. Zedlers
Universallexikon IX (1735) Sp. 213), mit Fangeisen
werden auch Fanginstrumente für Biber, Ottern
usw. bezeichnet (s. Adelung, Wörterbuch II (1796)
Sp. 39; Campe, Wörterbuch II (1808) S. 18).
J. Schwietering.
Der Schwerttanz der Nürnberger Messer-
schmiede am 3. Februar 1600. In Band III
unserer Zeitschrift S. 252!!. hat der verstorbene
Georg Liebe mit der Gelehrsamkeit und Gründ-
lichkeit, die ihm eigen waren, über den
Schwerttanz der deutschen Handwerker be-
richtet. Es sei mir gestattet, seine Ausführungen
zu erweitern und zu ergänzen dadurch, dafs ich
über den Schwerttanz der Nürnberger Messerer,
der im Jubeljahre 1600 stattfand, näheres mitteile,
und zwar durch Wiedergabe einer kolorierten
Federzeichnung (455 mm hoch, 652 mm breit) und
einiger Stellen aus einem sehr ausführlichen, im
übrigen recht holprigen und ungelenken Gedichte
des Nürnberger Spruchsprechers Hans Weber, das
die Überschrift hat: Ein schöner Spruch, von dem
schönen Schwerdt Tanz, den das Löbliche Hand-
werck die Messerschmidt gehalten haben in dem
i6ootenJahr den 3ten Februari. Zeichnung und Ge-'
dicht befinden sich im Besitze der Nürnberger
Stadtbibliothek (Nor. K. 104 Bl. 9 und Will. 1.419).
Auf dem Zettel, der unter dem Bilde sich befindet,
ist zu lesen: „A. 1600 d. 3. Febr. hielten die Messer-
schmied alhier ihren Schwerdtanz, zu diesen war
der Stadt und Land Pfänder [Beamter des Fünfer-
gerichts] Hr. Wolfgang Töpler, wohnhafft in der
Söldners gas, nebst 18 Reisigen Einspännigem,
verordnet, die musten den Messerschmieden Schuz
halten, es waren auch 10. Soldthaten, mit Helle-
varthen dabey. Heinrich Töpler des PländersSohn,
ritte seinen Vatter nach, es war eine sehr kalte
Zeit. Bey diesen Töpler Pfänder holten auch die
Metzger, mit den Stadt-Pfeiffern, alle Fafsnacht
mittleren Spiefseisen und darum gröfserer Ge-
samtlänge (3,05 m) wiederkehren: Länge der
Seitenarme 36 cm ; Öffnungsweite 20 cm. Im Jahre
1587 (statt 1581 in Ehrenthals Führer 3 S. 157)
vom Dresdener Spiefsschmied Martin Feil gefer-
Abb. 6. Menschenfänger. Dresden, K/Hist. Museum
tigt und vom Meister KB reich geätzt scheint
sie auch typologisch nicht ohne Interesse, inso-
fern sie neben die Sturmgabel (s. Jähn, Trutz-
waffen S. 268) als neuen Ausgangspunkt für unsere
Waffe die Runka stellt.
Die Hamburger Waffe, aus den Resten der
alten Hamburger Zeughausbestände dem Museum
überwiesen, .wird in dem vom Artillerieschreiber