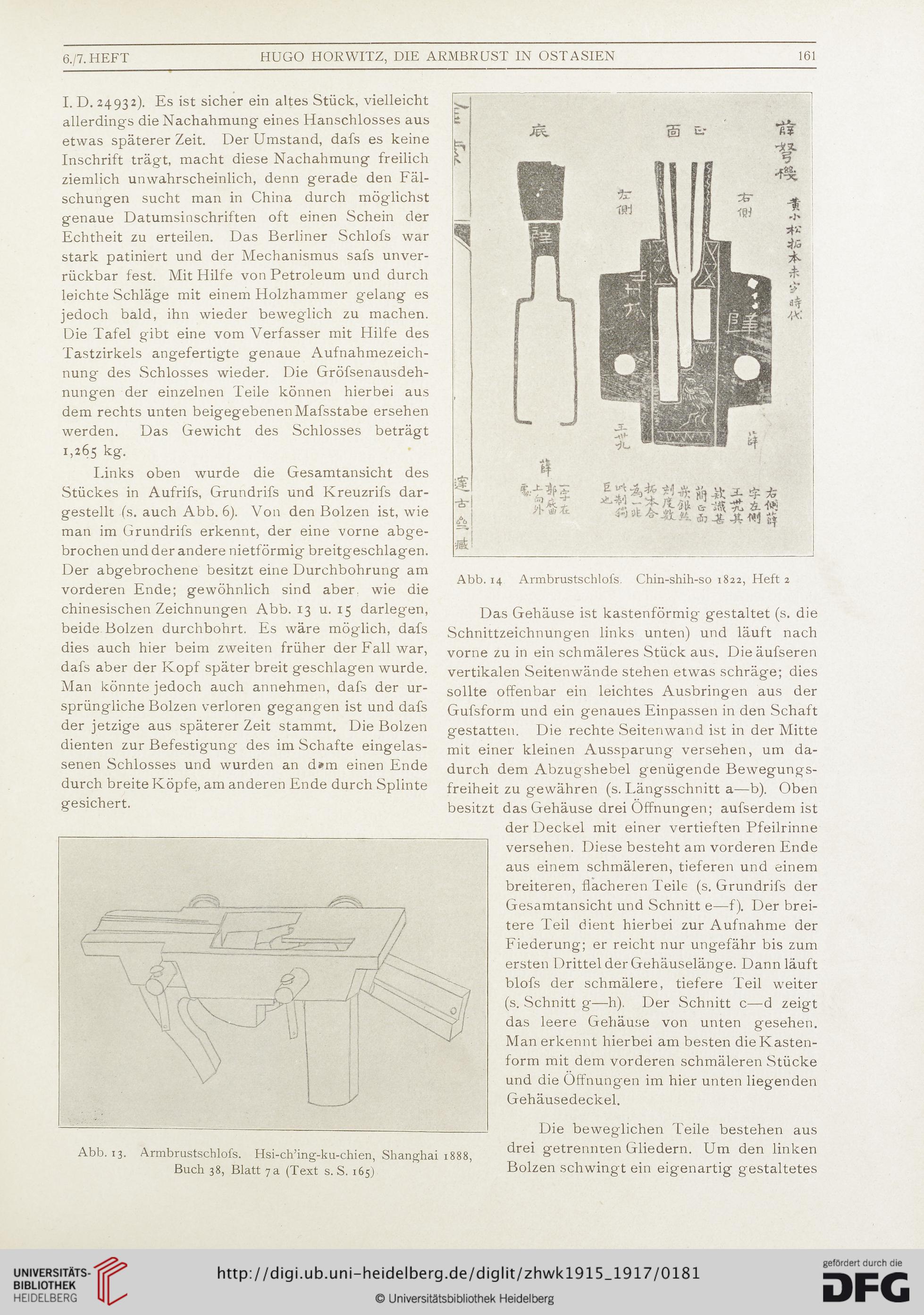6./7.HEFT
HUGO HÖR WITZ, DIE ARMBRUST IN OST ASIEN
161
I. D. 24932). Es ist sicher ein altes Stück, vielleicht
allerdings die Nachahmung eines Hanschlosses aus
etwas späterer Zeit. Der Umstand, dafs es keine
Inschrift trägt, macht diese Nachahmung freilich
ziemlich unwahrscheinlich, denn gerade den Fäl-
schungen sucht man in China durch möglichst
genaue Datumsinschriften oft einen Schein der
Echtheit zu erteilen. Das Berliner Schlofs war
stark patiniert und der Mechanismus safs unver-
rückbar fest. Mit Hilfe von Petroleum und durch
leichte Schläge mit einem Holzhammer gelang es
jedoch bald, ihn wieder beweglich zu machen.
Die Tafel gibt eine vom Verfasser mit Hilfe des
Tastzirkels angefertigte genaue Aufnahmezeich-
nung des Schlosses wieder. Die Gröfsenausdeh-
nungen der einzelnen Teile können hierbei aus
dem rechts unten beigegebenenMafsstabe ersehen
werden. Das Gewicht des Schlosses beträgt
1,265 kg.
Links oben wurde die Gesamtansicht des
Stückes in Aufrifs, Grundrifs und Kreuzrifs dar-
gestellt (s. auch Abb. 6). Von den Bolzen ist, wie
man im Grundrifs erkennt, der eine vorne abge-
brochen und der andere nietförmig breitgeschlagen.
Der abgebrochene besitzt eine Durchbohrung am
vorderen Ende; gewöhnlich sind aber wie die
chinesischen Zeichnungen Abb. 13 u. 15 darlegen,
beide Bolzen durchbohrt. Es wäre möglich, dafs
dies auch hier beim zweiten früher der Fall war,
dafs aber der Kopf später breit geschlagen wurde.
Man könnte jedoch auch annehmen, dafs der ur-
sprüngliche Bolzen verloren gegangen ist und dafs
der jetzige aus späterer Zeit stammt. Die Bolzen
dienten zur Befestigung des im Schafte eingelas-
senen Schlosses und wurden an d*m einen Ende
durch breite Köpfe, am anderen Ende durch Splinte
gesichert.
-V) T £-4Htt äj 4; V «4
Abb. 13. Armbrustschlofs. Hsi-chüng-ku-chien, Shanghai ll
Buch 38, Blatt 7a (Text s. S. 165)
Abb. 14 Armbrustschlofs. Chin-shih-so 1822, Heft 2
Das Gehäuse ist kastenförmig gestaltet (s. die
Schnittzeichnungen links unten) und läuft nach
vorne zu in ein schmäleres Stück aus. Dieäufseren
vertikalen Seitenwände stehen etwas schräge; dies
sollte offenbar ein leichtes Ausbringen aus der
Gufsform und ein genaues Einpassen in den Schaft
gestatten. Die rechte Seitenwand ist in der Mitte
mit einer kleinen Aussparung versehen, um da-
durch dem Abzugshebel genügende Bewegungs-
freiheit zu gewähren (s. Längsschnitt a—b). Oben
besitzt das Gehäuse drei Öffnungen; aufserdem ist
der Deckel mit einer vertieften Pfeilrinne
versehen. Diese besteht am vorderen Ende
aus einem schmäleren, tieferen und einem
breiteren, flacheren Teile (s. Grundrifs der
Gesamtansicht und Schnitt e—f). Der brei-
tere Teil dient hierbei zur Aufnahme der
Fiederung; er reicht nur ungefähr bis zum
ersten Drittel der Gehäuselänge. Dann läuft
blofs der schmälere, tiefere Teil weiter
(s. Schnitt g—h). Der Schnitt c—d zeigt
das leere Gehäuse von unten gesehen.
Man erkennt hierbei am besten die K asten-
form mit dem vorderen schmäleren Stücke
und die Öffnungen im hier unten liegenden
Gehäusedeckel.
Die beweglichen Teile bestehen aus
drei getrennten Gliedern. Um den linken
Bolzen schwingt ein eigenartig gestaltetes
HUGO HÖR WITZ, DIE ARMBRUST IN OST ASIEN
161
I. D. 24932). Es ist sicher ein altes Stück, vielleicht
allerdings die Nachahmung eines Hanschlosses aus
etwas späterer Zeit. Der Umstand, dafs es keine
Inschrift trägt, macht diese Nachahmung freilich
ziemlich unwahrscheinlich, denn gerade den Fäl-
schungen sucht man in China durch möglichst
genaue Datumsinschriften oft einen Schein der
Echtheit zu erteilen. Das Berliner Schlofs war
stark patiniert und der Mechanismus safs unver-
rückbar fest. Mit Hilfe von Petroleum und durch
leichte Schläge mit einem Holzhammer gelang es
jedoch bald, ihn wieder beweglich zu machen.
Die Tafel gibt eine vom Verfasser mit Hilfe des
Tastzirkels angefertigte genaue Aufnahmezeich-
nung des Schlosses wieder. Die Gröfsenausdeh-
nungen der einzelnen Teile können hierbei aus
dem rechts unten beigegebenenMafsstabe ersehen
werden. Das Gewicht des Schlosses beträgt
1,265 kg.
Links oben wurde die Gesamtansicht des
Stückes in Aufrifs, Grundrifs und Kreuzrifs dar-
gestellt (s. auch Abb. 6). Von den Bolzen ist, wie
man im Grundrifs erkennt, der eine vorne abge-
brochen und der andere nietförmig breitgeschlagen.
Der abgebrochene besitzt eine Durchbohrung am
vorderen Ende; gewöhnlich sind aber wie die
chinesischen Zeichnungen Abb. 13 u. 15 darlegen,
beide Bolzen durchbohrt. Es wäre möglich, dafs
dies auch hier beim zweiten früher der Fall war,
dafs aber der Kopf später breit geschlagen wurde.
Man könnte jedoch auch annehmen, dafs der ur-
sprüngliche Bolzen verloren gegangen ist und dafs
der jetzige aus späterer Zeit stammt. Die Bolzen
dienten zur Befestigung des im Schafte eingelas-
senen Schlosses und wurden an d*m einen Ende
durch breite Köpfe, am anderen Ende durch Splinte
gesichert.
-V) T £-4Htt äj 4; V «4
Abb. 13. Armbrustschlofs. Hsi-chüng-ku-chien, Shanghai ll
Buch 38, Blatt 7a (Text s. S. 165)
Abb. 14 Armbrustschlofs. Chin-shih-so 1822, Heft 2
Das Gehäuse ist kastenförmig gestaltet (s. die
Schnittzeichnungen links unten) und läuft nach
vorne zu in ein schmäleres Stück aus. Dieäufseren
vertikalen Seitenwände stehen etwas schräge; dies
sollte offenbar ein leichtes Ausbringen aus der
Gufsform und ein genaues Einpassen in den Schaft
gestatten. Die rechte Seitenwand ist in der Mitte
mit einer kleinen Aussparung versehen, um da-
durch dem Abzugshebel genügende Bewegungs-
freiheit zu gewähren (s. Längsschnitt a—b). Oben
besitzt das Gehäuse drei Öffnungen; aufserdem ist
der Deckel mit einer vertieften Pfeilrinne
versehen. Diese besteht am vorderen Ende
aus einem schmäleren, tieferen und einem
breiteren, flacheren Teile (s. Grundrifs der
Gesamtansicht und Schnitt e—f). Der brei-
tere Teil dient hierbei zur Aufnahme der
Fiederung; er reicht nur ungefähr bis zum
ersten Drittel der Gehäuselänge. Dann läuft
blofs der schmälere, tiefere Teil weiter
(s. Schnitt g—h). Der Schnitt c—d zeigt
das leere Gehäuse von unten gesehen.
Man erkennt hierbei am besten die K asten-
form mit dem vorderen schmäleren Stücke
und die Öffnungen im hier unten liegenden
Gehäusedeckel.
Die beweglichen Teile bestehen aus
drei getrennten Gliedern. Um den linken
Bolzen schwingt ein eigenartig gestaltetes