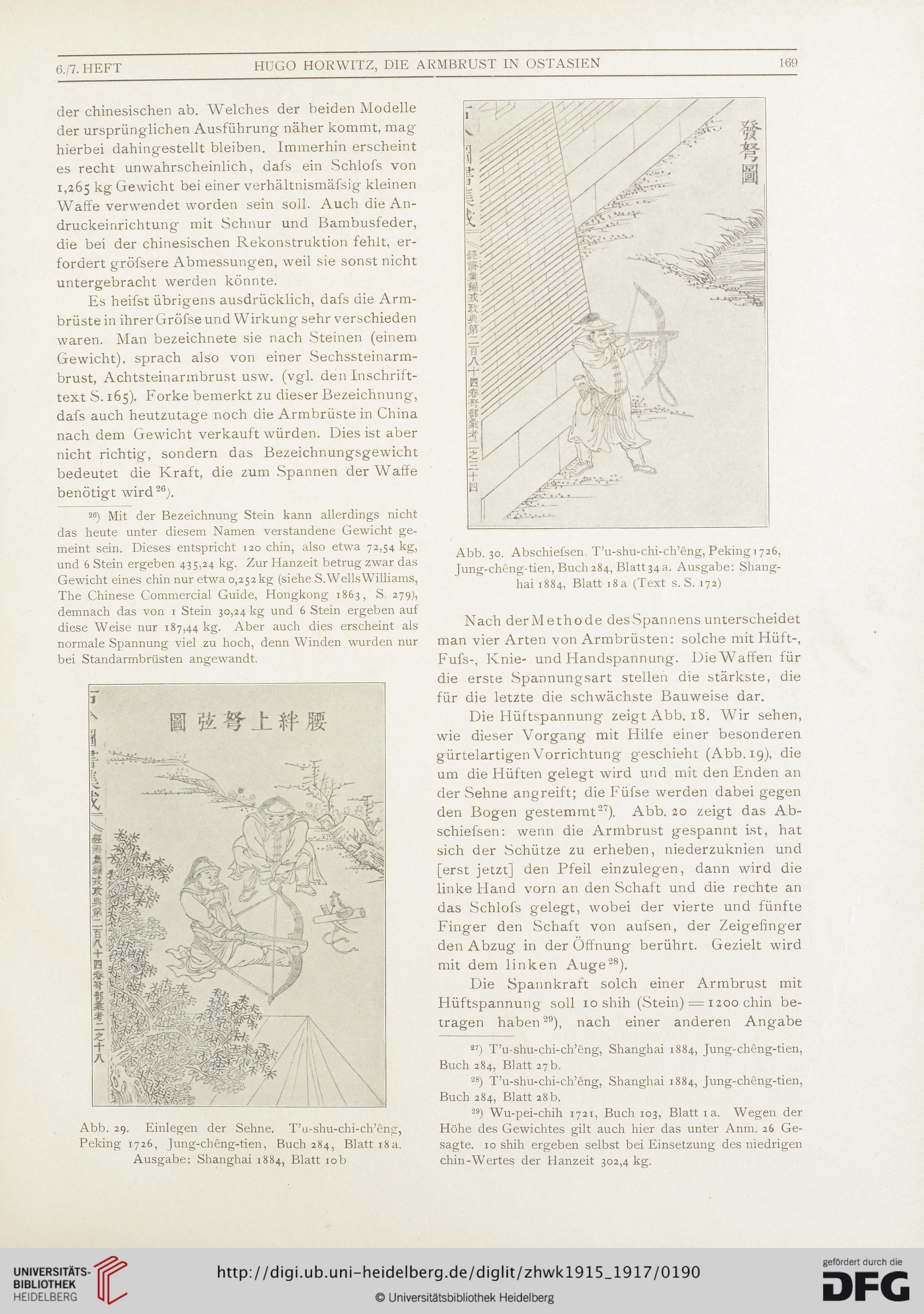6./7. HEFT
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
169
der chinesischen ab. Welches der beiden Modelle
der ursprünglichen Ausführung näher kommt, mag
hierbei dahingestellt bleiben. Immerhin erscheint
es recht unwahrscheinlich, dafs ein Schlofs von
1,265 kg Gewicht bei einer verhältnismäfsig kleinen
Waffe verwendet worden sein soll. Auch die An-
druckeinrichtung mit Schnur und Bambusfeder,
die bei der chinesischen Rekonstruktion fehlt, er-
fordert gröfsere Abmessungen, weil sie sonst nicht
untergebracht werden könnte.
Es heifst übrigens ausdrücklich, dafs die Arm-
brüste in ihrer Gröfse und Wirkung sehr verschieden
waren. Man bezeichnete sie nach Steinen (einem
Gewicht), sprach also von einer Sechssteinarm-
brust, Achtsteinarmbrust usw. (vgl. den Inschrift-
text S. 165). Forke bemerkt zu dieser Bezeichnung,
dafs auch heutzutage noch die Armbrüste in China
nach dem Gewicht verkauft würden. Dies ist aber
nicht richtig, sondern das Bezeichnungsgewicht
bedeutet die Kraft, die zum Spannen der Waffe
benötigt wird26).
26) Mit der Bezeichnung Stein kann allerdings nicht
das heute unter diesem Namen verstandene Gewicht ge-
meint sein. Dieses entspricht 120 chin, also etwa 72,54 kg,
und 6 Stein ergeben 435,24 kg. Zur Hanzeit betrug zwar das
Gewicht eines chin nur etwa 0,252kg (siehe S. Wells Williams,
The Chinese Commercial Guide, Hongkong 1863, S. 279),
demnach das von 1 Stein 30,24 kg und 6 Stein ergeben auf
diese Weise nur 187,44 kg. Aber auch dies erscheint als
normale Spannung viel zu hoch, denn Winden wurden nur
bei Standarmbrüsten angewandt.
Abb. 29. Einlegen der Sehne. T’u-shu-chi-ch’eng,
Peking 1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 18a.
Ausgabe: Shanghai 1884, Blatt 10b
Abb. 30. Abschiefsen. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking 1726,
Jung-cheng-tien, BUCI1284, Blatt34a. Ausgabe: Shang-
hai 1884, Blatt 18a (Text s. S. 172)
Nach derMethode desSpannens unterscheidet
man vier Arten von Armbrüsten: solche mit Hüft-,
Fufs-, Knie- und Handspannung. Die Waffen für
die erste Spannungsart stellen die stärkste, die
für die letzte die schwächste Bauweise dar.
Die Hüftspannung zeigt Abb. 18. Wir sehen,
wie dieser Vorgang mit Hilfe einer besonderen
gürtelartigen Vorrichtung geschieht (Abb. 19), die
um die Hüften gelegt wird und mit den Enden an
der Sehne angreift; die Füfse werden dabei gegen
den Bogen gestemmt27). Abb. 20 zeigt das Ab-
schiefsen: wenn die Armbrust gespannt ist, hat
sich der Schütze zu erheben, niederzuknien und
[erst jetzt] den Pfeil einzulegen, dann wird die
linke Bland vorn an den Schaft und die rechte an
das Schlofs gelegt, wobei der vierte und fünfte
Finger den Schaft von aufsen, der Zeigefinger
den Abzug in der Öffnung berührt. Gezielt wird
mit dem linken Auge28).
Die Spannkraft solch einer Armbrust mit
Hüftspannung soll 10 shih (Stein) = 1200 chin be-
tragen haben29), nach einer anderen Angabe
27) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 284, Blatt 27b.
28) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 284, Blatt 28b.
29) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 1 a. Wegen der
Höhe des Gewichtes gilt auch hier das unter Anm. 26 Ge-
sagte. 10 shih ergeben selbst bei Einsetzung des niedrigen
chin-Wertes der Hanzeit 302,4 kg.
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
169
der chinesischen ab. Welches der beiden Modelle
der ursprünglichen Ausführung näher kommt, mag
hierbei dahingestellt bleiben. Immerhin erscheint
es recht unwahrscheinlich, dafs ein Schlofs von
1,265 kg Gewicht bei einer verhältnismäfsig kleinen
Waffe verwendet worden sein soll. Auch die An-
druckeinrichtung mit Schnur und Bambusfeder,
die bei der chinesischen Rekonstruktion fehlt, er-
fordert gröfsere Abmessungen, weil sie sonst nicht
untergebracht werden könnte.
Es heifst übrigens ausdrücklich, dafs die Arm-
brüste in ihrer Gröfse und Wirkung sehr verschieden
waren. Man bezeichnete sie nach Steinen (einem
Gewicht), sprach also von einer Sechssteinarm-
brust, Achtsteinarmbrust usw. (vgl. den Inschrift-
text S. 165). Forke bemerkt zu dieser Bezeichnung,
dafs auch heutzutage noch die Armbrüste in China
nach dem Gewicht verkauft würden. Dies ist aber
nicht richtig, sondern das Bezeichnungsgewicht
bedeutet die Kraft, die zum Spannen der Waffe
benötigt wird26).
26) Mit der Bezeichnung Stein kann allerdings nicht
das heute unter diesem Namen verstandene Gewicht ge-
meint sein. Dieses entspricht 120 chin, also etwa 72,54 kg,
und 6 Stein ergeben 435,24 kg. Zur Hanzeit betrug zwar das
Gewicht eines chin nur etwa 0,252kg (siehe S. Wells Williams,
The Chinese Commercial Guide, Hongkong 1863, S. 279),
demnach das von 1 Stein 30,24 kg und 6 Stein ergeben auf
diese Weise nur 187,44 kg. Aber auch dies erscheint als
normale Spannung viel zu hoch, denn Winden wurden nur
bei Standarmbrüsten angewandt.
Abb. 29. Einlegen der Sehne. T’u-shu-chi-ch’eng,
Peking 1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 18a.
Ausgabe: Shanghai 1884, Blatt 10b
Abb. 30. Abschiefsen. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking 1726,
Jung-cheng-tien, BUCI1284, Blatt34a. Ausgabe: Shang-
hai 1884, Blatt 18a (Text s. S. 172)
Nach derMethode desSpannens unterscheidet
man vier Arten von Armbrüsten: solche mit Hüft-,
Fufs-, Knie- und Handspannung. Die Waffen für
die erste Spannungsart stellen die stärkste, die
für die letzte die schwächste Bauweise dar.
Die Hüftspannung zeigt Abb. 18. Wir sehen,
wie dieser Vorgang mit Hilfe einer besonderen
gürtelartigen Vorrichtung geschieht (Abb. 19), die
um die Hüften gelegt wird und mit den Enden an
der Sehne angreift; die Füfse werden dabei gegen
den Bogen gestemmt27). Abb. 20 zeigt das Ab-
schiefsen: wenn die Armbrust gespannt ist, hat
sich der Schütze zu erheben, niederzuknien und
[erst jetzt] den Pfeil einzulegen, dann wird die
linke Bland vorn an den Schaft und die rechte an
das Schlofs gelegt, wobei der vierte und fünfte
Finger den Schaft von aufsen, der Zeigefinger
den Abzug in der Öffnung berührt. Gezielt wird
mit dem linken Auge28).
Die Spannkraft solch einer Armbrust mit
Hüftspannung soll 10 shih (Stein) = 1200 chin be-
tragen haben29), nach einer anderen Angabe
27) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 284, Blatt 27b.
28) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 284, Blatt 28b.
29) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 1 a. Wegen der
Höhe des Gewichtes gilt auch hier das unter Anm. 26 Ge-
sagte. 10 shih ergeben selbst bei Einsetzung des niedrigen
chin-Wertes der Hanzeit 302,4 kg.