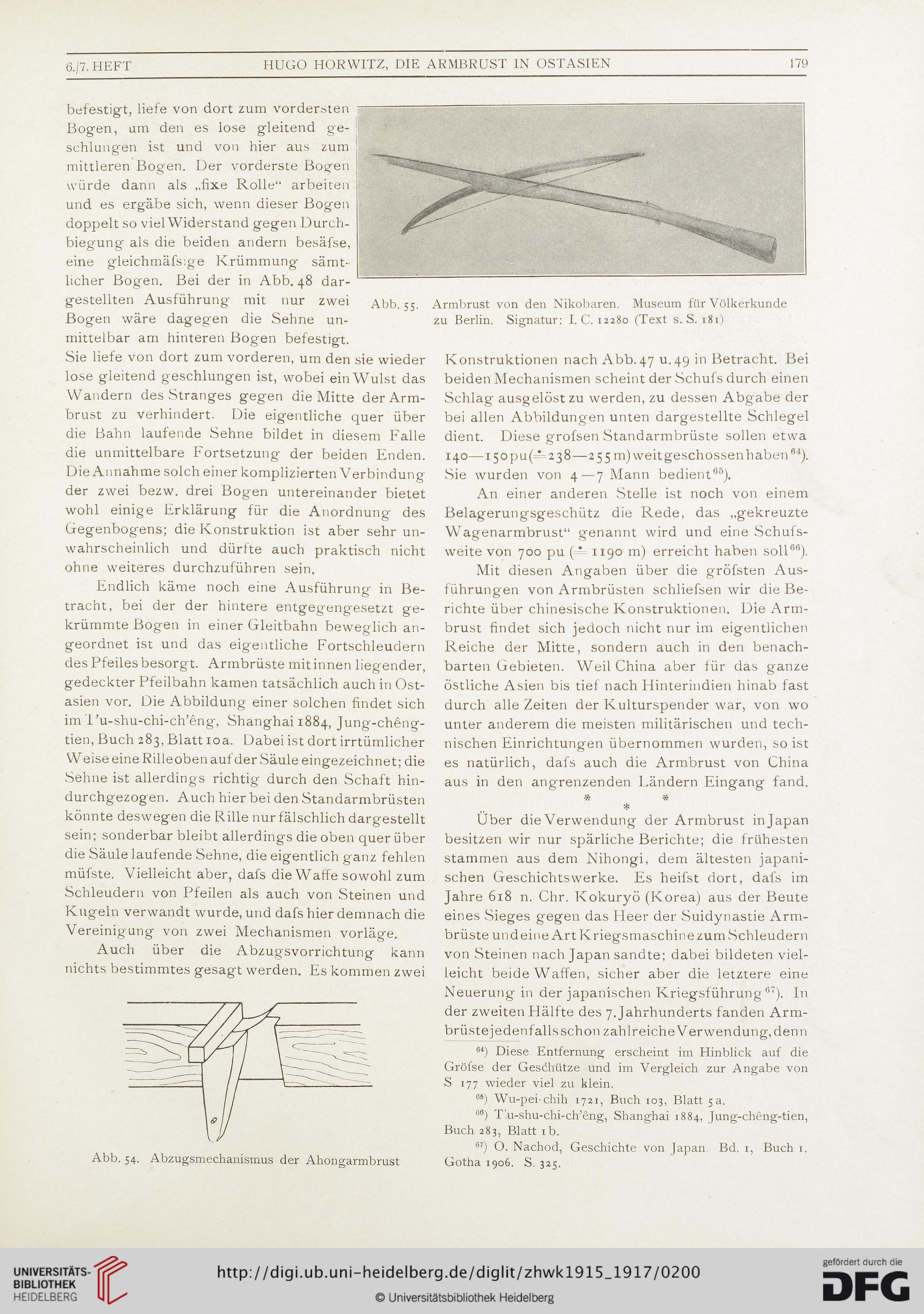6./7. HEFT
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
179
Abb. 55. Armbrust von den Nikobaren. Museum für Völkerkunde
zu Berlin. Signatur: I. C. 12280 (Text s. S. 181)
befestigt, liefe von dort zum vordersten
Bogen, um den es lose gleitend ge-
schlungen ist und von hier aus zum
mittleren Bogen. Der vorderste Bogen
würde dann als „fixe Rolle“ arbeiten
und es ergäbe sich, wenn dieser Bogen
doppelt so viel Widerstand gegen Durch-
biegung- als die beiden andern besäfse,
eine gleichmäfsige Krümmung- sämt-
licher Bogen. Bei der in Abb. 48 dar-
gestellten Ausführung mit nur zwei
Bogen wäre dagegen die Sehne un-
mittelbar am hinteren Bogen befestigt.
Sie liefe von dort zum vorderen, um den sie wieder
lose gleitend geschlungen ist, wobei ein Wulst das
Wandern des Stranges gegen die Mitte der Arm-
brust zu verhindert. Die eigentliche quer über
die Bahn laufende Sehne bildet in diesem Falle
die unmittelbare Fortsetzung der beiden Enden.
Die Annahme solch einer komplizierten Verbindung
der zwei bezw. drei Bogen untereinander bietet
wohl einige Erklärung für die Anordnung des
Gegenbogens; die Konstruktion ist aber sehr un-
wahrscheinlich und dürfte auch praktisch nicht
ohne weiteres durchzuführen sein.
Endlich käme noch eine Ausführung in Be-
tracht, bei der der hintere entgegengesetzt ge-
krümmte Bogen in einer Gleitbahn beweglich an-
geordnet ist und das eigentliche Fortschleudern
des Pfeiles besorgt. Armbrüste mit innen liegender,
gedeckter Pfeilbahn kamen tatsächlich auch in Ost-
asien vor. Die Abbildung einer solchen findet sich
im T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-
tien, Buch 283, Blatt 10a. Dabei ist dort irrtümlicher
W eise eine Rilleoben auf der Säule eingezeichnet; die
Sehne ist allerdings richtig durch den Schaft hin-
durchgezogen. Auch hier bei den Standarmbrüsten
könnte deswegen die Rille nur fälschlich dargestellt
sein; sonderbar bleibt allerdings die oben quer über
die Säule laufende Sehne, die eigentlich ganz fehlen
müfste. Vielleicht aber, dafs die Waffe sowohl zum
Schleudern von Pfeilen als auch von Steinen und
Kugeln verwandt wurde, und dafs hier demnach die
Vereinigung von zwei Mechanismen vorläge.
Auch über die Abzugsvorrichtung kann
nichts bestimmtes gesagt werden. Es kommen zwei
Abb. 54. Abzugsmechanismus der Ahongarmbrust
Konstruktionen nach Abb. 47 u.49 in Betracht. Bei
beiden Mechanismen scheint der Schufs durch einen
Schlag ausgelöstzu werden, zu dessen Abgabe der
bei allen Abbildungen unten dargestellte Schlegel
dient. Diese g-rofsen Standarmbrüste sollen etwa
140—i5opu(=2 38—255 m) weit geschossen haben64).
Sie wurden von 4—7 Mann bedient65).
An einer anderen Stelle ist noch von einem
Belagerungsgeschütz die Rede, das „gekreuzte
Wagenarmbrust“ genannt wird und eine Schufs-
weite von 700 pu (= 1190 m) erreicht haben soll66).
Mit diesen Angaben über die gröfsten Aus-
führungen von Armbrüsten schliefsen wir die Be-
richte über chinesische Konstruktionen. Die Arm-
brust findet sich jedoch nicht nur im eigentlichen
Reiche der Mitte, sondern auch in den benach-
barten Gebieten. Weil China aber für das ganze
östliche Asien bis tief nach Hinterindien hinab fast
durch alle Zeiten der Kulturspender war, von wo
unter anderem die meisten militärischen und tech-
nischen Einrichtungen übernommen wurden, so ist
es natürlich, dafs auch die Armbrust von China
aus in den angrenzenden Bändern Eingang fand.
* *
*
Über die Verwendung der Armbrust in Japan
besitzen wir nur spärliche Berichte; die frühesten
stammen aus dem Nihongi, dem ältesten japani-
schen Geschiehtswerke. Es heifst dort, dafs im
Jahre 618 n. Chr. Kokuryö (Korea) aus der Beute
eines Sieges gegen das Heer der Suidynastie Arm-
brüste und eine Art Kriegsmaschine zum Schleudern
von Steinen nach Japan sandte; dabei bildeten viel-
leicht beide Waffen, sicher aber die letztere eine
Neuerung in der japanischen Kriegsführung67). In
der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fanden Arm-
brüste jedenfalls schon zahlreiche Verwendung, denn
64) Diese Entfernung erscheint im Hinblick auf die
Gröfse der Geschütze und im Vergleich zur Angabe von
S 177 wieder viel zu klein.
66) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 5a.
66) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 283, Blatt 1 b.
B7) O. Nachod, Geschichte von Japan. Bd. 1, Buch 1.
Gotha 1906. S. 325.
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
179
Abb. 55. Armbrust von den Nikobaren. Museum für Völkerkunde
zu Berlin. Signatur: I. C. 12280 (Text s. S. 181)
befestigt, liefe von dort zum vordersten
Bogen, um den es lose gleitend ge-
schlungen ist und von hier aus zum
mittleren Bogen. Der vorderste Bogen
würde dann als „fixe Rolle“ arbeiten
und es ergäbe sich, wenn dieser Bogen
doppelt so viel Widerstand gegen Durch-
biegung- als die beiden andern besäfse,
eine gleichmäfsige Krümmung- sämt-
licher Bogen. Bei der in Abb. 48 dar-
gestellten Ausführung mit nur zwei
Bogen wäre dagegen die Sehne un-
mittelbar am hinteren Bogen befestigt.
Sie liefe von dort zum vorderen, um den sie wieder
lose gleitend geschlungen ist, wobei ein Wulst das
Wandern des Stranges gegen die Mitte der Arm-
brust zu verhindert. Die eigentliche quer über
die Bahn laufende Sehne bildet in diesem Falle
die unmittelbare Fortsetzung der beiden Enden.
Die Annahme solch einer komplizierten Verbindung
der zwei bezw. drei Bogen untereinander bietet
wohl einige Erklärung für die Anordnung des
Gegenbogens; die Konstruktion ist aber sehr un-
wahrscheinlich und dürfte auch praktisch nicht
ohne weiteres durchzuführen sein.
Endlich käme noch eine Ausführung in Be-
tracht, bei der der hintere entgegengesetzt ge-
krümmte Bogen in einer Gleitbahn beweglich an-
geordnet ist und das eigentliche Fortschleudern
des Pfeiles besorgt. Armbrüste mit innen liegender,
gedeckter Pfeilbahn kamen tatsächlich auch in Ost-
asien vor. Die Abbildung einer solchen findet sich
im T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-
tien, Buch 283, Blatt 10a. Dabei ist dort irrtümlicher
W eise eine Rilleoben auf der Säule eingezeichnet; die
Sehne ist allerdings richtig durch den Schaft hin-
durchgezogen. Auch hier bei den Standarmbrüsten
könnte deswegen die Rille nur fälschlich dargestellt
sein; sonderbar bleibt allerdings die oben quer über
die Säule laufende Sehne, die eigentlich ganz fehlen
müfste. Vielleicht aber, dafs die Waffe sowohl zum
Schleudern von Pfeilen als auch von Steinen und
Kugeln verwandt wurde, und dafs hier demnach die
Vereinigung von zwei Mechanismen vorläge.
Auch über die Abzugsvorrichtung kann
nichts bestimmtes gesagt werden. Es kommen zwei
Abb. 54. Abzugsmechanismus der Ahongarmbrust
Konstruktionen nach Abb. 47 u.49 in Betracht. Bei
beiden Mechanismen scheint der Schufs durch einen
Schlag ausgelöstzu werden, zu dessen Abgabe der
bei allen Abbildungen unten dargestellte Schlegel
dient. Diese g-rofsen Standarmbrüste sollen etwa
140—i5opu(=2 38—255 m) weit geschossen haben64).
Sie wurden von 4—7 Mann bedient65).
An einer anderen Stelle ist noch von einem
Belagerungsgeschütz die Rede, das „gekreuzte
Wagenarmbrust“ genannt wird und eine Schufs-
weite von 700 pu (= 1190 m) erreicht haben soll66).
Mit diesen Angaben über die gröfsten Aus-
führungen von Armbrüsten schliefsen wir die Be-
richte über chinesische Konstruktionen. Die Arm-
brust findet sich jedoch nicht nur im eigentlichen
Reiche der Mitte, sondern auch in den benach-
barten Gebieten. Weil China aber für das ganze
östliche Asien bis tief nach Hinterindien hinab fast
durch alle Zeiten der Kulturspender war, von wo
unter anderem die meisten militärischen und tech-
nischen Einrichtungen übernommen wurden, so ist
es natürlich, dafs auch die Armbrust von China
aus in den angrenzenden Bändern Eingang fand.
* *
*
Über die Verwendung der Armbrust in Japan
besitzen wir nur spärliche Berichte; die frühesten
stammen aus dem Nihongi, dem ältesten japani-
schen Geschiehtswerke. Es heifst dort, dafs im
Jahre 618 n. Chr. Kokuryö (Korea) aus der Beute
eines Sieges gegen das Heer der Suidynastie Arm-
brüste und eine Art Kriegsmaschine zum Schleudern
von Steinen nach Japan sandte; dabei bildeten viel-
leicht beide Waffen, sicher aber die letztere eine
Neuerung in der japanischen Kriegsführung67). In
der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fanden Arm-
brüste jedenfalls schon zahlreiche Verwendung, denn
64) Diese Entfernung erscheint im Hinblick auf die
Gröfse der Geschütze und im Vergleich zur Angabe von
S 177 wieder viel zu klein.
66) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 5a.
66) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,
Buch 283, Blatt 1 b.
B7) O. Nachod, Geschichte von Japan. Bd. 1, Buch 1.
Gotha 1906. S. 325.