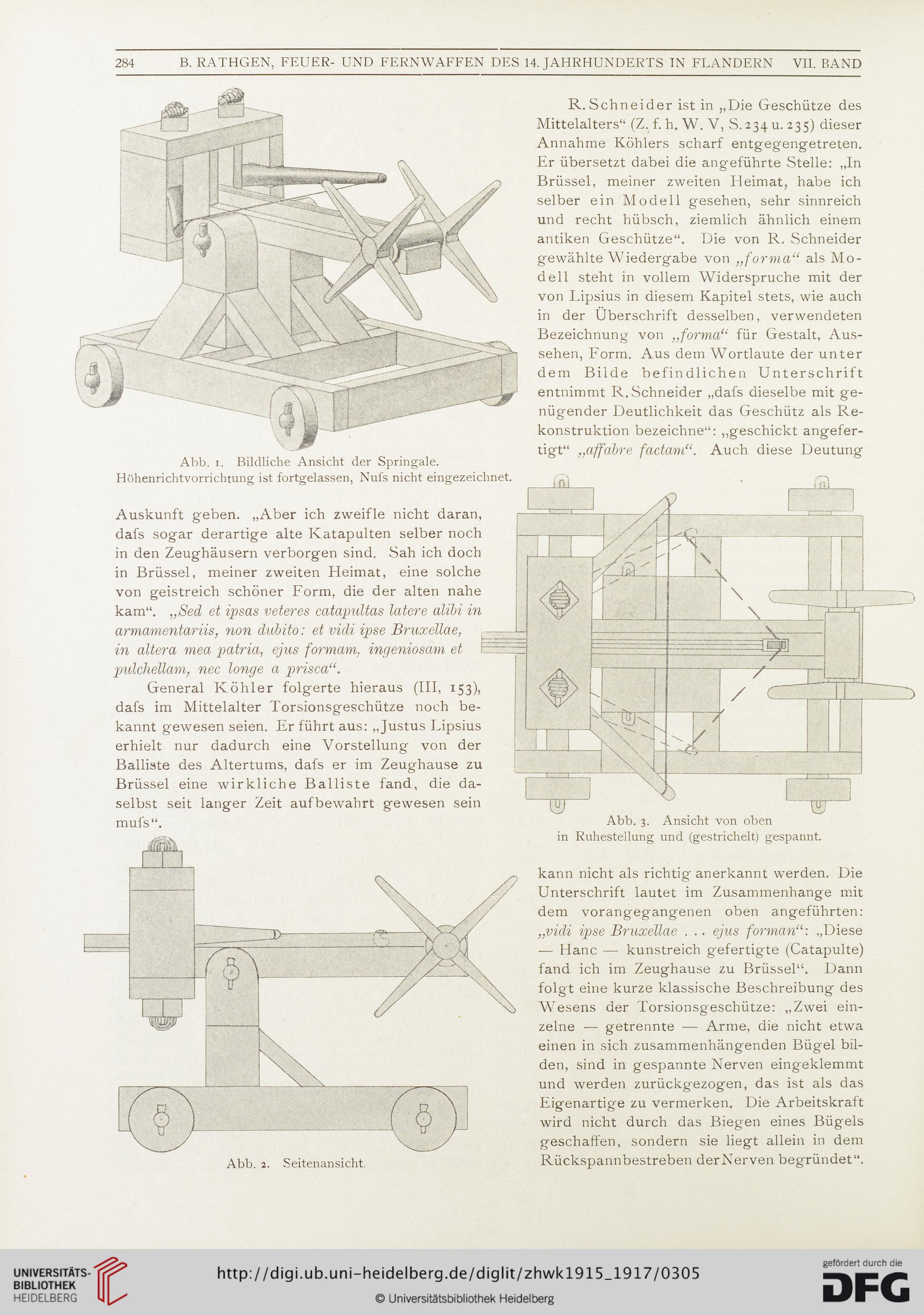284
B. RATHGEN, FEUER- UND FERNWAFFEN DES 14. JAHRHUNDERTS IN FLANDERN VII. BAND
Abb. i. Bildliche Ansicht der Springale.
Höhenrichtvorrichtung ist fortgelassen, Nufs nicht eingezeichnet.
Auskunft geben. „Aber ich zweifle nicht daran,
dafs sogar derartige alte Katapulten selber noch
in den Zeughäusern verborgen sind. Sah ich doch
in Brüssel, meiner zweiten Heimat, eine solche
von geistreich schöner Form, die der alten nahe
kam“. „Sed et ipsas veteres catapultas latere alibi in
armamentariis, non dubito: et vidi ipse Bruxellae,
in altera mea patria, ejus formam, ingeniosam et krrz
pulcliellam, nee longe a prisca“.
General Köhler folgerte hieraus (III, 153),
dafs im Mittelalter Torsionsgeschütze noch be-
kannt gewesen seien. Er führt aus: „Justus Lipsius
erhielt nur dadurch eine Vorstellung von der
Balliste des Altertums, dafs er im Zeughause zu
Brüssel eine wirkliche Balliste fand, die da-
selbst seit langer Zeit aufbewahrt gewesen sein
mufs“.
R. Schneider ist in „Die Geschütze des
Mittelalters“ (Z. f. h. W. V, S. 234 u. 235) dieser
Annahme Köhlers scharf entgegengetreten.
Er übersetzt dabei die angeführte Stelle: „In
Brüssel, meiner zweiten Fleimat, habe ich
selber ein Modell gesehen, sehr sinnreich
und recht hübsch, ziemlich ähnlich einem
antiken Geschütze“. Die von R. Schneider
gewählte Wiedergabe von „forma“ als Mo-
dell steht in vollem Widerspruche mit der
von Lipsius in diesem Kapitel stets, wie auch
in der Überschrift desselben, verwendeten
Bezeichnung von „forma“ für Gestalt, Aus-
sehen, Form. Aus dem Wortlaute der unter
dem Bilde befindlichen Unterschrift
entnimmt R. Schneider „dafs dieselbe mit ge-
nügender Deutlichkeit das Geschütz als Re-
konstruktion bezeichne“: „geschickt angefer-
tigt“ „affabre factam“. Auch diese Deutung
Abb. 3. Ansicht von oben
in Ruhestellung und (gestrichelt) gespannt.
Abb. 2. Seitenansicht.
kann nicht als richtig anerkannt werden. Die
Unterschrift lautet im Zusammenhänge mit
dem vorangegangenen oben angeführten:
„vidi ipse Bruxellae . .. ejus forman“: „Diese
— Hane — kunstreich gefertigte (Catapulte)
fand ich im Zeughause zu Brüssel“. Dann
folgt eine kurze klassische Beschreibung des
Wesens der Torsionsgeschütze: „Zwei ein-
zelne — getrennte — Arme, die nicht etwa
einen in sich zusammenhängenden Bügel bil-
den, sind in gespannte Nerven eingeklemmt
und werden zurückgezogen, das ist als das
Eigenartige zu vermerken. Die Arbeitskraft
wird nicht durch das Biegen eines Bügels
geschaffen, sondern sie liegt allein in dem
Rückspannbestreben derNerven begründet“.
B. RATHGEN, FEUER- UND FERNWAFFEN DES 14. JAHRHUNDERTS IN FLANDERN VII. BAND
Abb. i. Bildliche Ansicht der Springale.
Höhenrichtvorrichtung ist fortgelassen, Nufs nicht eingezeichnet.
Auskunft geben. „Aber ich zweifle nicht daran,
dafs sogar derartige alte Katapulten selber noch
in den Zeughäusern verborgen sind. Sah ich doch
in Brüssel, meiner zweiten Heimat, eine solche
von geistreich schöner Form, die der alten nahe
kam“. „Sed et ipsas veteres catapultas latere alibi in
armamentariis, non dubito: et vidi ipse Bruxellae,
in altera mea patria, ejus formam, ingeniosam et krrz
pulcliellam, nee longe a prisca“.
General Köhler folgerte hieraus (III, 153),
dafs im Mittelalter Torsionsgeschütze noch be-
kannt gewesen seien. Er führt aus: „Justus Lipsius
erhielt nur dadurch eine Vorstellung von der
Balliste des Altertums, dafs er im Zeughause zu
Brüssel eine wirkliche Balliste fand, die da-
selbst seit langer Zeit aufbewahrt gewesen sein
mufs“.
R. Schneider ist in „Die Geschütze des
Mittelalters“ (Z. f. h. W. V, S. 234 u. 235) dieser
Annahme Köhlers scharf entgegengetreten.
Er übersetzt dabei die angeführte Stelle: „In
Brüssel, meiner zweiten Fleimat, habe ich
selber ein Modell gesehen, sehr sinnreich
und recht hübsch, ziemlich ähnlich einem
antiken Geschütze“. Die von R. Schneider
gewählte Wiedergabe von „forma“ als Mo-
dell steht in vollem Widerspruche mit der
von Lipsius in diesem Kapitel stets, wie auch
in der Überschrift desselben, verwendeten
Bezeichnung von „forma“ für Gestalt, Aus-
sehen, Form. Aus dem Wortlaute der unter
dem Bilde befindlichen Unterschrift
entnimmt R. Schneider „dafs dieselbe mit ge-
nügender Deutlichkeit das Geschütz als Re-
konstruktion bezeichne“: „geschickt angefer-
tigt“ „affabre factam“. Auch diese Deutung
Abb. 3. Ansicht von oben
in Ruhestellung und (gestrichelt) gespannt.
Abb. 2. Seitenansicht.
kann nicht als richtig anerkannt werden. Die
Unterschrift lautet im Zusammenhänge mit
dem vorangegangenen oben angeführten:
„vidi ipse Bruxellae . .. ejus forman“: „Diese
— Hane — kunstreich gefertigte (Catapulte)
fand ich im Zeughause zu Brüssel“. Dann
folgt eine kurze klassische Beschreibung des
Wesens der Torsionsgeschütze: „Zwei ein-
zelne — getrennte — Arme, die nicht etwa
einen in sich zusammenhängenden Bügel bil-
den, sind in gespannte Nerven eingeklemmt
und werden zurückgezogen, das ist als das
Eigenartige zu vermerken. Die Arbeitskraft
wird nicht durch das Biegen eines Bügels
geschaffen, sondern sie liegt allein in dem
Rückspannbestreben derNerven begründet“.