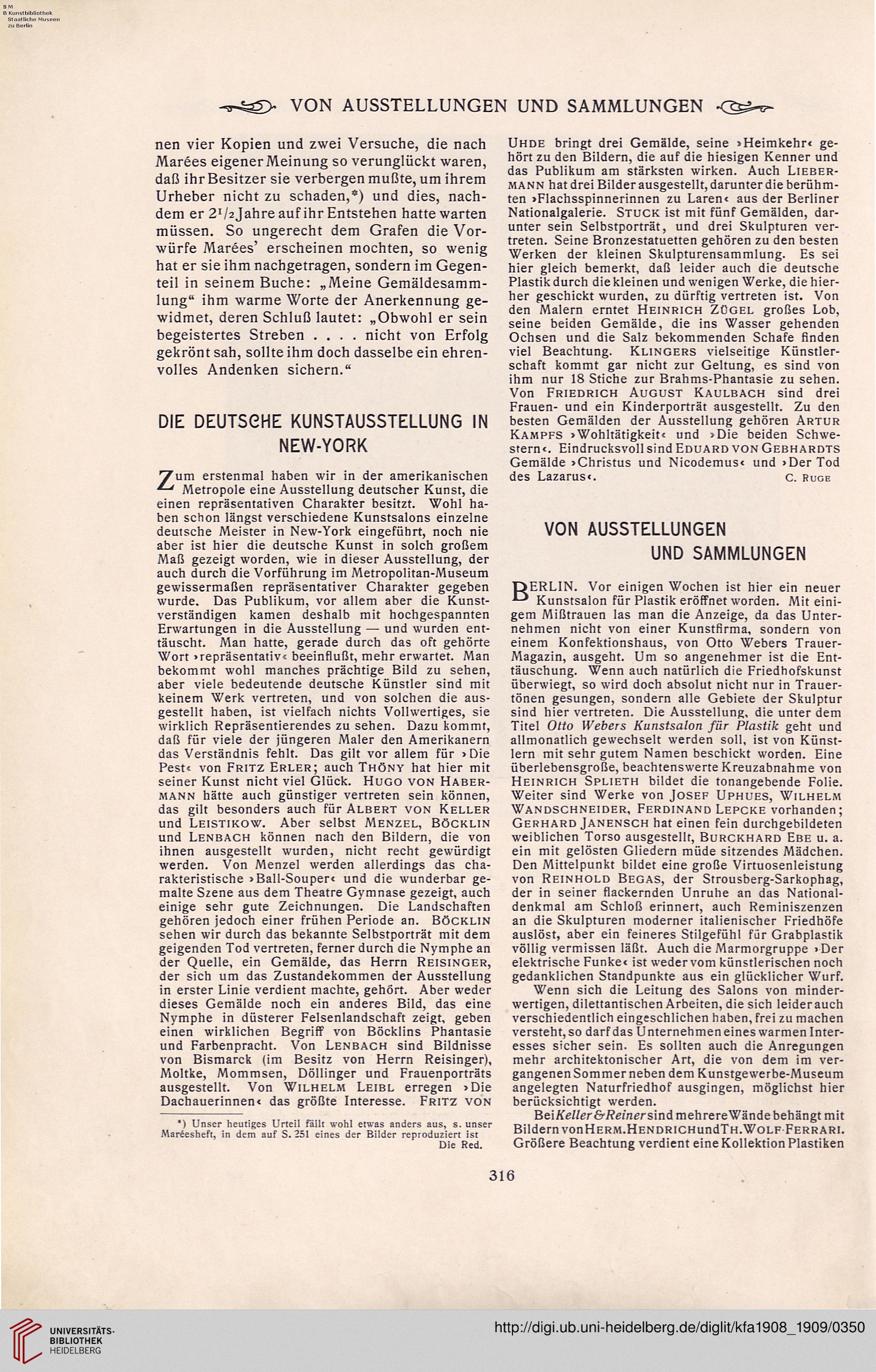-:r4^> VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN <&^~
nen vier Kopien und zwei Versuche, die nach
Marees eigenerMeinung so verunglückt waren,
daß ihr Besitzer sie verbergen mußte, um ihrem
Urheber nicht zu schaden,*) und dies, nach-
dem er 2'/2jahre auf ihr Entstehen hatte warten
müssen. So ungerecht dem Grafen die Vor-
würfe Marees' erscheinen mochten, so wenig
hat er sie ihm nachgetragen, sondern im Gegen-
teil in seinem Buche: „Meine Gemäldesamm-
lung" ihm warme Worte der Anerkennung ge-
widmet, deren Schluß lautet: „Obwohl er sein
begeistertes Streben .... nicht von Erfolg
gekrönt sah, sollte ihm doch dasselbe ein ehren-
volles Andenken sichern."
DIE DEUTSCHE KUNSTAUSSTELLUNG IN
NEW-YORK
7um erstenmal haben wir in der amerikanischen
" Metropole eine Ausstellung deutscher Kunst, die
einen repräsentativen Charakter besitzt. Wohl ha-
ben schon längst verschiedene Kunstsalons einzelne
deutsche Meister in New-York eingeführt, noch nie
aber ist hier die deutsche Kunst in solch großem
Maß gezeigt worden, wie in dieser Ausstellung, der
auch durch die Vorführung im Metropolitan-Museum
gewissermaßen repräsentativer Charakter gegeben
wurde. Das Publikum, vor allem aber die Kunst-
verständigen kamen deshalb mit hochgespannten
Erwartungen in die Ausstellung — und wurden ent-
täuscht. Man hatte, gerade durch das oft gehörte
Wort repräsentativ« beeinflußt, mehr erwartet. Man
bekommt wohl manches prächtige Bild zu sehen,
aber viele bedeutende deutsche Künstler sind mit
keinem Werk vertreten, und von solchen die aus-
gestellt haben, ist vielfach nichts Vollwertiges, sie
wirklich Repräsentierendes zu sehen. Dazu kommt,
daß für viele der jüngeren Maler den Amerikanern
das Verständnis fehlt. Das gilt vor allem für >Die
Pest« von Fritz Erler; auch Thöny hat hier mit
seiner Kunst nicht viel Glück. Hugo von Haber-
mann hätte auch günstiger vertreten sein können,
das gilt besonders auch für Albert von Keller
und Leistikow. Aber selbst Menzel, Böcklin
und Lenbach können nach den Bildern, die von
ihnen ausgestellt wurden, nicht recht gewürdigt
werden. Von Menzel werden allerdings das cha-
rakteristische »Ball-Souper« und die wunderbar ge-
malte Szene aus dem Theatre Gymnase gezeigt, auch
einige sehr gute Zeichnungen. Die Landschaften
gehören jedoch einer frühen Periode an. Böcklin
sehen wir durch das bekannte Selbstporträt mit dem
geigenden Tod vertreten, ferner durch die Nymphe an
der Quelle, ein Gemälde, das Herrn Reisinger,
der sich um das Zustandekommen der Ausstellung
in erster Linie verdient machte, gehört. Aber weder
dieses Gemälde noch ein anderes Bild, das eine
Nymphe in düsterer Felsenlandschaft zeigt, geben
einen wirklichen Begriff von Böcklins Phantasie
und Farbenpracht. Von Lenbach sind Bildnisse
von Bismarck (im Besitz von Herrn Reisinger),
Moltke, Mommsen, Döllinger und Frauenporträts
ausgestellt. Von Wilhelm Leibl erregen >Die
Dachauerinnen« das größte Interesse. Fritz von
*) Unser heutiges Urteil fällt wohl etwas anders aus, s. unser
Mareesheft, in dem auf s. 251 eines der Bilder reproduziert ist
Die Red.
Uhde bringt drei Gemälde, seine »Heimkehr« ge-
hört zu den Bildern, die auf die hiesigen Kenner und
das Publikum am stärksten wirken. Auch Lieber-
mann hat drei Bilder ausgestellt, darunter die berühm-
ten »Flachsspinnerinnen zu Laren« aus der Berliner
Nationalgalerie. Stuck ist mit fünf Gemälden, dar-
unter sein Selbstporträt, und drei Skulpturen ver-
treten. Seine Bronzestatuetten gehören zu den besten
Werken der kleinen Skulpturensammlung. Es sei
hier gleich bemerkt, daß leider auch die deutsche
Plastik durch die kleinen und wenigen Werke, die hier-
her geschickt wurden, zu dürftig vertreten ist. Von
den Malern erntet Heinrich Zügel großes Lob,
seine beiden Gemälde, die ins Wasser gehenden
Ochsen und die Salz bekommenden Schafe finden
viel Beachtung. Klingers vielseitige Künstler-
schaft kommt gar nicht zur Geltung, es sind von
ihm nur 18 Stiche zur Brahms-Phantasie zu sehen.
Von Friedrich August Kaulbach sind drei
Frauen- und ein Kinderporträt ausgestellt. Zu den
besten Gemälden der Ausstellung gehören Artur
Kampfs »Wohltätigkeit« und »Die beiden Schwe-
stern«. Eindrucksvoll sind Eduard von Gebhardts
Gemälde »Christus und Nicodemus« und »Der Tod
des Lazarus«. c. rüge
VON AUSSTELLUNGEN
UND SAMMLUNGEN
DERLIN. Vor einigen Wochen ist hier ein neuer
Kunstsalon für Plastik eröffnet worden. Mit eini-
gem Mißtrauen las man die Anzeige, da das Unter-
nehmen nicht von einer Kunstfirma, sondern von
einem Konfektionshaus, von Otto Webers Trauer-
Magazin, ausgeht. Um so angenehmer ist die Ent-
täuschung. Wenn auch natürlich die Friedhofskunst
überwiegt, so wird doch absolut nicht nur in Trauer-
tönen gesungen, sondern alle Gebiete der Skulptur
sind hier vertreten. Die Ausstellung, die unter dem
Titel Otto Webers Kunstsalon für Plastik geht und
allmonatlich gewechselt werden soll, ist von Künst-
lern mit sehr gutem Namen beschickt worden. Eine
überlebensgroße, beachtenswerte Kreuzabnahme von
Heinrich Splieth bildet die tonangebende Folie.
Weiter sind Werke von Josef Uphues, Wilhelm
Wandschneider, Ferdinand Lepcke vorhanden;
Gerhard Janensch hat einen fein durchgebildeten
weiblichen Torso ausgestellt, Burckhard Ebe u. a.
ein mit gelösten Gliedern müde sitzendes Mädchen.
Den Mittelpunkt bildet eine große Virtuosenleistung
von Reinhold Begas, der Strousberg-Sarkophag,
der in seiner flackernden Unruhe an das National-
denkmal am Schloß erinnert, auch Reminiszenzen
an die Skulpturen moderner italienischer Friedhöfe
auslöst, aber ein feineres Stilgefühl für Grabplastik
völlig vermissen läßt. Auch die Marmorgruppe »Der
elektrische Funke« ist weder vom künstlerischen noch
gedanklichen Standpunkte aus ein glücklicher Wurf.
Wenn sich die Leitung des Salons von minder-
wertigen, dilettantischen Arbeiten, die sich leiderauch
verschiedentlich eingeschlichen haben, frei zu machen
versteht, so darf das Unternehmeneines warmenlnter-
esses sicher sein. Es sollten auch die Anregungen
mehr architektonischer Art, die von dem im ver-
gangenenSommerneben dem Kunstgewerbe-Museum
angelegten Naturfriedhof ausgingen, möglichst hier
berücksichtigt werden.
Bei/fe//er&/?einersind mehrere Wände behängt mit
Bildern vonHERM.HENDRiCHundTH.WoLF Ferrari.
Größere Beachtung verdient eine Kollektion Plastiken
316
nen vier Kopien und zwei Versuche, die nach
Marees eigenerMeinung so verunglückt waren,
daß ihr Besitzer sie verbergen mußte, um ihrem
Urheber nicht zu schaden,*) und dies, nach-
dem er 2'/2jahre auf ihr Entstehen hatte warten
müssen. So ungerecht dem Grafen die Vor-
würfe Marees' erscheinen mochten, so wenig
hat er sie ihm nachgetragen, sondern im Gegen-
teil in seinem Buche: „Meine Gemäldesamm-
lung" ihm warme Worte der Anerkennung ge-
widmet, deren Schluß lautet: „Obwohl er sein
begeistertes Streben .... nicht von Erfolg
gekrönt sah, sollte ihm doch dasselbe ein ehren-
volles Andenken sichern."
DIE DEUTSCHE KUNSTAUSSTELLUNG IN
NEW-YORK
7um erstenmal haben wir in der amerikanischen
" Metropole eine Ausstellung deutscher Kunst, die
einen repräsentativen Charakter besitzt. Wohl ha-
ben schon längst verschiedene Kunstsalons einzelne
deutsche Meister in New-York eingeführt, noch nie
aber ist hier die deutsche Kunst in solch großem
Maß gezeigt worden, wie in dieser Ausstellung, der
auch durch die Vorführung im Metropolitan-Museum
gewissermaßen repräsentativer Charakter gegeben
wurde. Das Publikum, vor allem aber die Kunst-
verständigen kamen deshalb mit hochgespannten
Erwartungen in die Ausstellung — und wurden ent-
täuscht. Man hatte, gerade durch das oft gehörte
Wort repräsentativ« beeinflußt, mehr erwartet. Man
bekommt wohl manches prächtige Bild zu sehen,
aber viele bedeutende deutsche Künstler sind mit
keinem Werk vertreten, und von solchen die aus-
gestellt haben, ist vielfach nichts Vollwertiges, sie
wirklich Repräsentierendes zu sehen. Dazu kommt,
daß für viele der jüngeren Maler den Amerikanern
das Verständnis fehlt. Das gilt vor allem für >Die
Pest« von Fritz Erler; auch Thöny hat hier mit
seiner Kunst nicht viel Glück. Hugo von Haber-
mann hätte auch günstiger vertreten sein können,
das gilt besonders auch für Albert von Keller
und Leistikow. Aber selbst Menzel, Böcklin
und Lenbach können nach den Bildern, die von
ihnen ausgestellt wurden, nicht recht gewürdigt
werden. Von Menzel werden allerdings das cha-
rakteristische »Ball-Souper« und die wunderbar ge-
malte Szene aus dem Theatre Gymnase gezeigt, auch
einige sehr gute Zeichnungen. Die Landschaften
gehören jedoch einer frühen Periode an. Böcklin
sehen wir durch das bekannte Selbstporträt mit dem
geigenden Tod vertreten, ferner durch die Nymphe an
der Quelle, ein Gemälde, das Herrn Reisinger,
der sich um das Zustandekommen der Ausstellung
in erster Linie verdient machte, gehört. Aber weder
dieses Gemälde noch ein anderes Bild, das eine
Nymphe in düsterer Felsenlandschaft zeigt, geben
einen wirklichen Begriff von Böcklins Phantasie
und Farbenpracht. Von Lenbach sind Bildnisse
von Bismarck (im Besitz von Herrn Reisinger),
Moltke, Mommsen, Döllinger und Frauenporträts
ausgestellt. Von Wilhelm Leibl erregen >Die
Dachauerinnen« das größte Interesse. Fritz von
*) Unser heutiges Urteil fällt wohl etwas anders aus, s. unser
Mareesheft, in dem auf s. 251 eines der Bilder reproduziert ist
Die Red.
Uhde bringt drei Gemälde, seine »Heimkehr« ge-
hört zu den Bildern, die auf die hiesigen Kenner und
das Publikum am stärksten wirken. Auch Lieber-
mann hat drei Bilder ausgestellt, darunter die berühm-
ten »Flachsspinnerinnen zu Laren« aus der Berliner
Nationalgalerie. Stuck ist mit fünf Gemälden, dar-
unter sein Selbstporträt, und drei Skulpturen ver-
treten. Seine Bronzestatuetten gehören zu den besten
Werken der kleinen Skulpturensammlung. Es sei
hier gleich bemerkt, daß leider auch die deutsche
Plastik durch die kleinen und wenigen Werke, die hier-
her geschickt wurden, zu dürftig vertreten ist. Von
den Malern erntet Heinrich Zügel großes Lob,
seine beiden Gemälde, die ins Wasser gehenden
Ochsen und die Salz bekommenden Schafe finden
viel Beachtung. Klingers vielseitige Künstler-
schaft kommt gar nicht zur Geltung, es sind von
ihm nur 18 Stiche zur Brahms-Phantasie zu sehen.
Von Friedrich August Kaulbach sind drei
Frauen- und ein Kinderporträt ausgestellt. Zu den
besten Gemälden der Ausstellung gehören Artur
Kampfs »Wohltätigkeit« und »Die beiden Schwe-
stern«. Eindrucksvoll sind Eduard von Gebhardts
Gemälde »Christus und Nicodemus« und »Der Tod
des Lazarus«. c. rüge
VON AUSSTELLUNGEN
UND SAMMLUNGEN
DERLIN. Vor einigen Wochen ist hier ein neuer
Kunstsalon für Plastik eröffnet worden. Mit eini-
gem Mißtrauen las man die Anzeige, da das Unter-
nehmen nicht von einer Kunstfirma, sondern von
einem Konfektionshaus, von Otto Webers Trauer-
Magazin, ausgeht. Um so angenehmer ist die Ent-
täuschung. Wenn auch natürlich die Friedhofskunst
überwiegt, so wird doch absolut nicht nur in Trauer-
tönen gesungen, sondern alle Gebiete der Skulptur
sind hier vertreten. Die Ausstellung, die unter dem
Titel Otto Webers Kunstsalon für Plastik geht und
allmonatlich gewechselt werden soll, ist von Künst-
lern mit sehr gutem Namen beschickt worden. Eine
überlebensgroße, beachtenswerte Kreuzabnahme von
Heinrich Splieth bildet die tonangebende Folie.
Weiter sind Werke von Josef Uphues, Wilhelm
Wandschneider, Ferdinand Lepcke vorhanden;
Gerhard Janensch hat einen fein durchgebildeten
weiblichen Torso ausgestellt, Burckhard Ebe u. a.
ein mit gelösten Gliedern müde sitzendes Mädchen.
Den Mittelpunkt bildet eine große Virtuosenleistung
von Reinhold Begas, der Strousberg-Sarkophag,
der in seiner flackernden Unruhe an das National-
denkmal am Schloß erinnert, auch Reminiszenzen
an die Skulpturen moderner italienischer Friedhöfe
auslöst, aber ein feineres Stilgefühl für Grabplastik
völlig vermissen läßt. Auch die Marmorgruppe »Der
elektrische Funke« ist weder vom künstlerischen noch
gedanklichen Standpunkte aus ein glücklicher Wurf.
Wenn sich die Leitung des Salons von minder-
wertigen, dilettantischen Arbeiten, die sich leiderauch
verschiedentlich eingeschlichen haben, frei zu machen
versteht, so darf das Unternehmeneines warmenlnter-
esses sicher sein. Es sollten auch die Anregungen
mehr architektonischer Art, die von dem im ver-
gangenenSommerneben dem Kunstgewerbe-Museum
angelegten Naturfriedhof ausgingen, möglichst hier
berücksichtigt werden.
Bei/fe//er&/?einersind mehrere Wände behängt mit
Bildern vonHERM.HENDRiCHundTH.WoLF Ferrari.
Größere Beachtung verdient eine Kollektion Plastiken
316