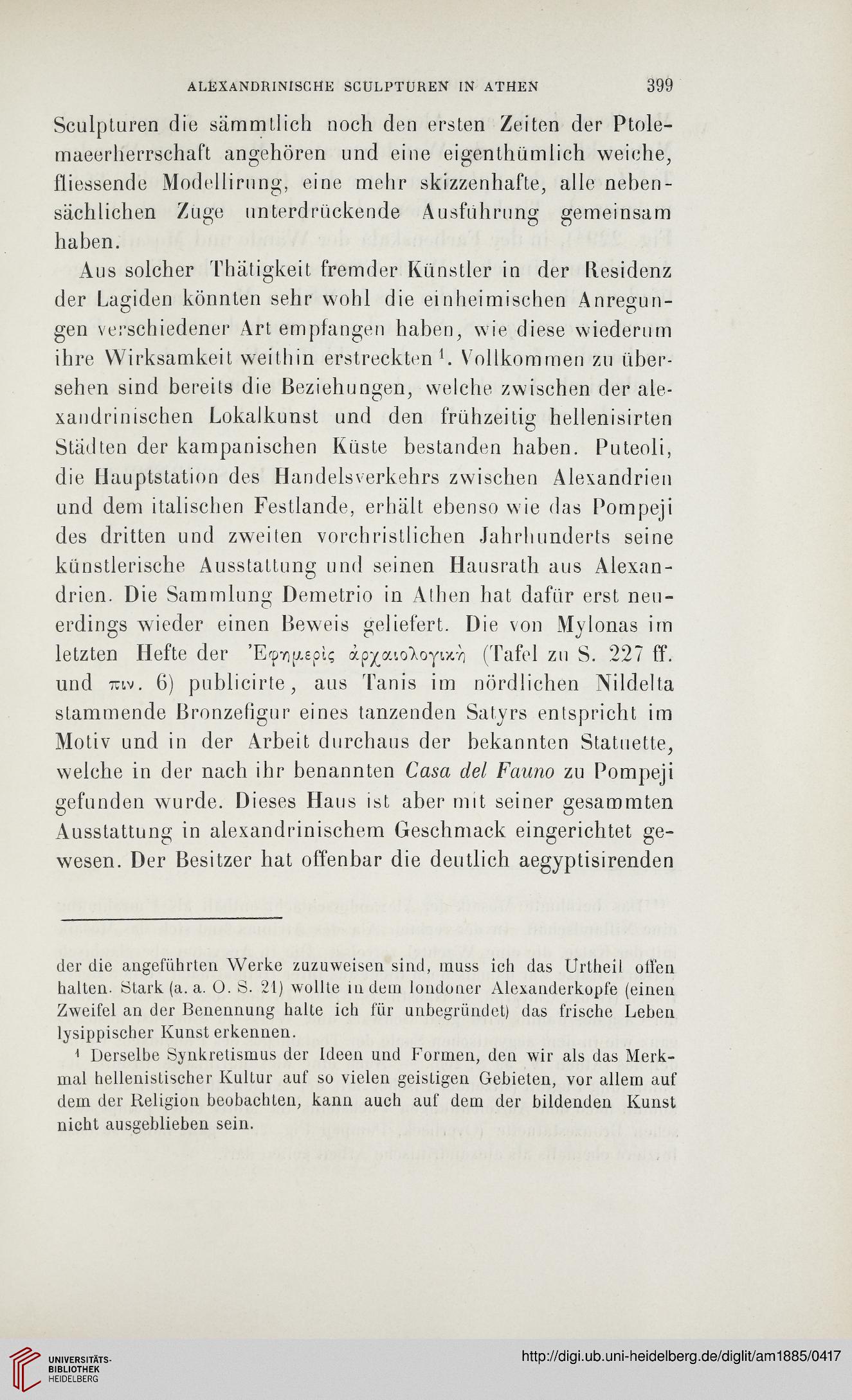ALEXANDRINISCHE SCULPTUREN IN ATHEN
399
Sculpturen die sämmtlich noch den ersten Zeiten der Ptole-
maeerherrschaft angehören und eine eigenthümlieh weiche,
fliessende Modellirung, eine mehr skizzenhafte, alle neben-
sächlichen Zuge unterdrückende Ausführung gemeinsam
haben.
Aus solcher Thätigkeit fremder Künstler in der Residenz
der Lagiden könnten sehr wohl die einheimischen Anregun-
gen verschiedener Art empfangen haben, wie diese wiederum
ihre Wirksamkeit weithin erstreckten* 1. Vollkommen zu über-
sehen sind bereits die Beziehungen, welche zwischen der ale-
xandrinischen Lokalkunst und den frühzeitig hellenisirten
Städten der kampanischen Küste bestanden haben. Puteoli,
die Hauptstation des Handelsverkehrs zwischen Alexandrien
und dem italischen Festlande, erhält ebenso wie das Pompeji
des dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhunderts seine
künstlerische Ausstattung und seinen Hausrath aus Alexan-
drien. Die Sammlung Demetrio in Athen hat dafür erst neu-
erdings wieder einen Beweis geliefert. Die von Mylonas im
letzten Hefte der Έφηρ-ερίς αρχαιολογική (Tafel zu S. 227 ff.
und 7uv. 6) publicirte, aus Tanis im nördlichen Nildelta
stammende Bronzefigur eines tanzenden Satyrs entspricht im
Motiv und in der Arbeit durchaus der bekannten Statuette,
welche in der nach ihr benannten Casa del Fauno zu Pompeji
gefunden wurde. Dieses Haus ist aber mit seiner gesammten
Ausstattung in alexandrinischem Geschmack eingerichtet ge-
wesen. Der Besitzer hat offenbar die deutlich aegyptisirenden
der die angeführten Werke zuzuweisen sind, muss ich das Urtheil offen
halten. Stark (a. a. O. S. 21) wollte indem londoner Alexanderkopfe (einen
Zweifel an der Benennung halte ich für unbegründet) das frische Leben
lysippischer Kunst erkennen.
1 Derselbe Synkretismus der Ideen und Formen, den wir als das Merk-
mal hellenistischer Kultur auf so vielen geistigen Gebieten, vor allem auf
dem der Religion beobachten, kann auch auf dem der bildenden Kunst
nicht ausgeblieben sein.
399
Sculpturen die sämmtlich noch den ersten Zeiten der Ptole-
maeerherrschaft angehören und eine eigenthümlieh weiche,
fliessende Modellirung, eine mehr skizzenhafte, alle neben-
sächlichen Zuge unterdrückende Ausführung gemeinsam
haben.
Aus solcher Thätigkeit fremder Künstler in der Residenz
der Lagiden könnten sehr wohl die einheimischen Anregun-
gen verschiedener Art empfangen haben, wie diese wiederum
ihre Wirksamkeit weithin erstreckten* 1. Vollkommen zu über-
sehen sind bereits die Beziehungen, welche zwischen der ale-
xandrinischen Lokalkunst und den frühzeitig hellenisirten
Städten der kampanischen Küste bestanden haben. Puteoli,
die Hauptstation des Handelsverkehrs zwischen Alexandrien
und dem italischen Festlande, erhält ebenso wie das Pompeji
des dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhunderts seine
künstlerische Ausstattung und seinen Hausrath aus Alexan-
drien. Die Sammlung Demetrio in Athen hat dafür erst neu-
erdings wieder einen Beweis geliefert. Die von Mylonas im
letzten Hefte der Έφηρ-ερίς αρχαιολογική (Tafel zu S. 227 ff.
und 7uv. 6) publicirte, aus Tanis im nördlichen Nildelta
stammende Bronzefigur eines tanzenden Satyrs entspricht im
Motiv und in der Arbeit durchaus der bekannten Statuette,
welche in der nach ihr benannten Casa del Fauno zu Pompeji
gefunden wurde. Dieses Haus ist aber mit seiner gesammten
Ausstattung in alexandrinischem Geschmack eingerichtet ge-
wesen. Der Besitzer hat offenbar die deutlich aegyptisirenden
der die angeführten Werke zuzuweisen sind, muss ich das Urtheil offen
halten. Stark (a. a. O. S. 21) wollte indem londoner Alexanderkopfe (einen
Zweifel an der Benennung halte ich für unbegründet) das frische Leben
lysippischer Kunst erkennen.
1 Derselbe Synkretismus der Ideen und Formen, den wir als das Merk-
mal hellenistischer Kultur auf so vielen geistigen Gebieten, vor allem auf
dem der Religion beobachten, kann auch auf dem der bildenden Kunst
nicht ausgeblieben sein.