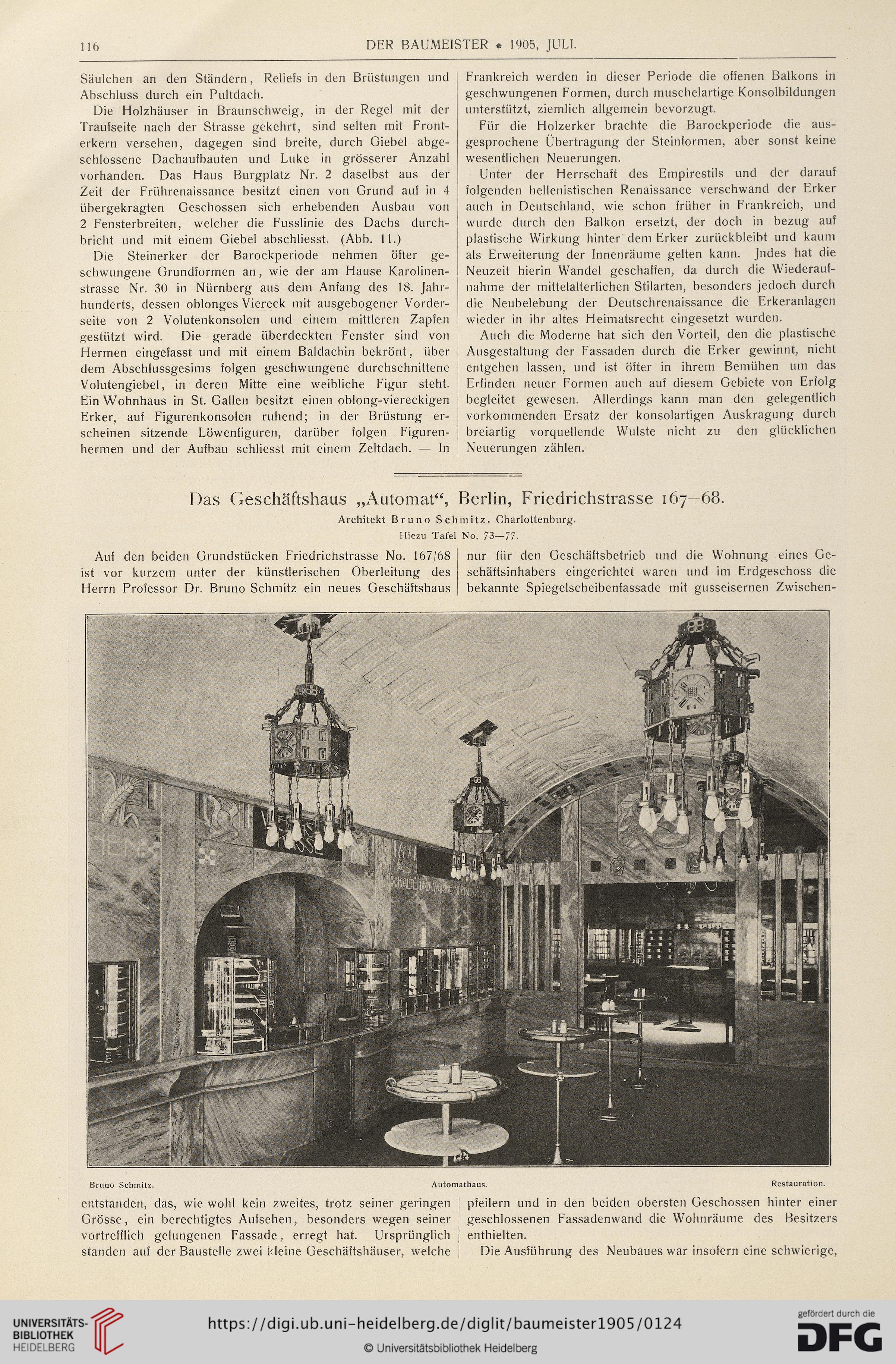Baumeister: das Architektur-Magazin — 3.1905
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.49991#0124
DOI issue:
Heft 10 (1905, Juli)
DOI article:Ebe, Gustav: Die Ausbildung der Front- und Dacherker
DOI article:Das Geschäftshaus "Automat", Berlin, Friedrichstrasse 167-168: Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.49991#0124
116
DER BAUMEISTER * 1905, JULI.
Säulchen an den Ständern, Reliefs in den Brüstungen und
Abschluss durch ein Pultdach.
Die Holzhäuser in Braunschweig, in der Regel mit der
Traufseite nach der Strasse gekehrt, sind selten mit Front-
erkern versehen, dagegen sind breite, durch Giebel abge-
schlossene Dachaufbauten und Luke in grösserer Anzahl
vorhanden. Das Haus Burgplatz Nr. 2 daselbst aus der
Zeit der Frührenaissance besitzt einen von Grund auf in 4
übergekragten Geschossen sich erhebenden Ausbau von
2 Fensterbreiten, welcher die Fusslinie des Dachs durch-
bricht und mit einem Giebel abschliesst. (Abb. 11.)
Die Steinerker der Barockperiode nehmen öfter ge-
schwungene Grundformen an, wie der am Hause Karolinen-
strasse Nr. 30 in Nürnberg aus dem Anfang des 18. Jahr-
hunderts, dessen oblonges Viereck mit ausgebogener Vorder-
seite von 2 Volutenkonsolen und einem mittleren Zapfen
gestützt wird. Die gerade überdeckten Fenster sind von
Hermen eingefasst und mit einem Baldachin bekrönt, über
dem Abschlussgesims folgen geschwungene durchschnittene
Volutengiebel, in deren Mitte eine weibliche Figur steht.
Ein Wohnhaus in St. Gallen besitzt einen oblong-viereckigen
Erker, auf Figurenkonsolen ruhend; in der Brüstung er-
scheinen sitzende Löwenfiguren, darüber folgen Figuren-
hermen und der Aufbau schliesst mit einem Zeltdach. — In
Frankreich werden in dieser Periode die offenen Balkons in
geschwungenen Formen, durch muschelartige Konsolbildungen
unterstützt, ziemlich allgemein bevorzugt.
Für die Holzerker brachte die Barockperiode die aus-
gesprochene Übertragung der Steinformen, aber sonst keine
wesentlichen Neuerungen.
Unter der Herrschaft des Empirestils und der darauf
folgenden hellenistischen Renaissance verschwand der Erker
auch in Deutschland, wie schon früher in Frankreich, und
wurde durch den Balkon ersetzt, der doch in bezug auf
plastische Wirkung hinter dem Erker zurückbleibt und kaum
als Erweiterung der Innenräume gelten kann. Jndes hat die
Neuzeit hierin Wandel geschaffen, da durch die Wiederauf-
nahme der mittelalterlichen Stilarten, besonders jedoch durch
die Neubelebung der Deutschrenaissance die Erkeranlagen
wieder in ihr altes Heimatsrecht eingesetzt wurden.
Auch die Moderne hat sich den Vorteil, den die plastische
Ausgestaltung der Fassaden durch die Erker gewinnt, nicht
entgehen lassen, und ist öfter in ihrem Bemühen um das
Erfinden neuer Formen auch auf diesem Gebiete von Erfolg
begleitet gewesen. Allerdings kann man den gelegentlich
vorkommenden Ersatz der konsolartigen Auskragung durch
breiartig vorquellende Wulste nicht zu den glücklichen
Neuerungen zählen.
Das Geschäftshaus „Automat“, Berlin, Friedrichstrasse 167 68.
Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.
Hiezu Tafel No. 73—77.
Auf den beiden Grundstücken Friedrichstrasse No. 167/68
ist vor kurzem unter der künstlerischen Oberleitung des
Herrn Professor Dr. Bruno Schmitz ein neues Geschäftshaus
nur für den Geschäftsbetrieb und die Wohnung eines Ge-
schäftsinhabers eingerichtet waren und im Erdgeschoss die
bekannte Spiegelscheibenfassade mit gusseisernen Zwischen-
Bruno Schmitz.
Automathaus.
Restauration.
entstanden, das, wie wohl kein zweites, trotz seiner geringen
Grösse, ein berechtigtes Aufsehen, besonders wegen seiner
vortrefflich gelungenen Fassade, erregt hat. Ursprünglich
standen auf der Baustelle zwei kleine Geschäftshäuser, welche
pfeilern und in den beiden obersten Geschossen hinter einer
geschlossenen Fassadenwand die Wohnräume des Besitzers
enthielten.
Die Ausführung des Neubaues war insofern eine schwierige,
DER BAUMEISTER * 1905, JULI.
Säulchen an den Ständern, Reliefs in den Brüstungen und
Abschluss durch ein Pultdach.
Die Holzhäuser in Braunschweig, in der Regel mit der
Traufseite nach der Strasse gekehrt, sind selten mit Front-
erkern versehen, dagegen sind breite, durch Giebel abge-
schlossene Dachaufbauten und Luke in grösserer Anzahl
vorhanden. Das Haus Burgplatz Nr. 2 daselbst aus der
Zeit der Frührenaissance besitzt einen von Grund auf in 4
übergekragten Geschossen sich erhebenden Ausbau von
2 Fensterbreiten, welcher die Fusslinie des Dachs durch-
bricht und mit einem Giebel abschliesst. (Abb. 11.)
Die Steinerker der Barockperiode nehmen öfter ge-
schwungene Grundformen an, wie der am Hause Karolinen-
strasse Nr. 30 in Nürnberg aus dem Anfang des 18. Jahr-
hunderts, dessen oblonges Viereck mit ausgebogener Vorder-
seite von 2 Volutenkonsolen und einem mittleren Zapfen
gestützt wird. Die gerade überdeckten Fenster sind von
Hermen eingefasst und mit einem Baldachin bekrönt, über
dem Abschlussgesims folgen geschwungene durchschnittene
Volutengiebel, in deren Mitte eine weibliche Figur steht.
Ein Wohnhaus in St. Gallen besitzt einen oblong-viereckigen
Erker, auf Figurenkonsolen ruhend; in der Brüstung er-
scheinen sitzende Löwenfiguren, darüber folgen Figuren-
hermen und der Aufbau schliesst mit einem Zeltdach. — In
Frankreich werden in dieser Periode die offenen Balkons in
geschwungenen Formen, durch muschelartige Konsolbildungen
unterstützt, ziemlich allgemein bevorzugt.
Für die Holzerker brachte die Barockperiode die aus-
gesprochene Übertragung der Steinformen, aber sonst keine
wesentlichen Neuerungen.
Unter der Herrschaft des Empirestils und der darauf
folgenden hellenistischen Renaissance verschwand der Erker
auch in Deutschland, wie schon früher in Frankreich, und
wurde durch den Balkon ersetzt, der doch in bezug auf
plastische Wirkung hinter dem Erker zurückbleibt und kaum
als Erweiterung der Innenräume gelten kann. Jndes hat die
Neuzeit hierin Wandel geschaffen, da durch die Wiederauf-
nahme der mittelalterlichen Stilarten, besonders jedoch durch
die Neubelebung der Deutschrenaissance die Erkeranlagen
wieder in ihr altes Heimatsrecht eingesetzt wurden.
Auch die Moderne hat sich den Vorteil, den die plastische
Ausgestaltung der Fassaden durch die Erker gewinnt, nicht
entgehen lassen, und ist öfter in ihrem Bemühen um das
Erfinden neuer Formen auch auf diesem Gebiete von Erfolg
begleitet gewesen. Allerdings kann man den gelegentlich
vorkommenden Ersatz der konsolartigen Auskragung durch
breiartig vorquellende Wulste nicht zu den glücklichen
Neuerungen zählen.
Das Geschäftshaus „Automat“, Berlin, Friedrichstrasse 167 68.
Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.
Hiezu Tafel No. 73—77.
Auf den beiden Grundstücken Friedrichstrasse No. 167/68
ist vor kurzem unter der künstlerischen Oberleitung des
Herrn Professor Dr. Bruno Schmitz ein neues Geschäftshaus
nur für den Geschäftsbetrieb und die Wohnung eines Ge-
schäftsinhabers eingerichtet waren und im Erdgeschoss die
bekannte Spiegelscheibenfassade mit gusseisernen Zwischen-
Bruno Schmitz.
Automathaus.
Restauration.
entstanden, das, wie wohl kein zweites, trotz seiner geringen
Grösse, ein berechtigtes Aufsehen, besonders wegen seiner
vortrefflich gelungenen Fassade, erregt hat. Ursprünglich
standen auf der Baustelle zwei kleine Geschäftshäuser, welche
pfeilern und in den beiden obersten Geschossen hinter einer
geschlossenen Fassadenwand die Wohnräume des Besitzers
enthielten.
Die Ausführung des Neubaues war insofern eine schwierige,