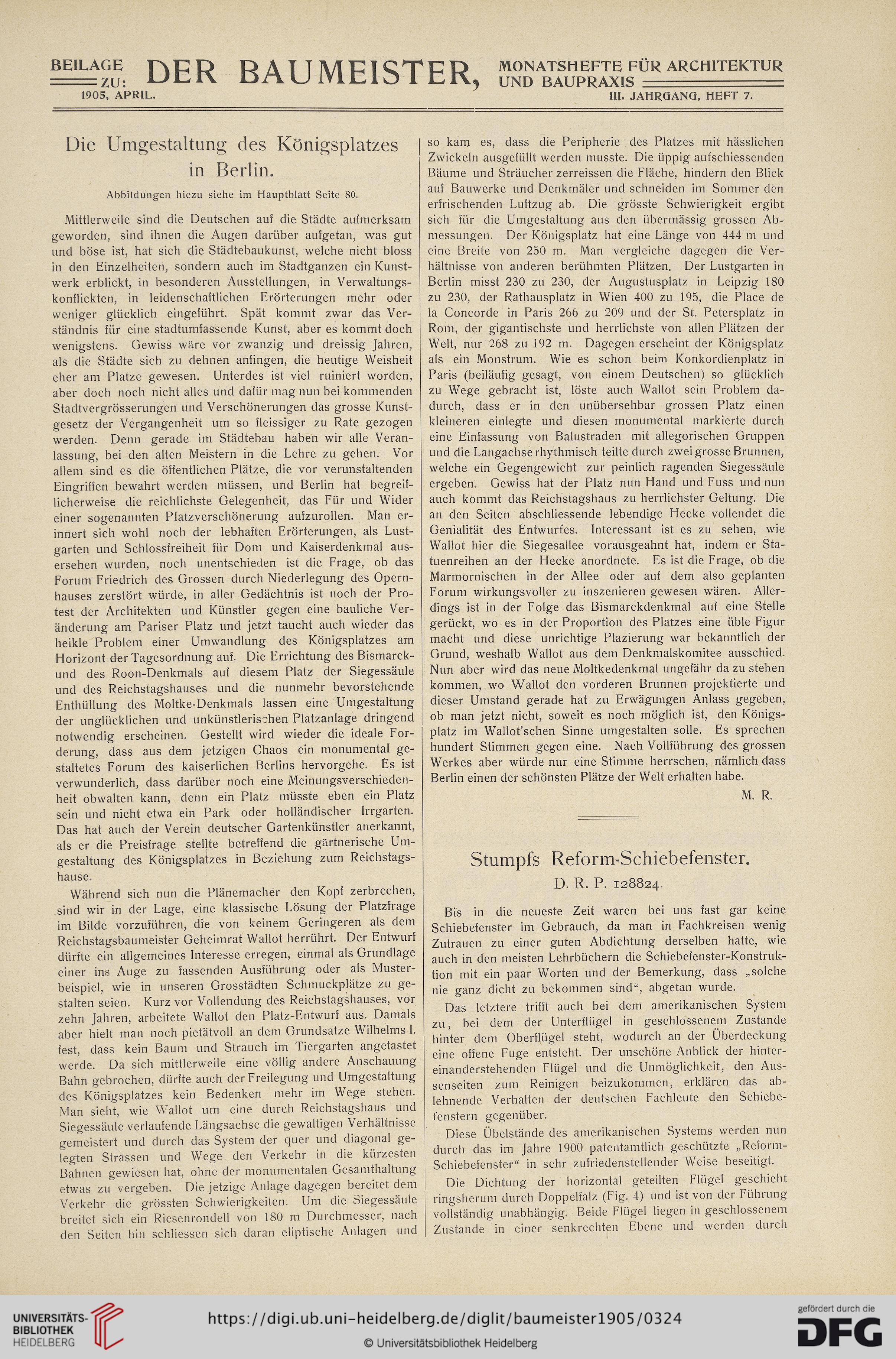MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR
UND BAUPRAXIS ^==-
III. JAHRGANG, HEFT 7.
DER BAUMEISTER,
1905, APRIL.
Die Umgestaltung des Königsplatzes
in Berlin.
Abbildungen hiezu siehe im Hauptblatt Seite 80.
Mittlerweile sind die Deutschen auf die Städte aufmerksam
geworden, sind ihnen die Augen darüber aufgetan, was gut
und böse ist, hat sich die Städtebaukunst, welche nicht bloss
in den Einzelheiten, sondern auch im Stadtganzen ein Kunst-
werk erblickt, in besonderen Ausstellungen, in Verwaltungs-
konflickten, in leidenschaftlichen Erörterungen mehr oder
weniger glücklich eingeführt. Spät kommt zwar das Ver-
ständnis für eine stadtumfassende Kunst, aber es kommt doch
wenigstens. Gewiss wäre vor zwanzig und dreissig Jahren,
als die Städte sich zu dehnen anfingen, die heutige Weisheit
eher am Platze gewesen. Unterdes ist viel ruiniert worden,
aber doch noch nicht alles und dafür mag nun bei kommenden
Stadtvergrösserungen und Verschönerungen das grosse Kunst-
gesetz der Vergangenheit um so fleissiger zu Rate gezogen
werden. Denn gerade im Städtebau haben wir alle Veran-
lassung, bei den alten Meistern in die Lehre zu gehen. Vor
allem sind es die öffentlichen Plätze, die vor verunstaltenden
Eingriffen bewahrt werden müssen, und Berlin hat begreif-
licherweise die reichlichste Gelegenheit, das Für und Wider
einer sogenannten Platzverschönerung aufzurollen. Man er-
innert sich wohl noch der lebhaften Erörterungen, als Lust-
garten und Schlossfreiheit für Dom und Kaiserdenkmal aus-
ersehen wurden, noch unentschieden ist die Frage, ob das
Forum Friedrich des Grossen durch Niederlegung des Opern-
hauses zerstört würde, in aller Gedächtnis ist noch der Pro-
test der Architekten und Künstler gegen eine bauliche Ver-
änderung am Pariser Platz und jetzt taucht auch wieder das
heikle Problem einer Umwandlung des Königsplatzes am
Horizont der Tagesordnung auf. Die Errichtung des Bismarck-
und des Roon-Denkmals auf diesem Platz der Siegessäule
und des Reichstagshauses und die nunmehr bevorstehende
Enthüllung des Moltke-Denkmals lassen eine Umgestaltung
der unglücklichen und unkünstlerischen Platzanlage dringend
notwendig erscheinen. Gestellt wird wieder die ideale For-
derung, dass aus dem jetzigen Chaos ein monumental ge-
staltetes Forum des kaiserlichen Berlins hervorgehe. Es ist
verwunderlich, dass darüber noch eine Meinungsverschieden-
heit obwalten kann, denn ein Platz müsste eben ein Platz
sein und nicht etwa ein Park oder holländischer Irrgarten.
Das hat auch der Verein deutscher Gartenkünstler anerkannt,
als er die Preisfrage stellte betreffend die gärtnerische Um-
gestaltung des Königsplatzes in Beziehung zum Reichstags-
hause.
Während sich nun die Plänemacher den Kopf zerbrechen,
sind wir in der Lage, eine klassische Lösung der Platzfrage
im Bilde vorzuführen, die von keinem Geringeren als dem
Reichstagsbaumeister Geheimrat Wallot herrührt. Der Entwurf
dürfte ein allgemeines Interesse erregen, einmal als Grundlage
einer ins Auge zu fassenden Ausführung oder als Muster-
beispiel, wie in unseren Grosstädten Schmuckplätze zu ge-
stalten seien. Kurz vor Vollendung des Reichstagshauses, vor
zehn Jahren, arbeitete Wallot den Platz-Entwurf aus. Damals
aber hielt man noch pietätvoll an dem Grundsätze Wilhelms I.
fest, dass kein Baum und Strauch im Tiergarten angetastet
werde. Da sich mittlerweile eine völlig andere Anschauung
Bahn gebrochen, dürfte auch der Freilegung und Umgestaltung
des Königsplatzes kein Bedenken mehr im Wege stehen.
Man sieht, wie Wallot um eine durch Reichstagshaus und
Siegessäule verlaufende Längsachse die gewaltigen Verhältnisse
gemeistert und durch das System der quer und diagonal ge-
legten Strassen und Wege den Verkehr in die kürzesten
Bahnen gewiesen hat, ohne der monumentalen Gesamthaltung
etwas zu vergeben. Die jetzige Anlage dagegen bereitet dem
Verkehr die grössten Schwierigkeiten. Um die Siegessäule
breitet sich ein Riesenrondell von 180 m Durchmesser, nach
den Seiten hin schliessen sich daran eliptische Anlagen und
so kam es, dass die Peripherie des Platzes mit hässlichen
Zwickeln ausgefüllt werden musste. Die üppig aufschiessenden
Bäume und Sträucher zerreissen die Fläche, hindern den Blick
auf Bauwerke und Denkmäler und schneiden im Sommer den
erfrischenden Luftzug ab. Die grösste Schwierigkeit ergibt
sich für die Umgestaltung aus den übermässig grossen Ab-
messungen. Der Königsplatz hat eine Länge von 444 m und
eine Breite von 250 m. Man vergleiche dagegen die Ver-
hältnisse von anderen berühmten Plätzen. Der Lustgarten in
Berlin misst 230 zu 230, der Augustusplatz in Leipzig 180
zu 230, der Rathausplatz in Wien 400 zu 195, die Place de
la Concorde in Paris 266 zu 209 und der St. Petersplatz in
Rom, der gigantischste und herrlichste von allen Plätzen der
Welt, nur 268 zu 192 m. Dagegen erscheint der Königsplatz
als ein Monstrum. Wie es schon beim Konkordienplatz in
Paris (beiläufig gesagt, von einem Deutschen) so glücklich
zu Wege gebracht ist, löste auch Wallot sein Problem da-
durch, dass er in den unübersehbar grossen Platz einen
kleineren einlegte und diesen monumental markierte durch
eine Einfassung von Balustraden mit allegorischen Gruppen
und die Langachse rhythmisch teilte durch zwei grosse Brunnen,
welche ein Gegengewicht zur peinlich ragenden Siegessäule
ergeben. Gewiss hat der Platz nun Hand und Fuss und nun
auch kommt das Reichstagshaus zu herrlichster Geltung. Die
an den Seiten abschliessende lebendige Hecke vollendet die
Genialität des Entwurfes. Interessant ist es zu sehen, wie
Wallot hier die Siegesallee vorausgeahnt hat, indem er Sta-
tuenreihen an der Hecke anordnete. Es ist die Frage, ob die
Marmornischen in der Allee oder auf dem also geplanten
Forum wirkungsvoller zu inszenieren gewesen wären. Aller-
dings ist in der Folge das Bismarckdenkmal auf eine Stelle
gerückt, wo es in der Proportion des Platzes eine üble Figur
macht und diese unrichtige Plazierung war bekanntlich der
Grund, weshalb Wallot aus dem Denkmalskomitee ausschied.
Nun aber wird das neue Moltkedenkmal ungefähr dazu stehen
kommen, wo Wallot den vorderen Brunnen projektierte und
dieser Umstand gerade hat zu Erwägungen Anlass gegeben,
ob man jetzt nicht, soweit es noch möglich ist, den Königs-
platz im Wallot’schen Sinne umgestalten solle. Es sprechen
hundert Stimmen gegen eine. Nach Vollführung des grossen
Werkes aber würde nur eine Stimme herrschen, nämlich dass
Berlin einen der schönsten Plätze der Welt erhalten habe.
M. R.
Stumpfs Reform-Schiebefenster.
D. R. P. 128824.
Bis in die neueste Zeit waren bei uns fast gar keine
Schiebefenster im Gebrauch, da man in Fachkreisen wenig
Zutrauen zu einer guten Abdichtung derselben hatte, wie
auch in den meisten Lehrbüchern die Schiebefenster-Konstruk-
tion mit ein paar Worten und der Bemerkung, dass „solche
nie ganz dicht zu bekommen sind“, abgetan wurde.
Das letztere trifft auch bei dem amerikanischen System
zu, bei dem der Unterflügel in geschlossenem Zustande
hinter dem Oberflügel steht, wodurch an der Überdeckung
eine offene Fuge entsteht. Der unschöne Anblick der hinter-
einanderstehenden Flügel und die Unmöglichkeit, den Aus-
senseiten zum Reinigen beizukommen, erklären das ab-
lehnende Verhalten der deutschen Fachleute den Schiebe-
fenstern gegenüber.
Diese Übelstände des amerikanischen Systems werden nun
durch das im Jahre 1900 patentamtlich geschützte „Reform-
Schiebefenster“ in sehr zufriedenstellender Weise beseitigt.
Die Dichtung der horizontal geteilten Flügel geschieht
ringsherum durch Doppelfalz (Fig. 4) und ist von der Führung
vollständig unabhängig. Beide Flügel liegen in geschlossenem
Zustande in einer senkrechten Ebene und werden durch
UND BAUPRAXIS ^==-
III. JAHRGANG, HEFT 7.
DER BAUMEISTER,
1905, APRIL.
Die Umgestaltung des Königsplatzes
in Berlin.
Abbildungen hiezu siehe im Hauptblatt Seite 80.
Mittlerweile sind die Deutschen auf die Städte aufmerksam
geworden, sind ihnen die Augen darüber aufgetan, was gut
und böse ist, hat sich die Städtebaukunst, welche nicht bloss
in den Einzelheiten, sondern auch im Stadtganzen ein Kunst-
werk erblickt, in besonderen Ausstellungen, in Verwaltungs-
konflickten, in leidenschaftlichen Erörterungen mehr oder
weniger glücklich eingeführt. Spät kommt zwar das Ver-
ständnis für eine stadtumfassende Kunst, aber es kommt doch
wenigstens. Gewiss wäre vor zwanzig und dreissig Jahren,
als die Städte sich zu dehnen anfingen, die heutige Weisheit
eher am Platze gewesen. Unterdes ist viel ruiniert worden,
aber doch noch nicht alles und dafür mag nun bei kommenden
Stadtvergrösserungen und Verschönerungen das grosse Kunst-
gesetz der Vergangenheit um so fleissiger zu Rate gezogen
werden. Denn gerade im Städtebau haben wir alle Veran-
lassung, bei den alten Meistern in die Lehre zu gehen. Vor
allem sind es die öffentlichen Plätze, die vor verunstaltenden
Eingriffen bewahrt werden müssen, und Berlin hat begreif-
licherweise die reichlichste Gelegenheit, das Für und Wider
einer sogenannten Platzverschönerung aufzurollen. Man er-
innert sich wohl noch der lebhaften Erörterungen, als Lust-
garten und Schlossfreiheit für Dom und Kaiserdenkmal aus-
ersehen wurden, noch unentschieden ist die Frage, ob das
Forum Friedrich des Grossen durch Niederlegung des Opern-
hauses zerstört würde, in aller Gedächtnis ist noch der Pro-
test der Architekten und Künstler gegen eine bauliche Ver-
änderung am Pariser Platz und jetzt taucht auch wieder das
heikle Problem einer Umwandlung des Königsplatzes am
Horizont der Tagesordnung auf. Die Errichtung des Bismarck-
und des Roon-Denkmals auf diesem Platz der Siegessäule
und des Reichstagshauses und die nunmehr bevorstehende
Enthüllung des Moltke-Denkmals lassen eine Umgestaltung
der unglücklichen und unkünstlerischen Platzanlage dringend
notwendig erscheinen. Gestellt wird wieder die ideale For-
derung, dass aus dem jetzigen Chaos ein monumental ge-
staltetes Forum des kaiserlichen Berlins hervorgehe. Es ist
verwunderlich, dass darüber noch eine Meinungsverschieden-
heit obwalten kann, denn ein Platz müsste eben ein Platz
sein und nicht etwa ein Park oder holländischer Irrgarten.
Das hat auch der Verein deutscher Gartenkünstler anerkannt,
als er die Preisfrage stellte betreffend die gärtnerische Um-
gestaltung des Königsplatzes in Beziehung zum Reichstags-
hause.
Während sich nun die Plänemacher den Kopf zerbrechen,
sind wir in der Lage, eine klassische Lösung der Platzfrage
im Bilde vorzuführen, die von keinem Geringeren als dem
Reichstagsbaumeister Geheimrat Wallot herrührt. Der Entwurf
dürfte ein allgemeines Interesse erregen, einmal als Grundlage
einer ins Auge zu fassenden Ausführung oder als Muster-
beispiel, wie in unseren Grosstädten Schmuckplätze zu ge-
stalten seien. Kurz vor Vollendung des Reichstagshauses, vor
zehn Jahren, arbeitete Wallot den Platz-Entwurf aus. Damals
aber hielt man noch pietätvoll an dem Grundsätze Wilhelms I.
fest, dass kein Baum und Strauch im Tiergarten angetastet
werde. Da sich mittlerweile eine völlig andere Anschauung
Bahn gebrochen, dürfte auch der Freilegung und Umgestaltung
des Königsplatzes kein Bedenken mehr im Wege stehen.
Man sieht, wie Wallot um eine durch Reichstagshaus und
Siegessäule verlaufende Längsachse die gewaltigen Verhältnisse
gemeistert und durch das System der quer und diagonal ge-
legten Strassen und Wege den Verkehr in die kürzesten
Bahnen gewiesen hat, ohne der monumentalen Gesamthaltung
etwas zu vergeben. Die jetzige Anlage dagegen bereitet dem
Verkehr die grössten Schwierigkeiten. Um die Siegessäule
breitet sich ein Riesenrondell von 180 m Durchmesser, nach
den Seiten hin schliessen sich daran eliptische Anlagen und
so kam es, dass die Peripherie des Platzes mit hässlichen
Zwickeln ausgefüllt werden musste. Die üppig aufschiessenden
Bäume und Sträucher zerreissen die Fläche, hindern den Blick
auf Bauwerke und Denkmäler und schneiden im Sommer den
erfrischenden Luftzug ab. Die grösste Schwierigkeit ergibt
sich für die Umgestaltung aus den übermässig grossen Ab-
messungen. Der Königsplatz hat eine Länge von 444 m und
eine Breite von 250 m. Man vergleiche dagegen die Ver-
hältnisse von anderen berühmten Plätzen. Der Lustgarten in
Berlin misst 230 zu 230, der Augustusplatz in Leipzig 180
zu 230, der Rathausplatz in Wien 400 zu 195, die Place de
la Concorde in Paris 266 zu 209 und der St. Petersplatz in
Rom, der gigantischste und herrlichste von allen Plätzen der
Welt, nur 268 zu 192 m. Dagegen erscheint der Königsplatz
als ein Monstrum. Wie es schon beim Konkordienplatz in
Paris (beiläufig gesagt, von einem Deutschen) so glücklich
zu Wege gebracht ist, löste auch Wallot sein Problem da-
durch, dass er in den unübersehbar grossen Platz einen
kleineren einlegte und diesen monumental markierte durch
eine Einfassung von Balustraden mit allegorischen Gruppen
und die Langachse rhythmisch teilte durch zwei grosse Brunnen,
welche ein Gegengewicht zur peinlich ragenden Siegessäule
ergeben. Gewiss hat der Platz nun Hand und Fuss und nun
auch kommt das Reichstagshaus zu herrlichster Geltung. Die
an den Seiten abschliessende lebendige Hecke vollendet die
Genialität des Entwurfes. Interessant ist es zu sehen, wie
Wallot hier die Siegesallee vorausgeahnt hat, indem er Sta-
tuenreihen an der Hecke anordnete. Es ist die Frage, ob die
Marmornischen in der Allee oder auf dem also geplanten
Forum wirkungsvoller zu inszenieren gewesen wären. Aller-
dings ist in der Folge das Bismarckdenkmal auf eine Stelle
gerückt, wo es in der Proportion des Platzes eine üble Figur
macht und diese unrichtige Plazierung war bekanntlich der
Grund, weshalb Wallot aus dem Denkmalskomitee ausschied.
Nun aber wird das neue Moltkedenkmal ungefähr dazu stehen
kommen, wo Wallot den vorderen Brunnen projektierte und
dieser Umstand gerade hat zu Erwägungen Anlass gegeben,
ob man jetzt nicht, soweit es noch möglich ist, den Königs-
platz im Wallot’schen Sinne umgestalten solle. Es sprechen
hundert Stimmen gegen eine. Nach Vollführung des grossen
Werkes aber würde nur eine Stimme herrschen, nämlich dass
Berlin einen der schönsten Plätze der Welt erhalten habe.
M. R.
Stumpfs Reform-Schiebefenster.
D. R. P. 128824.
Bis in die neueste Zeit waren bei uns fast gar keine
Schiebefenster im Gebrauch, da man in Fachkreisen wenig
Zutrauen zu einer guten Abdichtung derselben hatte, wie
auch in den meisten Lehrbüchern die Schiebefenster-Konstruk-
tion mit ein paar Worten und der Bemerkung, dass „solche
nie ganz dicht zu bekommen sind“, abgetan wurde.
Das letztere trifft auch bei dem amerikanischen System
zu, bei dem der Unterflügel in geschlossenem Zustande
hinter dem Oberflügel steht, wodurch an der Überdeckung
eine offene Fuge entsteht. Der unschöne Anblick der hinter-
einanderstehenden Flügel und die Unmöglichkeit, den Aus-
senseiten zum Reinigen beizukommen, erklären das ab-
lehnende Verhalten der deutschen Fachleute den Schiebe-
fenstern gegenüber.
Diese Übelstände des amerikanischen Systems werden nun
durch das im Jahre 1900 patentamtlich geschützte „Reform-
Schiebefenster“ in sehr zufriedenstellender Weise beseitigt.
Die Dichtung der horizontal geteilten Flügel geschieht
ringsherum durch Doppelfalz (Fig. 4) und ist von der Führung
vollständig unabhängig. Beide Flügel liegen in geschlossenem
Zustande in einer senkrechten Ebene und werden durch