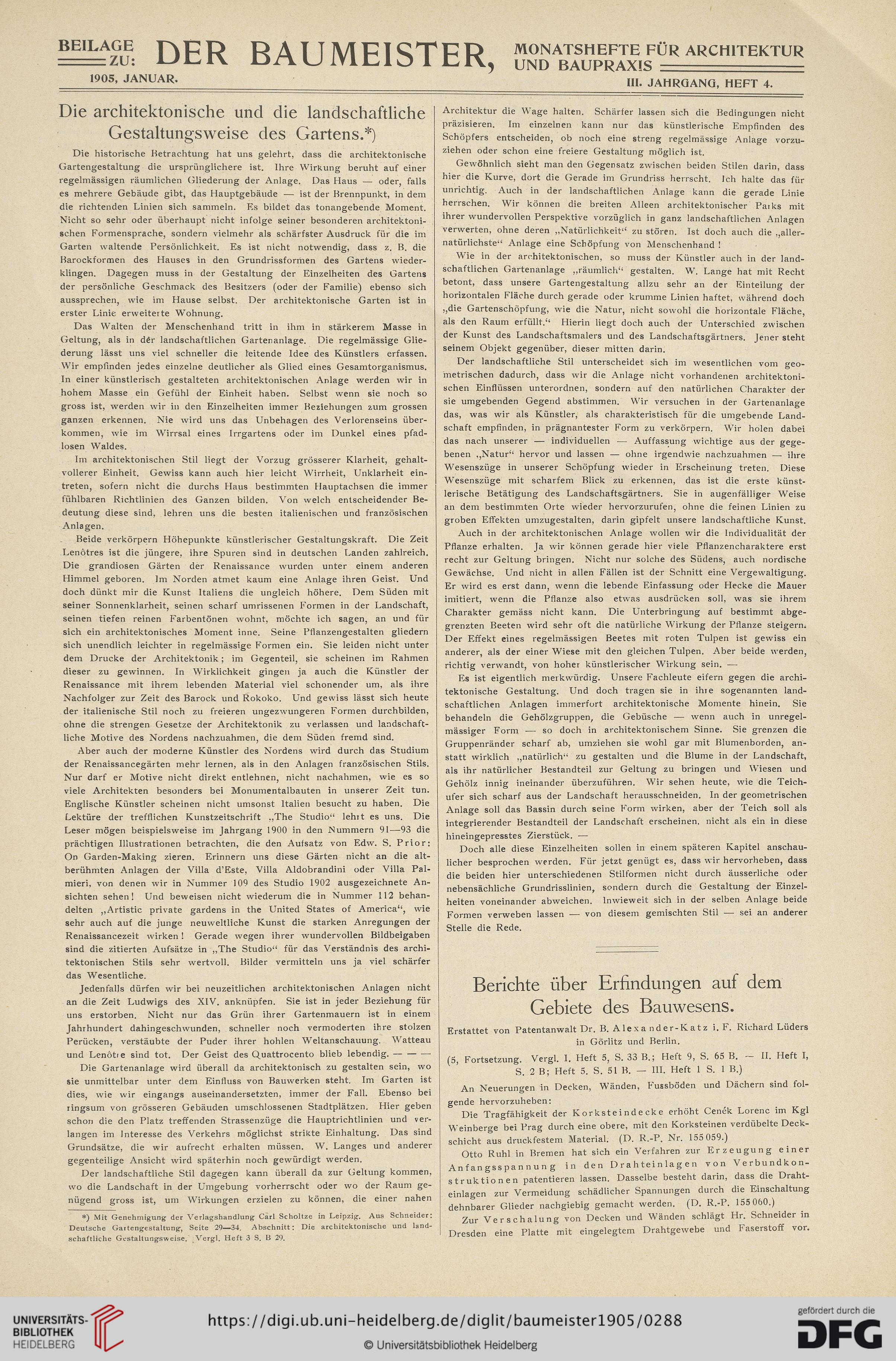DER BAUMEISTER,
1905, JANUAR.
Die architektonische und die landschaftliche
Gestaltungsweise des Gartens.*)
Die historische Betrachtung hat uns gelehrt, dass die architektonische
Gartengestaltung die ursprünglichere ist. Ihre Wirkung beruht auf einer
regelmässigen räumlichen Gliederung der Anlage. Das Haus — oder, falls
es mehrere Gebäude gibt, das Hauptgebäude — ist der Brennpunkt, in dem
die richtenden Linien sich sammeln. Es bildet das tonangebende Moment.
Nicht so sehr oder überhaupt nicht infolge seiner besonderen architektoni-
schen Formensprache, sondern vielmehr als schärfster Ausdruck für die im
Garten waltende Persönlichkeit. Es ist nicht notwendig, dass z. B. die
Barockformen des Hauses in den Grundrissformen des Gartens wieder-
klingen. Dagegen muss in der Gestaltung der Einzelheiten des Gartens
der persönliche Geschmack des Besitzers (oder der Familie) ebenso sich
aussprechen, wie im Hause selbst. Der architektonische Garten ist in
erster Linie erweiterte Wohnung.
Das Walten der Menschenhand tritt in ihm in stärkerem Masse in
Geltung, als in der landschaftlichen Gartenanlage. Die regelmässige Glie-
derung lässt uns viel schneller die leitende Idee des Künstlers erfassen.
Wir empfinden jedes einzelne deutlicher als Glied eines Gesamtorganismus.
In einer künstlerisch gestalteten architektonischen Anlage werden wir in
hohem Masse ein Gefühl der Einheit haben. Selbst wenn sie noch so
gross ist, werden wir in den Einzelheiten immer Beziehungen zum grossen
ganzen erkennen. Nie wird uns das Unbehagen des Verlorenseins über-
kommen, wie im Wirrsal eines Irrgartens oder im Dunkel eines pfad-
losen Waldes.
Im architektonischen Stil liegt der Vorzug grösserer Klarheit, gehalt-
vollerer Einheit. Gewiss kann auch hier leicht Wirrheit, Unklarheit ein-
treten, sofern nicht die durchs Haus bestimmten Hauptachsen die immer
fühlbaren Richtlinien des Ganzen bilden. Von welch entscheidender Be-
deutung diese sind, lehren uns die besten italienischen und französischen
Anlagen.
Beide verkörpern Höhepunkte künstlerischer Gestaltungskraft. Die Zeit
Lenötres ist die jüngere, ihre Spuren sind in deutschen Landen zahlreich.
Die grandiosen Gärten der Renaissance wurden unter einem anderen
Himmel geboren. Jm Norden atmet kaum eine Anlage ihren Geist. Und
doch dünkt mir die Kunst Italiens die ungleich höhere. Dem Süden mit
seiner Sonnenklarheit, seinen scharf umrissenen F'ormen in der Landschaft,
seinen tiefen reinen Farbentönen wohnt, möchte ich sagen, an und für
sich ein architektonisches Moment inne. Seine Pflanzengestalten gliedern
sich unendlich leichter in regelmässige Formen ein. Sie leiden nicht unter
dem Drucke der Architektonik; im Gegenteil, sie scheinen im Rahmen
dieser zu gewinnen. In Wirklichkeit gingen ja auch die Künstler der
Renaissance mit ihrem lebenden Material viel schonender um, als ihre
Nachfolger zur Zeit des Barock und Rokoko. Und gewiss lässt sich heute
der italienische Stil noch zu freieren ungezwungeren Formen durchbilden,
ohne die strengen Gesetze der Architektonik zu verlassen und landschaft-
liche Motive des Nordens nachzuahmen, die dem Süden fremd sind.
Aber auch der moderne Künstler des Nordens wird durch das Studium
der Renaissancegärten mehr lernen, als in den Anlagen französischen Stils.
Nur darf er Motive nicht direkt entlehnen, nicht nachahmen, wie es so
viele Architekten besonders bei Monumentalbauten in unserer Zeit tun.
Englische Künstler scheinen nicht umsonst Italien besucht zu haben. Die
Lektüre der trefflichen Kunstzeitschrift ,,The Studio“ lehrt es uns. Die
Leser mögen beispielsweise im Jahrgang 1900 in den Nummern 91—93 die
prächtigen Illustrationen betrachten, die den Aufsatz von Edw. S. Prior:
On Garden-Making zieren. Erinnern uns diese Gärten nicht an die alt-
berühmten Anlagen der Villa d’Este, Villa Aldobrandini oder Villa Pal-
mieri, von denen wir in Nummer 109 des Studio 1902 ausgezeichnete An-
sichten sehen! Und beweisen nicht wiederum die in Nummer 112 behan-
delten ,,Artistic private gardens in the United States of America“, wie
sehr auch auf die junge neuweltliche Kunst die starken Anregungen der
Renaissancezeit wirken ! Gerade wegen ihrer wundervollen Bildbeigaben
sind die zitierten Aufsätze in „The Studio“ für das Verständnis des archi-
tektonischen Stils sehr wertvoll. Bilder vermitteln uns ja viel schärfer
das Wesentliche.
Jedenfalls dürfen wir bei neuzeitlichen architektonischen Anlagen nicht
an die Zeit Ludwigs des XIV. anknüpfen. Sie ist in jeder Beziehung für
uns erstorben. Nicht nur das Grün ihrer Gartenmauern ist in einem
Jahrhundert dahingeschwunden, schneller noch vermoderten ihre stolzen
Perücken, verstäubte der Puder ihrer hohlen Weltanschauung. Watteau
und Lenötre sind tot. Der Geist des Quattrocento blieb lebendig. —-
Die Gartenanlage wird überall da architektonisch zu gestalten sein, wo
sie unmittelbar unter dem Einfluss von Bauwerken steht. Im Garten ist
dies, wie wir eingangs auseinandersetzten, immer der Fall. Ebenso bei
ringsum von grösseren Gebäuden umschlossenen Stadtplätzen. Hier geben
schon die den Platz treffenden Strassenzüge die Hauptrichtlinien und ver-
langen im Interesse des Verkehrs möglichst strikte Einhaltung. Das sind
Grundsätze, die wir aufrecht erhalten müssen. W. Langes und anderer
gegenteilige Ansicht wird späterhin noch gewürdigt werden.
Der landschaftliche Stil dagegen kann überall da zur Geltung kommen,
wo die Landschaft in der Umgebung vorherrscht oder wo der Raum ge-
nügend gross ist, um Wirkungen erzielen zu können, die einer nahen
*) Mit Genehmigung der Verlagshandlung Carl Scholtze in Leipzig. Aus Schneider:
Deutsche Gartengestaltung, Seite 29—34, Abschnitt: Die architektonische und land-
schaftliche Gestaltungsweise. Vergl. Heft 3 S. B 29.
MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR
UND BAUPRAXIS —
III. JAHRGANG, HEFT 4.
Architektur die W age halten. Schärfer lassen sich die Bedingungen nicht
präzisieren. Im einzelnen kann nur das künstlerische Empfinden des
Schöpfers entscheiden, ob noch eine streng regelmässige Anlage vorzu-
ziehen oder schon eine freiere Gestaltung möglich ist.
Gewöhnlich sieht man den Gegensatz zwischen beiden Stilen darin, dass
hier die Kurve, dort die Gerade im Grundriss herrscht. Ich halte das für
unrichtig. Auch in der landschaftlichen Anlage kann die gerade Linie
herrschen. Wir können die breiten Alleen architektonischer Parks mit
ihrer wundervollen Perspektive vorzüglich in ganz landschaftlichen Anlagen
verwerten, ohne deren „Natürlichkeit“ zu stören. Ist doch auch die „aller-
natürlichste“ Anlage eine Schöpfung von Menschenhand !
Wie in der architektonischen, so muss der Künstler auch in der land-
schaftlichen Gartenanlage „räumlich“ gestalten. W. Lange hat mit Recht
betont, dass unsere Gartengestaltung allzu sehr an der Einteilung der
horizontalen Fläche durch gerade oder krumme Linien haftet, während doch
„die Gartenschöpfung, wie die Natur, nicht sowohl die horizontale Fläche,
als den Raum erfüllt.“ Hierin liegt doch auch der Unterschied zwischen
der Kunst des Landschaftsmalers und des Landschaftsgärtners. Jener steht
seinem Objekt gegenüber, dieser mitten darin.
Der landschaftliche Stil unterscheidet sich im wesentlichen vom geo-
metrischen dadurch, dass wir die Anlage nicht vorhandenen architektoni-
schen Einflüssen unterordnen, sondern auf den natürlichen Charakter der
sie umgebenden Gegend abstimmen. Wir versuchen in der Gartenanlage
das, was wir als Künstler, als charakteristisch für die umgebende Land-
schaft empfinden, in prägnantester Form zu verkörpern. Wir holen dabei
das nach unserer — individuellen -— Auffassung wichtige aus der gege-
benen „Natur“ hervor und lassen — ohne irgendwie nachzuahmen — ihre
Wesenszüge in unserer Schöpfung wieder in Erscheinung treten. Diese
Wesenszüge mit scharfem Blick zu erkennen, das ist die erste künst-
lerische Betätigung des Landschaftsgärtners. Sie in augenfälliger Weise
an dem bestimmten Orte wieder hervorzurufen, ohne die feinen Linien zu
groben Effekten umzugestalten, darin gipfelt unsere landschaftliche Kunst.
Auch in der architektonischen Anlage wollen wir die Individualität der
Pflanze erhalten. Ja wir können gerade hier viele Pflanzencharaktere erst
recht zur Geltung bringen. Nicht nur solche des Südens, auch nordische
Gewächse. Und nicht in allen Fällen ist der Schnitt eine Vergewaltigung.
Er wird es erst dann, wenn die lebende Einfassung oder Hecke die Mauer
imitiert, wenn die Pflanze also etwas ausdrücken soll, was sie ihrem
Charakter gemäss nicht kann. Die Unterbringung auf bestimmt abge-
grenzten Beeten wird sehr oft die natürliche Wirkung der Pflanze steigern.
Der Effekt eines regelmässigen Beetes mit roten Tulpen ist gewiss ein
anderer, als der einer Wiese mit den gleichen Tulpen. Aber beide werden,
richtig verwandt, von hoher künstlerischer W’irkung sein. —
Es ist eigentlich merkwürdig. Unsere Fachleute eifern gegen die archi-
tektonische Gestaltung. Und doch tragen sie in ihre sogenannten land-
schaftlichen Anlagen immerfort architektonische Momente hinein. Sie
behandeln die Gehölzgruppen, die Gebüsche — wenn auch in unregel-
mässiger Form — so doch in architektonischem Sinne. Sie grenzen die
Gruppenränder scharf ab, umziehen sie wohl gar mit Blumenborden, an-
statt wirklich „natürlich“ zu gestalten und die Blume in der Landschaft,
als ihr natürlicher Bestandteil zur Geltung zu bringen und Wiesen und
Gehölz innig ineinander überzuführen. Wir sehen heute, wie die Teich-
ufer sich scharf aus der Landschaft herausschneiden. In der geometrischen
Anlage soll das Bassin durch seine Form wirken, aber der Teich soll als
integrierender Bestandteil der Landschaft erscheinen, nicht als ein in diese
hineingepresstes Zierstück. ■—
Doch alle diese Einzelheiten sollen in einem späteren Kapitel anschau-
licher besprochen werden. Für jetzt genügt es, dass wir hervorheben, dass
die beiden hier unterschiedenen Stilformen nicht durch äusserliche oder
nebensächliche Grundrisslinien, sondern durch die Gestaltung der Einzel-
heiten voneinander abweichen. Inwieweit sich in der selben Anlage beide
Formen verweben lassen — von diesem gemischten Stil — sei an anderer
Stelle die Rede.
Berichte über Erfindungen auf dem
Gebiete des Bauwesens.
Erstattet von Patentanwalt Dr. B. Alexa nder-Katz i. F. Richard Lüders
in Görlitz und Berlin.
(5, Fortsetzung. Vergl. I. Heft 5, S. 33 B.; Heft 9, S. 65 B. II. Heft I,
S. 2 B; Heft 5. S. 51 B. — III. Heft 1 S. 1 B.)
An Neuerungen in Decken, AVänden, Fussböden und Dächern sind fol-
gende hervorzuheben:
Die Tragfähigkeit der Korksteindecke erhöht Cenek Lorenc im Kgl
Weinberge bei Prag durch eine obere, mit den Korksteinen verdübelte Deck-
schicht aus druckfestem Material. (D. R.-P. Nr. 155 059.)
Otto Ruhl in Bremen hat sich ein Verfahren zur Erzeugung einer
Anfangsspannung in den Drahteinlagen von Verbundkon-
struktionen patentieren lassen. Dasselbe besteht darin, dass die Draht-
einlagen zur Vermeidung schädlicher Spannungen durch die Einschaltung
dehnbarer Glieder nachgiebig gemacht werden. (D. R.-P. 155 060.)
Zur Verschalung von Decken und Wänden schlägt Hr. Schneider in
Dresden eine Platte mit eingelegtem Drahtgewebe und Faserstoff vor.
1905, JANUAR.
Die architektonische und die landschaftliche
Gestaltungsweise des Gartens.*)
Die historische Betrachtung hat uns gelehrt, dass die architektonische
Gartengestaltung die ursprünglichere ist. Ihre Wirkung beruht auf einer
regelmässigen räumlichen Gliederung der Anlage. Das Haus — oder, falls
es mehrere Gebäude gibt, das Hauptgebäude — ist der Brennpunkt, in dem
die richtenden Linien sich sammeln. Es bildet das tonangebende Moment.
Nicht so sehr oder überhaupt nicht infolge seiner besonderen architektoni-
schen Formensprache, sondern vielmehr als schärfster Ausdruck für die im
Garten waltende Persönlichkeit. Es ist nicht notwendig, dass z. B. die
Barockformen des Hauses in den Grundrissformen des Gartens wieder-
klingen. Dagegen muss in der Gestaltung der Einzelheiten des Gartens
der persönliche Geschmack des Besitzers (oder der Familie) ebenso sich
aussprechen, wie im Hause selbst. Der architektonische Garten ist in
erster Linie erweiterte Wohnung.
Das Walten der Menschenhand tritt in ihm in stärkerem Masse in
Geltung, als in der landschaftlichen Gartenanlage. Die regelmässige Glie-
derung lässt uns viel schneller die leitende Idee des Künstlers erfassen.
Wir empfinden jedes einzelne deutlicher als Glied eines Gesamtorganismus.
In einer künstlerisch gestalteten architektonischen Anlage werden wir in
hohem Masse ein Gefühl der Einheit haben. Selbst wenn sie noch so
gross ist, werden wir in den Einzelheiten immer Beziehungen zum grossen
ganzen erkennen. Nie wird uns das Unbehagen des Verlorenseins über-
kommen, wie im Wirrsal eines Irrgartens oder im Dunkel eines pfad-
losen Waldes.
Im architektonischen Stil liegt der Vorzug grösserer Klarheit, gehalt-
vollerer Einheit. Gewiss kann auch hier leicht Wirrheit, Unklarheit ein-
treten, sofern nicht die durchs Haus bestimmten Hauptachsen die immer
fühlbaren Richtlinien des Ganzen bilden. Von welch entscheidender Be-
deutung diese sind, lehren uns die besten italienischen und französischen
Anlagen.
Beide verkörpern Höhepunkte künstlerischer Gestaltungskraft. Die Zeit
Lenötres ist die jüngere, ihre Spuren sind in deutschen Landen zahlreich.
Die grandiosen Gärten der Renaissance wurden unter einem anderen
Himmel geboren. Jm Norden atmet kaum eine Anlage ihren Geist. Und
doch dünkt mir die Kunst Italiens die ungleich höhere. Dem Süden mit
seiner Sonnenklarheit, seinen scharf umrissenen F'ormen in der Landschaft,
seinen tiefen reinen Farbentönen wohnt, möchte ich sagen, an und für
sich ein architektonisches Moment inne. Seine Pflanzengestalten gliedern
sich unendlich leichter in regelmässige Formen ein. Sie leiden nicht unter
dem Drucke der Architektonik; im Gegenteil, sie scheinen im Rahmen
dieser zu gewinnen. In Wirklichkeit gingen ja auch die Künstler der
Renaissance mit ihrem lebenden Material viel schonender um, als ihre
Nachfolger zur Zeit des Barock und Rokoko. Und gewiss lässt sich heute
der italienische Stil noch zu freieren ungezwungeren Formen durchbilden,
ohne die strengen Gesetze der Architektonik zu verlassen und landschaft-
liche Motive des Nordens nachzuahmen, die dem Süden fremd sind.
Aber auch der moderne Künstler des Nordens wird durch das Studium
der Renaissancegärten mehr lernen, als in den Anlagen französischen Stils.
Nur darf er Motive nicht direkt entlehnen, nicht nachahmen, wie es so
viele Architekten besonders bei Monumentalbauten in unserer Zeit tun.
Englische Künstler scheinen nicht umsonst Italien besucht zu haben. Die
Lektüre der trefflichen Kunstzeitschrift ,,The Studio“ lehrt es uns. Die
Leser mögen beispielsweise im Jahrgang 1900 in den Nummern 91—93 die
prächtigen Illustrationen betrachten, die den Aufsatz von Edw. S. Prior:
On Garden-Making zieren. Erinnern uns diese Gärten nicht an die alt-
berühmten Anlagen der Villa d’Este, Villa Aldobrandini oder Villa Pal-
mieri, von denen wir in Nummer 109 des Studio 1902 ausgezeichnete An-
sichten sehen! Und beweisen nicht wiederum die in Nummer 112 behan-
delten ,,Artistic private gardens in the United States of America“, wie
sehr auch auf die junge neuweltliche Kunst die starken Anregungen der
Renaissancezeit wirken ! Gerade wegen ihrer wundervollen Bildbeigaben
sind die zitierten Aufsätze in „The Studio“ für das Verständnis des archi-
tektonischen Stils sehr wertvoll. Bilder vermitteln uns ja viel schärfer
das Wesentliche.
Jedenfalls dürfen wir bei neuzeitlichen architektonischen Anlagen nicht
an die Zeit Ludwigs des XIV. anknüpfen. Sie ist in jeder Beziehung für
uns erstorben. Nicht nur das Grün ihrer Gartenmauern ist in einem
Jahrhundert dahingeschwunden, schneller noch vermoderten ihre stolzen
Perücken, verstäubte der Puder ihrer hohlen Weltanschauung. Watteau
und Lenötre sind tot. Der Geist des Quattrocento blieb lebendig. —-
Die Gartenanlage wird überall da architektonisch zu gestalten sein, wo
sie unmittelbar unter dem Einfluss von Bauwerken steht. Im Garten ist
dies, wie wir eingangs auseinandersetzten, immer der Fall. Ebenso bei
ringsum von grösseren Gebäuden umschlossenen Stadtplätzen. Hier geben
schon die den Platz treffenden Strassenzüge die Hauptrichtlinien und ver-
langen im Interesse des Verkehrs möglichst strikte Einhaltung. Das sind
Grundsätze, die wir aufrecht erhalten müssen. W. Langes und anderer
gegenteilige Ansicht wird späterhin noch gewürdigt werden.
Der landschaftliche Stil dagegen kann überall da zur Geltung kommen,
wo die Landschaft in der Umgebung vorherrscht oder wo der Raum ge-
nügend gross ist, um Wirkungen erzielen zu können, die einer nahen
*) Mit Genehmigung der Verlagshandlung Carl Scholtze in Leipzig. Aus Schneider:
Deutsche Gartengestaltung, Seite 29—34, Abschnitt: Die architektonische und land-
schaftliche Gestaltungsweise. Vergl. Heft 3 S. B 29.
MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR
UND BAUPRAXIS —
III. JAHRGANG, HEFT 4.
Architektur die W age halten. Schärfer lassen sich die Bedingungen nicht
präzisieren. Im einzelnen kann nur das künstlerische Empfinden des
Schöpfers entscheiden, ob noch eine streng regelmässige Anlage vorzu-
ziehen oder schon eine freiere Gestaltung möglich ist.
Gewöhnlich sieht man den Gegensatz zwischen beiden Stilen darin, dass
hier die Kurve, dort die Gerade im Grundriss herrscht. Ich halte das für
unrichtig. Auch in der landschaftlichen Anlage kann die gerade Linie
herrschen. Wir können die breiten Alleen architektonischer Parks mit
ihrer wundervollen Perspektive vorzüglich in ganz landschaftlichen Anlagen
verwerten, ohne deren „Natürlichkeit“ zu stören. Ist doch auch die „aller-
natürlichste“ Anlage eine Schöpfung von Menschenhand !
Wie in der architektonischen, so muss der Künstler auch in der land-
schaftlichen Gartenanlage „räumlich“ gestalten. W. Lange hat mit Recht
betont, dass unsere Gartengestaltung allzu sehr an der Einteilung der
horizontalen Fläche durch gerade oder krumme Linien haftet, während doch
„die Gartenschöpfung, wie die Natur, nicht sowohl die horizontale Fläche,
als den Raum erfüllt.“ Hierin liegt doch auch der Unterschied zwischen
der Kunst des Landschaftsmalers und des Landschaftsgärtners. Jener steht
seinem Objekt gegenüber, dieser mitten darin.
Der landschaftliche Stil unterscheidet sich im wesentlichen vom geo-
metrischen dadurch, dass wir die Anlage nicht vorhandenen architektoni-
schen Einflüssen unterordnen, sondern auf den natürlichen Charakter der
sie umgebenden Gegend abstimmen. Wir versuchen in der Gartenanlage
das, was wir als Künstler, als charakteristisch für die umgebende Land-
schaft empfinden, in prägnantester Form zu verkörpern. Wir holen dabei
das nach unserer — individuellen -— Auffassung wichtige aus der gege-
benen „Natur“ hervor und lassen — ohne irgendwie nachzuahmen — ihre
Wesenszüge in unserer Schöpfung wieder in Erscheinung treten. Diese
Wesenszüge mit scharfem Blick zu erkennen, das ist die erste künst-
lerische Betätigung des Landschaftsgärtners. Sie in augenfälliger Weise
an dem bestimmten Orte wieder hervorzurufen, ohne die feinen Linien zu
groben Effekten umzugestalten, darin gipfelt unsere landschaftliche Kunst.
Auch in der architektonischen Anlage wollen wir die Individualität der
Pflanze erhalten. Ja wir können gerade hier viele Pflanzencharaktere erst
recht zur Geltung bringen. Nicht nur solche des Südens, auch nordische
Gewächse. Und nicht in allen Fällen ist der Schnitt eine Vergewaltigung.
Er wird es erst dann, wenn die lebende Einfassung oder Hecke die Mauer
imitiert, wenn die Pflanze also etwas ausdrücken soll, was sie ihrem
Charakter gemäss nicht kann. Die Unterbringung auf bestimmt abge-
grenzten Beeten wird sehr oft die natürliche Wirkung der Pflanze steigern.
Der Effekt eines regelmässigen Beetes mit roten Tulpen ist gewiss ein
anderer, als der einer Wiese mit den gleichen Tulpen. Aber beide werden,
richtig verwandt, von hoher künstlerischer W’irkung sein. —
Es ist eigentlich merkwürdig. Unsere Fachleute eifern gegen die archi-
tektonische Gestaltung. Und doch tragen sie in ihre sogenannten land-
schaftlichen Anlagen immerfort architektonische Momente hinein. Sie
behandeln die Gehölzgruppen, die Gebüsche — wenn auch in unregel-
mässiger Form — so doch in architektonischem Sinne. Sie grenzen die
Gruppenränder scharf ab, umziehen sie wohl gar mit Blumenborden, an-
statt wirklich „natürlich“ zu gestalten und die Blume in der Landschaft,
als ihr natürlicher Bestandteil zur Geltung zu bringen und Wiesen und
Gehölz innig ineinander überzuführen. Wir sehen heute, wie die Teich-
ufer sich scharf aus der Landschaft herausschneiden. In der geometrischen
Anlage soll das Bassin durch seine Form wirken, aber der Teich soll als
integrierender Bestandteil der Landschaft erscheinen, nicht als ein in diese
hineingepresstes Zierstück. ■—
Doch alle diese Einzelheiten sollen in einem späteren Kapitel anschau-
licher besprochen werden. Für jetzt genügt es, dass wir hervorheben, dass
die beiden hier unterschiedenen Stilformen nicht durch äusserliche oder
nebensächliche Grundrisslinien, sondern durch die Gestaltung der Einzel-
heiten voneinander abweichen. Inwieweit sich in der selben Anlage beide
Formen verweben lassen — von diesem gemischten Stil — sei an anderer
Stelle die Rede.
Berichte über Erfindungen auf dem
Gebiete des Bauwesens.
Erstattet von Patentanwalt Dr. B. Alexa nder-Katz i. F. Richard Lüders
in Görlitz und Berlin.
(5, Fortsetzung. Vergl. I. Heft 5, S. 33 B.; Heft 9, S. 65 B. II. Heft I,
S. 2 B; Heft 5. S. 51 B. — III. Heft 1 S. 1 B.)
An Neuerungen in Decken, AVänden, Fussböden und Dächern sind fol-
gende hervorzuheben:
Die Tragfähigkeit der Korksteindecke erhöht Cenek Lorenc im Kgl
Weinberge bei Prag durch eine obere, mit den Korksteinen verdübelte Deck-
schicht aus druckfestem Material. (D. R.-P. Nr. 155 059.)
Otto Ruhl in Bremen hat sich ein Verfahren zur Erzeugung einer
Anfangsspannung in den Drahteinlagen von Verbundkon-
struktionen patentieren lassen. Dasselbe besteht darin, dass die Draht-
einlagen zur Vermeidung schädlicher Spannungen durch die Einschaltung
dehnbarer Glieder nachgiebig gemacht werden. (D. R.-P. 155 060.)
Zur Verschalung von Decken und Wänden schlägt Hr. Schneider in
Dresden eine Platte mit eingelegtem Drahtgewebe und Faserstoff vor.