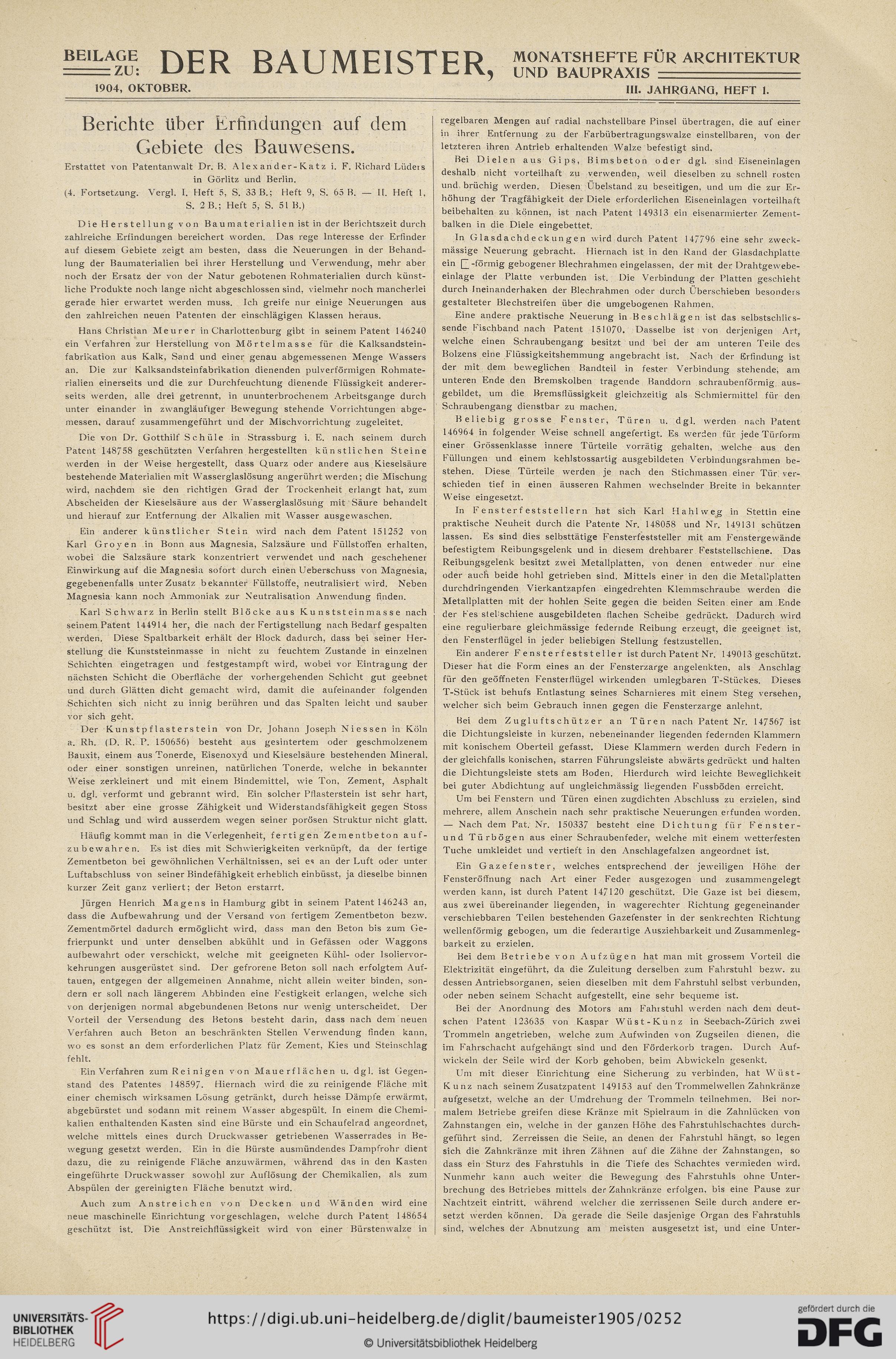Beilage £)ER BAUMEISTER M0NATSHEFTE für Architektur
1904, OKTOBER. III. JAHRGANG, HEFT 1.
Berichte über Erfindungen auf dem
Gebiete des Bauwesens.
Erstattet von Patentanwalt Dr. B. Alexander-Katz i. F. Richard Lüders
in Görlitz und Berlin.
(4. Fortsetzung. Vergl. I. Heft 5, S. 33 B.; Heft 9, S. 65 B. — II. Heft 1,
S. 2B.; Heft 5, S. 51 B.)
Die Herstellung von Baumaterialien ist in der Berichtszeit durch
zahlreiche Erfindungen bereichert worden. Das rege Interesse der Erfinder
auf diesem Gebiete zeigt am besten, dass die Neuerungen in der Behand-
lung der Baumaterialien bei ihrer Herstellung und Verwendung, mehr aber
noch der Ersatz der von der Natur gebotenen Rohmaterialien durch künst-
liche Produkte noch lange nicht abgeschlossen sind, vielmehr noch mancherlei
gerade hier erwartet werden muss. Ich greife nur einige Neuerungen aus
den zahlreichen neuen Patenten der einschlägigen Klassen heraus.
Hans Christian Meurer in Charlottenburg gibt in seinem Patent 146240
ein Verfahren zur Herstellung von Mörtelmasse für die Kalksandstein-
fabrikation aus Kalk, Sand und einer genau abgemessenen Menge Wassers
an. Die zur Kalksandsteinfabrikation dienenden pulverförmigen Rohmate-
rialien einerseits und die zur Durchfeuchtung dienende Flüssigkeit anderer-
seits werden, alle drei getrennt, in ununterbrochenem Arbeitsgange durch
unter einander in zwangläufiger Bewegung stehende Vorrichtungen abge-
messen, darauf zusammengeführt und der Mischvorrichtung zugeleitet.
Die von Dr. Gotthilf Schüle in Strassburg i. E. nach seinem durch
Patent 148758 geschützten Verfahren hergestellten künstlichen Steine
werden in der Weise hergestellt, dass Quarz oder andere aus Kieselsäure
bestehende Materialien mit Wasserglaslösung angerührt werden; die Mischung
wird, nachdem sie den richtigen Grad der Trockenheit erlangt hat, zum
Abscheiden der Kieselsäure aus der Wasserglaslösung mit Säure behandelt
und hierauf zur Entfernung der Alkalien mit Wasser ausgewaschen.
Ein anderer künstlicher Stein wird nach dem Patent 151252 von
Karl Groyen in Bonn aus Magnesia, Salzsäure und Füllstoffen erhalten,
wobei die Salzsäure stark konzentriert verwendet und nach geschehener
Einwirkung auf die Magnesia sofort durch einen Ueberschuss von Magnesia,
gegebenenfalls unter Zusatz bekannter Füllstoffe, neutralisiert wird. Neben
Magnesia kann noch Ammoniak zur Neutralisation Anwendung finden.
Karl Schwarz in Berlin stellt Blöcke aus Ku n s tst ein mas s e nach
seinem Patent 144914 her, die nach der Fertigstellung nach Bedarf gespalten
werden. Diese Spaltbarkeit erhält der Block dadurch, dass bei seiner Her-
stellung die Kunststeinmasse in nicht zu feuchtem Zustande in einzelnen
Schichten eingetragen und festgestampft wird, wobei vor Eintragung der
nächsten Schicht die Oberfläche der vorhergehenden Schicht gut geebnet
und durch Glätten dicht gemacht wird, damit die aufeinander folgenden
Schichten sich nicht zu innig berühren und das Spalten leicht und sauber
vor sich geht.
Der K u n s t p f l as t e r s t e i n von Dr. Johann Joseph Niessen in Köln
a. Rh. (D. R. P. 150656) besteht aus gesintertem oder geschmolzenem
Bauxit, einem aus Tonerde, Eisenoxyd und Kieselsäure bestehenden Mineral,
oder einer sonstigen unreinen, natürlichen Tonerde, welche in bekannter
Weise zerkleinert und mit einem Bindemittel, wie Ton, Zement, Asphalt
u. dgl. verformt und gebrannt wird. Ein solcher Pflasterstein ist sehr hart,
besitzt aber eine grosse Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoss
und Schlag und wird ausserdem wegen seiner porösen Struktur nicht glatt.
Häufig kommt man in die Verlegenheit, fertigen Zementbeton auf-
zubewahren. Es ist dies mit Schwierigkeiten verknüpft, da der fertige
Zementbeton bei gewöhnlichen Verhältnissen, sei es an der Luft oder unter
Luftabschluss von seiner Bindefähigkeit erheblich einbüsst, ja dieselbe binnen
kurzer Zeit ganz verliert; der Beton erstarrt.
Jürgen Henrich Magens in Hamburg gibt in seinem Patent 146243 an,
dass die Aufbewahrung und der Versand von fertigem Zementbeton bezw.
Zementmörtel dadurch ermöglicht wird, dass man den Beton bis zum Ge-
frierpunkt und unter denselben abkühlt und in Gefässen oder Waggons
aufbewahrt oder verschickt, welche mit geeigneten Kühl- oder Isoliervor-
kehrungen ausgerüstet sind. Der gefrorene Beton soll nach erfolgtem Auf-
tauen, entgegen der allgemeinen Annahme, nicht allein weiter binden, son-
dern er soll nach längerem Abbinden eine Festigkeit erlangen, welche sich
von derjenigen normal abgebundenen Betons nur wenig unterscheidet. Der
Vorteil der Versendung des Betons besteht darin, dass nach dem neuen
Verfahren auch Beton an beschränkten Stellen Verwendung finden kann,
wo es sonst an dem erforderlichen Platz für Zement, Kies und Steinschlag
fehlt.
Ein Verfahren zum Reinigen von Mauerflächen u. dgl. ist Gegen-
stand des Patentes 14859/. Hiernach wird die zu reinigende Fläche mit
einer chemisch wirksamen Lösung getränkt, durch heisse Dämpfe erwärmt,
abgebürstet und sodann mit reinem Wasser abgespült. In einem die Chemi-
kalien enthaltenden Kasten sind eine Bürste und ein Schaufelrad angeordnet,
welche mittels eines durch Druckwasser getriebenen Wasserrades in Be-
wegung gesetzt werden. Ein in die Bürste ausmündendes Dampfrohr dient
dazu, die zu reinigende Fläche anzuwärmen, während das in den Kasten
eingeführte Druckwasser sowohl zur Auflösung der Chemikalien, als zum
Abspülen der gereinigten Fläche benutzt wird.
Auch zum Anstreichen von Decken und Wänden wird eine
neue maschinelle Einrichtung vorgeschlagen, welche durch Patent 148654
geschützt ist. Die Anstreichflüssigkeit wird von einer Bürstenwalze in
regelbaren Mengen auf radial nachstellbare Pinsel übertragen, die auf einer
in ihrer Entfernung zu der Farbübertragungswalze einstellbaren, von der
letzteren ihren Antrieb erhaltenden Walze befestigt sind.
Bei Dielen aus Gips, Bimsbeton oder dgl. sind Eiseneinlagen
deshalb nicht vorteilhaft zu verwenden, weil dieselben zu schnell rosten
und. brüchig werden. Diesen Übelstand zu beseitigen, und um die zur Er-
höhung der Tragfähigkeit der Diele erforderlichen Eiseneinlagen vorteilhaft
beibehalten zu können, ist nach Patent 149313 ein eisenarmierter Zement-
balken in die Diele eingebettet.
In Glasdachdeckungen wird durch Patent 147796 eine sehr zweck-
mässige Neuerung gebracht. Hiernach ist in den Rand der Glasdachplatte
ein -förmig gebogener Blechrahmen eingelassen, der mit der Drahtgewebe-
einlage der Platte verbunden ist. Die Verbindung der Platten geschieht
durch Ineinanderhaken der Blechrahmen oder durch Überschieben besonders
gestalteter Blechstreiten über die umgebogenen Rahmen.
Eine andere praktische Neuerung in Beschlägen ist das selbstschlics-
sende Fischband nach Patent 151070. Dasselbe ist von derjenigen Art,
welche einen Schraubengang besitzt und bei der am unteren Teile des
Bolzens eine Flüssigkeitshemmung angebracht ist. Nach der Erfindung ist
der mit dem beweglichen Bandteil in fester Verbindung stehende, am
unteren Ende den Bremskolben tragende Banddorn schraubenförmig aus-
gebildet, um die Bremsflüssigkeit gleichzeitig als Schmiermittel für den
Schraubengang dienstbar zu machen.
Beliebig grosse Fenster, Türen u. dgl. werden nach Patent
146964 in folgender Weise schnell angefertigt. Es werden für jede Türform
einer Grössenklasse innere Türteile vorrätig gehalten, welche aus den
Füllungen und einem kehlstossartig ausgebildeten Verbindungsrahmen be-
stehen. Diese Türteile werden je nach den Stichmassen einer Tür ver-
schieden tief in einen äusseren Rahmen wechselnder Breite in bekannter
Weise eingesetzt.
In F e ns t er f ests t e 1 le r n hat sich Karl Hahlweg in Stettin eine
praktische Neuheit durch die Patente Nr. 148058 und Nr. 149131 schützen
lassen. Es sind dies selbsttätige Fensterfeststeller mit am Fenstergewände
befestigtem Reibungsgelenk und in diesem drehbarer Feststellschiene. Das
Reibungsgelenk besitzt zwei Metallplatten, von denen entweder nur eine
oder auch beide hohl getrieben sind. Mittels einer in den die Metallplatten
durchdringenden Vierkantzapfen eingedrehten Klemmschraube werden die
Metallplatten mit der hohlen Seite gegen die beiden Seiten einer am Ende
der Ees stelischiene ausgebildeten flachen Scheibe gedrückt. Dadurch wird
eine regulierbare gleichmässige federnde Reibung erzeugt, die geeignet ist,
den Fensterflügel in jeder beliebigen Stellung festzustellen.
Ein anderer Fensterfeststeller ist durch Patent Nr. 149013 geschützt.
Dieser hat die Form eines an der Fensterzarge angelenkten, als Anschlag
für den geöffneten Fensterflügel wirkenden umlegbaren T-Stückes. Dieses
T-Stück ist behufs Entlastung seines Scharnieres mit einem Steg versehen,
welcher sich beim Gebrauch innen gegen die Fensterzarge anlehnt.
Bei dem Z ugl u f t s c h ü t z e r an Türen nach Patent Nr. 147567 ist
die Dichtungsleiste in kurzen, nebeneinander liegenden federnden Klammern
mit konischem Oberteil gefasst. Diese Klammern werden durch Federn in
der gleichfalls konischen, starren Führungsleiste abwärts gedrückt und halten
die Dichtungsleiste stets am Boden. Hierdurch wird leichte Beweglichkeit
bei guter Abdichtung auf ungleichmässig liegenden Fussböden erreicht.
Um bei Fenstern und Türen einen zugdichten Abschluss zu erzielen, sind
mehrere, allem Anschein nach sehr praktische Neuerungen erfunden worden.
— Nach dem Pat. Nr. 150337 besteht eine Dichtung für Fenster-
und Türbögen aus einer Schraubenfeder, welche mit einem wetterfesten
Tuche umkleidet und vertieft in den Anschlagefalzen angeordnet ist.
Ein Gazefenster, weiches entsprechend der jeweiligen Höhe der
Fensteröffnung nach Art einer Feder ausgezogen und zusammengelegt
werden kann, ist durch Patent 147120 geschützt. Die Gaze ist bei diesem,
aus zwei übereinander liegenden, in wagerechter Richtung gegeneinander
verschiebbaren Teilen bestehenden Gazefenster in der senkrechten Richtung
wellenförmig gebogen, um die federaitige Ausziehbarkeit und Zusammenleg-
barkeit zu erzielen.
Bei dem Betriebe von Aufzügen hat man mit grossem Vorteil die
Elektrizität eingeführt, da die Zuleitung derselben zum Fahrstuhl bezw. zu
dessen Antriebsorganen, seien dieselben mit dem Fahrstuhl selbst verbunden,
oder neben seinem Schacht aufgestellt, eine sehr bequeme ist.
Bei der Anordnung des Motors am Fahrstuhl werden nach dem deut-
schen Patent 123635 von Kaspar Wüst-Kunz in Seebach-Zürich zwei
Trommeln angetrieben, welche zum Aufwinden von Zugseilen dienen, die
im Fahrschacht aufgehängt sind und den Förderkorb tragen. Durch Auf-
wickeln der Seile wird der Korb gehoben, beim Abwickeln gesenkt.
Um mit dieser Einrichtung eine Sicherung zu verbinden, hat Wüst-
Kunz nach seinem Zusatzpatent 149153 auf den Trommelwellen Zahnkränze
aufgesetzt, welche an der Umdrehung der Trommeln teilnehmen. Bei nor-
malem Betriebe greifen diese Kränze mit Spielraum in die Zahnlücken von
Zahnstangen ein, welche in der ganzen Höhe des Fahrstuhlschachtes durch-
geführt sind. Zerreissen die Seile, an denen der Fahrstuhl hängt, so legen
sich die Zahnkränze mit ihren Zähnen auf die Zähne der Zahnstangen, so
dass ein Sturz des Fahrstuhls in die Tiefe des Schachtes vermieden wird.
Nunmehr kann auch weiter die Bewegung des Fahrstuhls ohne Unter-
brechung des Betriebes mittels der Zahnkränze erfolgen, bis eine Pause zur
Nachtzeit eintritt, während welcher die zerrissenen Seile durch andere er-
setzt werden können. Da gerade die Seile dasjenige Organ des Fahrstuhls
sind, welches der Abnutzung am meisten ausgesetzt ist, und eine Unter-
1904, OKTOBER. III. JAHRGANG, HEFT 1.
Berichte über Erfindungen auf dem
Gebiete des Bauwesens.
Erstattet von Patentanwalt Dr. B. Alexander-Katz i. F. Richard Lüders
in Görlitz und Berlin.
(4. Fortsetzung. Vergl. I. Heft 5, S. 33 B.; Heft 9, S. 65 B. — II. Heft 1,
S. 2B.; Heft 5, S. 51 B.)
Die Herstellung von Baumaterialien ist in der Berichtszeit durch
zahlreiche Erfindungen bereichert worden. Das rege Interesse der Erfinder
auf diesem Gebiete zeigt am besten, dass die Neuerungen in der Behand-
lung der Baumaterialien bei ihrer Herstellung und Verwendung, mehr aber
noch der Ersatz der von der Natur gebotenen Rohmaterialien durch künst-
liche Produkte noch lange nicht abgeschlossen sind, vielmehr noch mancherlei
gerade hier erwartet werden muss. Ich greife nur einige Neuerungen aus
den zahlreichen neuen Patenten der einschlägigen Klassen heraus.
Hans Christian Meurer in Charlottenburg gibt in seinem Patent 146240
ein Verfahren zur Herstellung von Mörtelmasse für die Kalksandstein-
fabrikation aus Kalk, Sand und einer genau abgemessenen Menge Wassers
an. Die zur Kalksandsteinfabrikation dienenden pulverförmigen Rohmate-
rialien einerseits und die zur Durchfeuchtung dienende Flüssigkeit anderer-
seits werden, alle drei getrennt, in ununterbrochenem Arbeitsgange durch
unter einander in zwangläufiger Bewegung stehende Vorrichtungen abge-
messen, darauf zusammengeführt und der Mischvorrichtung zugeleitet.
Die von Dr. Gotthilf Schüle in Strassburg i. E. nach seinem durch
Patent 148758 geschützten Verfahren hergestellten künstlichen Steine
werden in der Weise hergestellt, dass Quarz oder andere aus Kieselsäure
bestehende Materialien mit Wasserglaslösung angerührt werden; die Mischung
wird, nachdem sie den richtigen Grad der Trockenheit erlangt hat, zum
Abscheiden der Kieselsäure aus der Wasserglaslösung mit Säure behandelt
und hierauf zur Entfernung der Alkalien mit Wasser ausgewaschen.
Ein anderer künstlicher Stein wird nach dem Patent 151252 von
Karl Groyen in Bonn aus Magnesia, Salzsäure und Füllstoffen erhalten,
wobei die Salzsäure stark konzentriert verwendet und nach geschehener
Einwirkung auf die Magnesia sofort durch einen Ueberschuss von Magnesia,
gegebenenfalls unter Zusatz bekannter Füllstoffe, neutralisiert wird. Neben
Magnesia kann noch Ammoniak zur Neutralisation Anwendung finden.
Karl Schwarz in Berlin stellt Blöcke aus Ku n s tst ein mas s e nach
seinem Patent 144914 her, die nach der Fertigstellung nach Bedarf gespalten
werden. Diese Spaltbarkeit erhält der Block dadurch, dass bei seiner Her-
stellung die Kunststeinmasse in nicht zu feuchtem Zustande in einzelnen
Schichten eingetragen und festgestampft wird, wobei vor Eintragung der
nächsten Schicht die Oberfläche der vorhergehenden Schicht gut geebnet
und durch Glätten dicht gemacht wird, damit die aufeinander folgenden
Schichten sich nicht zu innig berühren und das Spalten leicht und sauber
vor sich geht.
Der K u n s t p f l as t e r s t e i n von Dr. Johann Joseph Niessen in Köln
a. Rh. (D. R. P. 150656) besteht aus gesintertem oder geschmolzenem
Bauxit, einem aus Tonerde, Eisenoxyd und Kieselsäure bestehenden Mineral,
oder einer sonstigen unreinen, natürlichen Tonerde, welche in bekannter
Weise zerkleinert und mit einem Bindemittel, wie Ton, Zement, Asphalt
u. dgl. verformt und gebrannt wird. Ein solcher Pflasterstein ist sehr hart,
besitzt aber eine grosse Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoss
und Schlag und wird ausserdem wegen seiner porösen Struktur nicht glatt.
Häufig kommt man in die Verlegenheit, fertigen Zementbeton auf-
zubewahren. Es ist dies mit Schwierigkeiten verknüpft, da der fertige
Zementbeton bei gewöhnlichen Verhältnissen, sei es an der Luft oder unter
Luftabschluss von seiner Bindefähigkeit erheblich einbüsst, ja dieselbe binnen
kurzer Zeit ganz verliert; der Beton erstarrt.
Jürgen Henrich Magens in Hamburg gibt in seinem Patent 146243 an,
dass die Aufbewahrung und der Versand von fertigem Zementbeton bezw.
Zementmörtel dadurch ermöglicht wird, dass man den Beton bis zum Ge-
frierpunkt und unter denselben abkühlt und in Gefässen oder Waggons
aufbewahrt oder verschickt, welche mit geeigneten Kühl- oder Isoliervor-
kehrungen ausgerüstet sind. Der gefrorene Beton soll nach erfolgtem Auf-
tauen, entgegen der allgemeinen Annahme, nicht allein weiter binden, son-
dern er soll nach längerem Abbinden eine Festigkeit erlangen, welche sich
von derjenigen normal abgebundenen Betons nur wenig unterscheidet. Der
Vorteil der Versendung des Betons besteht darin, dass nach dem neuen
Verfahren auch Beton an beschränkten Stellen Verwendung finden kann,
wo es sonst an dem erforderlichen Platz für Zement, Kies und Steinschlag
fehlt.
Ein Verfahren zum Reinigen von Mauerflächen u. dgl. ist Gegen-
stand des Patentes 14859/. Hiernach wird die zu reinigende Fläche mit
einer chemisch wirksamen Lösung getränkt, durch heisse Dämpfe erwärmt,
abgebürstet und sodann mit reinem Wasser abgespült. In einem die Chemi-
kalien enthaltenden Kasten sind eine Bürste und ein Schaufelrad angeordnet,
welche mittels eines durch Druckwasser getriebenen Wasserrades in Be-
wegung gesetzt werden. Ein in die Bürste ausmündendes Dampfrohr dient
dazu, die zu reinigende Fläche anzuwärmen, während das in den Kasten
eingeführte Druckwasser sowohl zur Auflösung der Chemikalien, als zum
Abspülen der gereinigten Fläche benutzt wird.
Auch zum Anstreichen von Decken und Wänden wird eine
neue maschinelle Einrichtung vorgeschlagen, welche durch Patent 148654
geschützt ist. Die Anstreichflüssigkeit wird von einer Bürstenwalze in
regelbaren Mengen auf radial nachstellbare Pinsel übertragen, die auf einer
in ihrer Entfernung zu der Farbübertragungswalze einstellbaren, von der
letzteren ihren Antrieb erhaltenden Walze befestigt sind.
Bei Dielen aus Gips, Bimsbeton oder dgl. sind Eiseneinlagen
deshalb nicht vorteilhaft zu verwenden, weil dieselben zu schnell rosten
und. brüchig werden. Diesen Übelstand zu beseitigen, und um die zur Er-
höhung der Tragfähigkeit der Diele erforderlichen Eiseneinlagen vorteilhaft
beibehalten zu können, ist nach Patent 149313 ein eisenarmierter Zement-
balken in die Diele eingebettet.
In Glasdachdeckungen wird durch Patent 147796 eine sehr zweck-
mässige Neuerung gebracht. Hiernach ist in den Rand der Glasdachplatte
ein -förmig gebogener Blechrahmen eingelassen, der mit der Drahtgewebe-
einlage der Platte verbunden ist. Die Verbindung der Platten geschieht
durch Ineinanderhaken der Blechrahmen oder durch Überschieben besonders
gestalteter Blechstreiten über die umgebogenen Rahmen.
Eine andere praktische Neuerung in Beschlägen ist das selbstschlics-
sende Fischband nach Patent 151070. Dasselbe ist von derjenigen Art,
welche einen Schraubengang besitzt und bei der am unteren Teile des
Bolzens eine Flüssigkeitshemmung angebracht ist. Nach der Erfindung ist
der mit dem beweglichen Bandteil in fester Verbindung stehende, am
unteren Ende den Bremskolben tragende Banddorn schraubenförmig aus-
gebildet, um die Bremsflüssigkeit gleichzeitig als Schmiermittel für den
Schraubengang dienstbar zu machen.
Beliebig grosse Fenster, Türen u. dgl. werden nach Patent
146964 in folgender Weise schnell angefertigt. Es werden für jede Türform
einer Grössenklasse innere Türteile vorrätig gehalten, welche aus den
Füllungen und einem kehlstossartig ausgebildeten Verbindungsrahmen be-
stehen. Diese Türteile werden je nach den Stichmassen einer Tür ver-
schieden tief in einen äusseren Rahmen wechselnder Breite in bekannter
Weise eingesetzt.
In F e ns t er f ests t e 1 le r n hat sich Karl Hahlweg in Stettin eine
praktische Neuheit durch die Patente Nr. 148058 und Nr. 149131 schützen
lassen. Es sind dies selbsttätige Fensterfeststeller mit am Fenstergewände
befestigtem Reibungsgelenk und in diesem drehbarer Feststellschiene. Das
Reibungsgelenk besitzt zwei Metallplatten, von denen entweder nur eine
oder auch beide hohl getrieben sind. Mittels einer in den die Metallplatten
durchdringenden Vierkantzapfen eingedrehten Klemmschraube werden die
Metallplatten mit der hohlen Seite gegen die beiden Seiten einer am Ende
der Ees stelischiene ausgebildeten flachen Scheibe gedrückt. Dadurch wird
eine regulierbare gleichmässige federnde Reibung erzeugt, die geeignet ist,
den Fensterflügel in jeder beliebigen Stellung festzustellen.
Ein anderer Fensterfeststeller ist durch Patent Nr. 149013 geschützt.
Dieser hat die Form eines an der Fensterzarge angelenkten, als Anschlag
für den geöffneten Fensterflügel wirkenden umlegbaren T-Stückes. Dieses
T-Stück ist behufs Entlastung seines Scharnieres mit einem Steg versehen,
welcher sich beim Gebrauch innen gegen die Fensterzarge anlehnt.
Bei dem Z ugl u f t s c h ü t z e r an Türen nach Patent Nr. 147567 ist
die Dichtungsleiste in kurzen, nebeneinander liegenden federnden Klammern
mit konischem Oberteil gefasst. Diese Klammern werden durch Federn in
der gleichfalls konischen, starren Führungsleiste abwärts gedrückt und halten
die Dichtungsleiste stets am Boden. Hierdurch wird leichte Beweglichkeit
bei guter Abdichtung auf ungleichmässig liegenden Fussböden erreicht.
Um bei Fenstern und Türen einen zugdichten Abschluss zu erzielen, sind
mehrere, allem Anschein nach sehr praktische Neuerungen erfunden worden.
— Nach dem Pat. Nr. 150337 besteht eine Dichtung für Fenster-
und Türbögen aus einer Schraubenfeder, welche mit einem wetterfesten
Tuche umkleidet und vertieft in den Anschlagefalzen angeordnet ist.
Ein Gazefenster, weiches entsprechend der jeweiligen Höhe der
Fensteröffnung nach Art einer Feder ausgezogen und zusammengelegt
werden kann, ist durch Patent 147120 geschützt. Die Gaze ist bei diesem,
aus zwei übereinander liegenden, in wagerechter Richtung gegeneinander
verschiebbaren Teilen bestehenden Gazefenster in der senkrechten Richtung
wellenförmig gebogen, um die federaitige Ausziehbarkeit und Zusammenleg-
barkeit zu erzielen.
Bei dem Betriebe von Aufzügen hat man mit grossem Vorteil die
Elektrizität eingeführt, da die Zuleitung derselben zum Fahrstuhl bezw. zu
dessen Antriebsorganen, seien dieselben mit dem Fahrstuhl selbst verbunden,
oder neben seinem Schacht aufgestellt, eine sehr bequeme ist.
Bei der Anordnung des Motors am Fahrstuhl werden nach dem deut-
schen Patent 123635 von Kaspar Wüst-Kunz in Seebach-Zürich zwei
Trommeln angetrieben, welche zum Aufwinden von Zugseilen dienen, die
im Fahrschacht aufgehängt sind und den Förderkorb tragen. Durch Auf-
wickeln der Seile wird der Korb gehoben, beim Abwickeln gesenkt.
Um mit dieser Einrichtung eine Sicherung zu verbinden, hat Wüst-
Kunz nach seinem Zusatzpatent 149153 auf den Trommelwellen Zahnkränze
aufgesetzt, welche an der Umdrehung der Trommeln teilnehmen. Bei nor-
malem Betriebe greifen diese Kränze mit Spielraum in die Zahnlücken von
Zahnstangen ein, welche in der ganzen Höhe des Fahrstuhlschachtes durch-
geführt sind. Zerreissen die Seile, an denen der Fahrstuhl hängt, so legen
sich die Zahnkränze mit ihren Zähnen auf die Zähne der Zahnstangen, so
dass ein Sturz des Fahrstuhls in die Tiefe des Schachtes vermieden wird.
Nunmehr kann auch weiter die Bewegung des Fahrstuhls ohne Unter-
brechung des Betriebes mittels der Zahnkränze erfolgen, bis eine Pause zur
Nachtzeit eintritt, während welcher die zerrissenen Seile durch andere er-
setzt werden können. Da gerade die Seile dasjenige Organ des Fahrstuhls
sind, welches der Abnutzung am meisten ausgesetzt ist, und eine Unter-