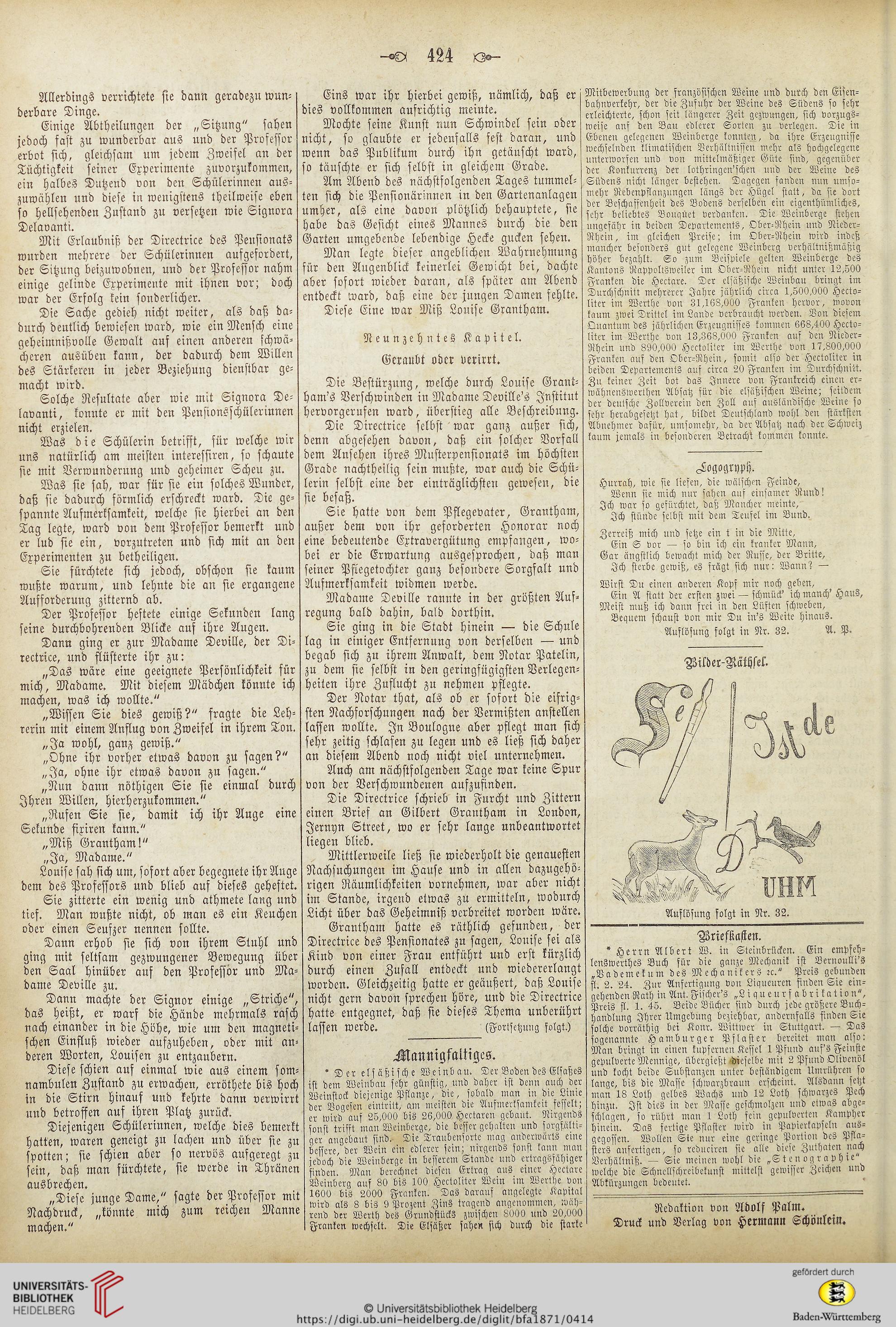-o 424 <Z^-
Allerdings verrichtete sie dann geradezu wun-
derbare Dinge.
Einige Abtheilungen der „Sitzung" sahen
jedoch fast zu wunderbar aus und der Professor
erbot sich, gleichsam um jedem Zweifel an der
Tüchtigkeit seiner Experimente zuvorzukommen,
ein halbes Dutzend von den Schülerinnen aus-
zuwählen und diese in wenigstens theilweise eben
so hellsehenden Zustand zu versetzen wie Signora
Delavanti.
Mit Erlaubnis der Directrice des Pensionats
wurden mehrere der Schülerinnen aufgefordert,
der Sitzung beizuwobnen, und der Professor nahm
einige gelinde Experimente mit ihnen vor; doch
war der Erfolg kein sonderlicher.
Die Sache gedieh nicht weiter, als daß da-
durch deutlich bewiesen ward, wie ein Mensch eine
geheimnisvolle Gewalt auf einen anderen schwä-
cheren ausüben kann, der dadurch dem Willen
des Stärkeren in jeder Beziehung dienstbar ge-
macht wird.
Solche Resultate aber wie mit Signora De-
lavanti, konnte er mit den Pensionsschülerinnen
nicht erzielen.
Was die Schülerin betrifft, für welche wir
uns natürlich am meisten interessiren, so schaute
sie mit Verwunderung und geheimer Scheu zu.
Was sie sah, war für sie ein solches Wunder,
daß sie dadurch förmlich erschreckt ward. Die ge-
spannte Aufmerksamkeit, welche sie hierbei an den
Tag legte, ward von dem Professor bemerkt und
er lud sie ein, vorzutreten und sich mit an den
Experimenten zu betheiligen.
Sie fürchtete sich jedoch, obschon sie kaum
wußte warum, und lehnte die an sie ergangene
Aufforderung zitternd ab.
Der Professor heftete einige Sekunden lang
seine durchbohrenden Blicke auf ihre Augen.
Dann ging er zur Madame Deville, der Di-
rectrice, und flüsterte ihr zu:
„Das wäre eine geeignete Persönlichkeit für
mich, Madame. Mit diesem Mädchen könnte ich
machen, was ich wollte."
„Wissen Sie dies gewiß?" fragte die Leh-
rerin mit einem Anflug von Zweifel in ihrem Ton.
„Ja wohl, ganz gewiß."
„Ohne ihr vorher etwas davon zu sagen?"
„Ja, ohne ihr etwas davon zu sagen."
„Nun dann nöthigen Sie sie einmal durch
Ihren Willen, hierherzukommen."
„Rufen Sie sie, damit ich ihr Auge eine
Sekunde sixiren kann."
„Miß Grantham!"
„Ja, Madame."
Louise sah sich um, sofort aber begegnete ihr Auge
dem des Professors und blieb auf dieses geheftet.
Sie zitterte ein wenig und athmete lang und
tief. Man wußte nicht, ob man es ein Keuchen
oder einen Seufzer nennen sollte.
Dann erhob sie sich von ihrem Stuhl und
ging mit seltsam gezwungener Bewegung über
den Saal hinüber auf den Professor und Ma-
dame Deville zu.
Dann machte der Signor einige „Striche",
das heißt, er warf die Hände mehrmals rasch
nach einander in die Höhe, wie um den magneti-
schen Einfluß wieder aufzuheben, oder mit an-
deren Worten, Louisen zu entzaubern.
Diese schien auf einmal wie aus einem som-
nambulen Zustand zu erwachen, erröthete bis hoch
in die Stirn hinauf und kehrte dann verwirrt
und betroffen auf ihren Platz zurück.
Diejenigen Schülerinnen, welche dies bemerkt
hatten, waren geneigt zu lachen und über sie zu
spotten; sie schien aber so nervös aufgeregt zu
sein, daß man fürchtete, sie werde in Thränen
ausbrechen.
„Diese junge Dame," sagte der Professor mit
Nachdruck, „könnte mich zum reichen Manne
machen."
Eins war ihr hierbei gewiß, nämlich, daß er
dies vollkommen aufrichtig meinte.
Mochte seine Kunst nun Schwindel sein oder
nicht, so glaubte er jedenfalls fest daran, und
wenn das Publikum durch ihn getäuscht ward,
so täuschte er sich selbst in gleichem Grade.
Am Abend des nächstfolgenden Tages tummel-
ten sich die Pensionärinnen in den Gartenanlagen
umher, als eine davon plötzlich behauptete, sie
habe das Gesicht eines Mannes durch die den
Garten umgebende lebendige Hecke gucken sehen.
Man legte dieser angeblichen Wahrnehmung
für den Augenblick keinerlei Gewicht bei, dachte
aber sofort wieder daran, als später am Abend
entdeckt ward, daß eine der jungen Damen fehlte.
Diese Eine war Miß Louise Grantham.
Neunzehntes Kapitel.
Geraubt oder verirrt.
Die Bestürzung, welche durch Louise Grant-
Hansis Verschwinden in Madame Deville's Institut
hervorgerufen ward, überstieg alle Beschreibung.
Die Directrice selbst war ganz außer sich,
denn abgesehen davon, daß ein solcher Vorfall
dem Ansehen ihres Musterpensionats im höchsten
Grade nachtheilig sein mußte, war auch die Schü-
lerin selbst eine der einträglichsten gewesen, die
sie besaß.
Sie hatte von dem Pflegevater, Grantham,
außer dem von ihr geforderten Honorar noch
eine bedeutende Extravergütung empfangen, wo-
bei er die Erwartung ausgesprochen, daß man
feiner Pflegetochter ganz besondere Sorgfalt und
Aufmerksamkeit widmen werde.
Madame Deville rannte in der größten Auf-
regung bald dahin, bald dorthin.
Sie ging in die Stadt hinein — die Schule
lag in einiger Entfernung von derselben — und
begab sich zu ihrem Anwalt, dem Notar Patelin,
zu dem sie selbst in den geringfügigsten Verlegen-
heiten ihre Zuflucht zu nehmen pflegte.
Der Notar that, als ob er sofort die eifrig-
sten Nachforschungen nach der Vermißten anstellen
lassen wollte. In Boulogne aber pflegt man sich
sehr zeitig schlafen zu legen und es ließ sich daher
an diesem Abend noch nicht viel unternehmen.
Auch am nächstfolgenden Tage war keine Spur
von der Verschwundenen aufzufinden.
Die Directrice schrieb in Furcht und Zittern
einen Bries an Gilbert Grantham in London,
Jernpn Street, wo er sehr lange unbeantwortet
liegen blieb.
Mittlerweile ließ sie wiederholt die genauesten
Nachsuchungen im Hause und in allen dazugehö-
rigen Räumlichkeiten vornehmen, war aber nicht
im Stande, irgend etwas zu ermitteln, wodurch
Licht über das Geheimniß verbreitet worden wäre.
Grantham hatte es räthlich gefunden, der
Directrice des Pensionates zu sagen, Louise sei als
Kind von einer Frau entführt und erst kürzlich
durch einen Zufall entdeckt und wiedererlangt
worden. Gleichzeitig hatte er geäußert, daß Louise
nicht gern davon sprechen höre, und die Directrice
hatte entgegnet, daß sie dieses Thema unberührt
lasten werde. (Fortsetzung folgt.)
Mannigfaltiges.
' Der elsüßische Weinbau. Der Boden des Elsaßes
ist dem Weinbau sehr günstig, und daher ist denn auch der
Weinstock diejenige Pflanze, die, sobald man in die Linie
der Vogesen eintritt, am meisten die Aufmerksamkeit fesselt;
er wird auf 25,000 bis 26,000 Hektaren gebaut. Nirgends
sonst trifft man Weinberge, die besser gehalten und sorgfälti-
ger angcbaut sind. Die Traubensortc mag anderwärts eine
bessere, der Wein ein edlerer fein; nirgends fonst kann man
jedoch die Weinberge in besserem Stande und crtragsfähiger
finden. Man berechnet diesen Ertrag aus einer Hcctarc
TÜcinberg auf 80 bis 100 Hectoliter Wein im Werthe don
1600 bis 2000 Franken. Das daranf angelegte Kapital
wird als 8 bis 9 Prozent Zins tragend angenommen, wäh-
rend der Werth des Grundstücks zwischen 8000 und 20,000
Franken wechselt. Die Elsäßer sahen sich durch die starke
Mitbewerbung der französischen Weine und durch den Eisen-
bahnverkehr, der die Zufuhr der Weine des Südens so sehr
erleichterte, schon seit längerer Zeit gezwungen, sich vorzugs-
weise ans den Bau edlerer Sorten zu verlegen. Die in
Ebenen gelegenen Weinberge konnten, da ihre Erzeugnisse
wechselnden klimatischen Verhältnissen mehr als hochgelegene
unterworfen und von mittelmäßiger Güte sind, gegenüber
der Konkurrenz der lothringcn'schen und der Weine des
Südens nicht länger bestehen. Dagegen fanden nun umso-
mehr Rebcnpflanzungen längs der Hügel statt, da sie dort
der Beschaffenheit des Bodens derselben ein eigenthümliches,
sehr beliebtes Bouquet verdanken. Die Weinberge stehen
ungefähr in beiden Departements, Ober-Rhein und Nieder-
Rhcin, im gleichen Preise; im Ober-Rhein wird indcß
mancher besonders gut gelegene Weinberg verhältnißmäßig
höher bezahlt. So zum Beispiele gelten Weinberge des
Kantons Rappollsweiler im Ober-Rhein nicht unter 12,500
Franken die Hectare. Der elsüßische Weinbau bringt im
Durchschnitt mehrerer Jahre jährlich circa 1,500,000 Hecto-
liter im Werthe von 81,168,000 Franken hervor, wovon
kaum zwei Drittel im Lande verbraucht werden. Von diesem
Quantum des jährlichen Erzeugnisses kommen 668,400 Hecto-
liter im Werthe von 13,368,000 Franken auf den Nieder-
Nhein und 890,000 Hectoliter im Werthe von 17,800,000
Franken auf den Ober-Rhein, fomit also der Hectoliter in
beiden Departements auf circa 20 Franken im Durchschnitt.
Zn keiner Zeit bot das Innere von Frankreich einen er-
wähnenswerthcn Absatz für die elfäßischen Weine; seitdem
der deutsche Zollverein den Zoll auf ausländische Weine so
sehr herabgesetzt hat, bildet Deutschland wohl den stärksten
Abnehmer dafür, umsomehr, da der Absatz nach der Schweiz
kaum jemals in besonderen Betracht kommen konnte.
<Logogrypß.
Hurrah, wie sie liefen, die wälschen Feinde,
Wenn sie mich nur sahen auf einsamer Rund!
Ich war so gefürchtet, daß Mancher meinte.
Ich stünde selbst mit dem Teufel im Bund.
Zerreiß mich und setze ein t in die Mitte,
Ein S vor — so bin ich ein kranker Mann,
Gar ängstlich bewacht mich der Russe, der Dritte,
Ich sterbe gewiß, es frägt sich nur: Wann? —
Wirst Du einen anderen Kopf mir noch geben,
Ein A statt der ersten zwei — schmück' ich manch' Haus,
Meist muß ich dann frei in den Lüften schweben.
Bequem schaust von mir Du in's Weite hinaus.
Auflösung folgt in Nr. 32. A. P.
Mtter-UäLM.
Auflösung folgt in Nr. 32.
Briefkasten.
* Herrn Albert W. in Steinbrückcn. Ein empfeh-
lenswertstes Buch für die ganze Mechanik ist Bernoulli's
„Vademekum des Mechanikers rc." Preis gebunden
fl, 2. 24. Zur Anfertigung von Liqncurcn finden Sie ein-
gehenden Rath in Ant. Fischer's „L i q u e u r f a b ri kat io n",
Preis fl. 1. 45. Beide Bücher sind durch jede größere Buch-
handlung Ihrer Umgebung beziehbar, andernfalls finden Sie
solche vorräthig bei Konr. Wittwer in Stuttgart. — Das
sogenannte Hamburger Pflaster bereitet man also:
Man bringt in einen kupfernen Kessel 1 Pfund auf's Feinste
gepulverte Mennige, übergießt dieselbe mit 2 Pfund Olivenöl
und kocht beide Substanzen unter beständigem Umrühren so
lange, bis die Masse schwarzbraun erscheint. Alsdann setzt
man 18 Loth gelbes Wachs und 12 Loth schwarzes Pech
hinzu. Ist dies in der Masse geschmolzen und etwas abge-
schlagen, so rührt man 1 Loth fein gepulverten Kamphcr
hinein. Das fertige Pflaster wird in Papicrkapscln aus-
gegossen. Wollen Sie nur eine geringe Portion des Pfla-
sters anfcrtigen, so rcducircn sie alle diese Zuthatcn nach
Verhältnis;. — Sie meinen wohl die „Stenographie"
welche die Schnellschreibckunst mittelst gewisser Zeichen und
Abkürzungen bedeutet.
Redaktion von Adolf Palm.
Druck und Verlag von Hermann Schönlein.
Allerdings verrichtete sie dann geradezu wun-
derbare Dinge.
Einige Abtheilungen der „Sitzung" sahen
jedoch fast zu wunderbar aus und der Professor
erbot sich, gleichsam um jedem Zweifel an der
Tüchtigkeit seiner Experimente zuvorzukommen,
ein halbes Dutzend von den Schülerinnen aus-
zuwählen und diese in wenigstens theilweise eben
so hellsehenden Zustand zu versetzen wie Signora
Delavanti.
Mit Erlaubnis der Directrice des Pensionats
wurden mehrere der Schülerinnen aufgefordert,
der Sitzung beizuwobnen, und der Professor nahm
einige gelinde Experimente mit ihnen vor; doch
war der Erfolg kein sonderlicher.
Die Sache gedieh nicht weiter, als daß da-
durch deutlich bewiesen ward, wie ein Mensch eine
geheimnisvolle Gewalt auf einen anderen schwä-
cheren ausüben kann, der dadurch dem Willen
des Stärkeren in jeder Beziehung dienstbar ge-
macht wird.
Solche Resultate aber wie mit Signora De-
lavanti, konnte er mit den Pensionsschülerinnen
nicht erzielen.
Was die Schülerin betrifft, für welche wir
uns natürlich am meisten interessiren, so schaute
sie mit Verwunderung und geheimer Scheu zu.
Was sie sah, war für sie ein solches Wunder,
daß sie dadurch förmlich erschreckt ward. Die ge-
spannte Aufmerksamkeit, welche sie hierbei an den
Tag legte, ward von dem Professor bemerkt und
er lud sie ein, vorzutreten und sich mit an den
Experimenten zu betheiligen.
Sie fürchtete sich jedoch, obschon sie kaum
wußte warum, und lehnte die an sie ergangene
Aufforderung zitternd ab.
Der Professor heftete einige Sekunden lang
seine durchbohrenden Blicke auf ihre Augen.
Dann ging er zur Madame Deville, der Di-
rectrice, und flüsterte ihr zu:
„Das wäre eine geeignete Persönlichkeit für
mich, Madame. Mit diesem Mädchen könnte ich
machen, was ich wollte."
„Wissen Sie dies gewiß?" fragte die Leh-
rerin mit einem Anflug von Zweifel in ihrem Ton.
„Ja wohl, ganz gewiß."
„Ohne ihr vorher etwas davon zu sagen?"
„Ja, ohne ihr etwas davon zu sagen."
„Nun dann nöthigen Sie sie einmal durch
Ihren Willen, hierherzukommen."
„Rufen Sie sie, damit ich ihr Auge eine
Sekunde sixiren kann."
„Miß Grantham!"
„Ja, Madame."
Louise sah sich um, sofort aber begegnete ihr Auge
dem des Professors und blieb auf dieses geheftet.
Sie zitterte ein wenig und athmete lang und
tief. Man wußte nicht, ob man es ein Keuchen
oder einen Seufzer nennen sollte.
Dann erhob sie sich von ihrem Stuhl und
ging mit seltsam gezwungener Bewegung über
den Saal hinüber auf den Professor und Ma-
dame Deville zu.
Dann machte der Signor einige „Striche",
das heißt, er warf die Hände mehrmals rasch
nach einander in die Höhe, wie um den magneti-
schen Einfluß wieder aufzuheben, oder mit an-
deren Worten, Louisen zu entzaubern.
Diese schien auf einmal wie aus einem som-
nambulen Zustand zu erwachen, erröthete bis hoch
in die Stirn hinauf und kehrte dann verwirrt
und betroffen auf ihren Platz zurück.
Diejenigen Schülerinnen, welche dies bemerkt
hatten, waren geneigt zu lachen und über sie zu
spotten; sie schien aber so nervös aufgeregt zu
sein, daß man fürchtete, sie werde in Thränen
ausbrechen.
„Diese junge Dame," sagte der Professor mit
Nachdruck, „könnte mich zum reichen Manne
machen."
Eins war ihr hierbei gewiß, nämlich, daß er
dies vollkommen aufrichtig meinte.
Mochte seine Kunst nun Schwindel sein oder
nicht, so glaubte er jedenfalls fest daran, und
wenn das Publikum durch ihn getäuscht ward,
so täuschte er sich selbst in gleichem Grade.
Am Abend des nächstfolgenden Tages tummel-
ten sich die Pensionärinnen in den Gartenanlagen
umher, als eine davon plötzlich behauptete, sie
habe das Gesicht eines Mannes durch die den
Garten umgebende lebendige Hecke gucken sehen.
Man legte dieser angeblichen Wahrnehmung
für den Augenblick keinerlei Gewicht bei, dachte
aber sofort wieder daran, als später am Abend
entdeckt ward, daß eine der jungen Damen fehlte.
Diese Eine war Miß Louise Grantham.
Neunzehntes Kapitel.
Geraubt oder verirrt.
Die Bestürzung, welche durch Louise Grant-
Hansis Verschwinden in Madame Deville's Institut
hervorgerufen ward, überstieg alle Beschreibung.
Die Directrice selbst war ganz außer sich,
denn abgesehen davon, daß ein solcher Vorfall
dem Ansehen ihres Musterpensionats im höchsten
Grade nachtheilig sein mußte, war auch die Schü-
lerin selbst eine der einträglichsten gewesen, die
sie besaß.
Sie hatte von dem Pflegevater, Grantham,
außer dem von ihr geforderten Honorar noch
eine bedeutende Extravergütung empfangen, wo-
bei er die Erwartung ausgesprochen, daß man
feiner Pflegetochter ganz besondere Sorgfalt und
Aufmerksamkeit widmen werde.
Madame Deville rannte in der größten Auf-
regung bald dahin, bald dorthin.
Sie ging in die Stadt hinein — die Schule
lag in einiger Entfernung von derselben — und
begab sich zu ihrem Anwalt, dem Notar Patelin,
zu dem sie selbst in den geringfügigsten Verlegen-
heiten ihre Zuflucht zu nehmen pflegte.
Der Notar that, als ob er sofort die eifrig-
sten Nachforschungen nach der Vermißten anstellen
lassen wollte. In Boulogne aber pflegt man sich
sehr zeitig schlafen zu legen und es ließ sich daher
an diesem Abend noch nicht viel unternehmen.
Auch am nächstfolgenden Tage war keine Spur
von der Verschwundenen aufzufinden.
Die Directrice schrieb in Furcht und Zittern
einen Bries an Gilbert Grantham in London,
Jernpn Street, wo er sehr lange unbeantwortet
liegen blieb.
Mittlerweile ließ sie wiederholt die genauesten
Nachsuchungen im Hause und in allen dazugehö-
rigen Räumlichkeiten vornehmen, war aber nicht
im Stande, irgend etwas zu ermitteln, wodurch
Licht über das Geheimniß verbreitet worden wäre.
Grantham hatte es räthlich gefunden, der
Directrice des Pensionates zu sagen, Louise sei als
Kind von einer Frau entführt und erst kürzlich
durch einen Zufall entdeckt und wiedererlangt
worden. Gleichzeitig hatte er geäußert, daß Louise
nicht gern davon sprechen höre, und die Directrice
hatte entgegnet, daß sie dieses Thema unberührt
lasten werde. (Fortsetzung folgt.)
Mannigfaltiges.
' Der elsüßische Weinbau. Der Boden des Elsaßes
ist dem Weinbau sehr günstig, und daher ist denn auch der
Weinstock diejenige Pflanze, die, sobald man in die Linie
der Vogesen eintritt, am meisten die Aufmerksamkeit fesselt;
er wird auf 25,000 bis 26,000 Hektaren gebaut. Nirgends
sonst trifft man Weinberge, die besser gehalten und sorgfälti-
ger angcbaut sind. Die Traubensortc mag anderwärts eine
bessere, der Wein ein edlerer fein; nirgends fonst kann man
jedoch die Weinberge in besserem Stande und crtragsfähiger
finden. Man berechnet diesen Ertrag aus einer Hcctarc
TÜcinberg auf 80 bis 100 Hectoliter Wein im Werthe don
1600 bis 2000 Franken. Das daranf angelegte Kapital
wird als 8 bis 9 Prozent Zins tragend angenommen, wäh-
rend der Werth des Grundstücks zwischen 8000 und 20,000
Franken wechselt. Die Elsäßer sahen sich durch die starke
Mitbewerbung der französischen Weine und durch den Eisen-
bahnverkehr, der die Zufuhr der Weine des Südens so sehr
erleichterte, schon seit längerer Zeit gezwungen, sich vorzugs-
weise ans den Bau edlerer Sorten zu verlegen. Die in
Ebenen gelegenen Weinberge konnten, da ihre Erzeugnisse
wechselnden klimatischen Verhältnissen mehr als hochgelegene
unterworfen und von mittelmäßiger Güte sind, gegenüber
der Konkurrenz der lothringcn'schen und der Weine des
Südens nicht länger bestehen. Dagegen fanden nun umso-
mehr Rebcnpflanzungen längs der Hügel statt, da sie dort
der Beschaffenheit des Bodens derselben ein eigenthümliches,
sehr beliebtes Bouquet verdanken. Die Weinberge stehen
ungefähr in beiden Departements, Ober-Rhein und Nieder-
Rhcin, im gleichen Preise; im Ober-Rhein wird indcß
mancher besonders gut gelegene Weinberg verhältnißmäßig
höher bezahlt. So zum Beispiele gelten Weinberge des
Kantons Rappollsweiler im Ober-Rhein nicht unter 12,500
Franken die Hectare. Der elsüßische Weinbau bringt im
Durchschnitt mehrerer Jahre jährlich circa 1,500,000 Hecto-
liter im Werthe von 81,168,000 Franken hervor, wovon
kaum zwei Drittel im Lande verbraucht werden. Von diesem
Quantum des jährlichen Erzeugnisses kommen 668,400 Hecto-
liter im Werthe von 13,368,000 Franken auf den Nieder-
Nhein und 890,000 Hectoliter im Werthe von 17,800,000
Franken auf den Ober-Rhein, fomit also der Hectoliter in
beiden Departements auf circa 20 Franken im Durchschnitt.
Zn keiner Zeit bot das Innere von Frankreich einen er-
wähnenswerthcn Absatz für die elfäßischen Weine; seitdem
der deutsche Zollverein den Zoll auf ausländische Weine so
sehr herabgesetzt hat, bildet Deutschland wohl den stärksten
Abnehmer dafür, umsomehr, da der Absatz nach der Schweiz
kaum jemals in besonderen Betracht kommen konnte.
<Logogrypß.
Hurrah, wie sie liefen, die wälschen Feinde,
Wenn sie mich nur sahen auf einsamer Rund!
Ich war so gefürchtet, daß Mancher meinte.
Ich stünde selbst mit dem Teufel im Bund.
Zerreiß mich und setze ein t in die Mitte,
Ein S vor — so bin ich ein kranker Mann,
Gar ängstlich bewacht mich der Russe, der Dritte,
Ich sterbe gewiß, es frägt sich nur: Wann? —
Wirst Du einen anderen Kopf mir noch geben,
Ein A statt der ersten zwei — schmück' ich manch' Haus,
Meist muß ich dann frei in den Lüften schweben.
Bequem schaust von mir Du in's Weite hinaus.
Auflösung folgt in Nr. 32. A. P.
Mtter-UäLM.
Auflösung folgt in Nr. 32.
Briefkasten.
* Herrn Albert W. in Steinbrückcn. Ein empfeh-
lenswertstes Buch für die ganze Mechanik ist Bernoulli's
„Vademekum des Mechanikers rc." Preis gebunden
fl, 2. 24. Zur Anfertigung von Liqncurcn finden Sie ein-
gehenden Rath in Ant. Fischer's „L i q u e u r f a b ri kat io n",
Preis fl. 1. 45. Beide Bücher sind durch jede größere Buch-
handlung Ihrer Umgebung beziehbar, andernfalls finden Sie
solche vorräthig bei Konr. Wittwer in Stuttgart. — Das
sogenannte Hamburger Pflaster bereitet man also:
Man bringt in einen kupfernen Kessel 1 Pfund auf's Feinste
gepulverte Mennige, übergießt dieselbe mit 2 Pfund Olivenöl
und kocht beide Substanzen unter beständigem Umrühren so
lange, bis die Masse schwarzbraun erscheint. Alsdann setzt
man 18 Loth gelbes Wachs und 12 Loth schwarzes Pech
hinzu. Ist dies in der Masse geschmolzen und etwas abge-
schlagen, so rührt man 1 Loth fein gepulverten Kamphcr
hinein. Das fertige Pflaster wird in Papicrkapscln aus-
gegossen. Wollen Sie nur eine geringe Portion des Pfla-
sters anfcrtigen, so rcducircn sie alle diese Zuthatcn nach
Verhältnis;. — Sie meinen wohl die „Stenographie"
welche die Schnellschreibckunst mittelst gewisser Zeichen und
Abkürzungen bedeutet.
Redaktion von Adolf Palm.
Druck und Verlag von Hermann Schönlein.