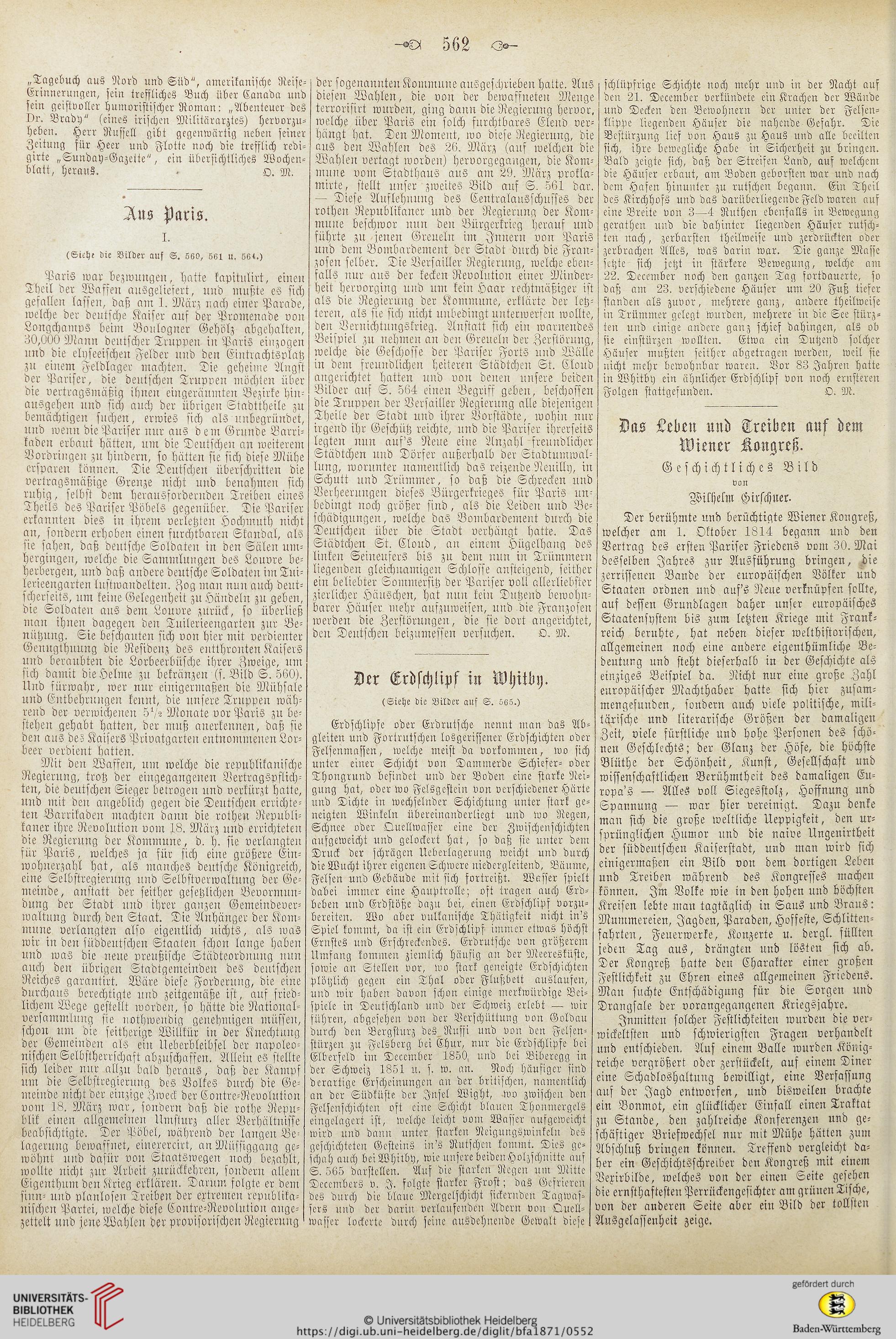562
„Tngebuch aus Nord und Süd", amerikanische Reise-
Erinnerungen, sein treffliches Buch über Canada und
sein geistvoller humoristischer Roman: „Abenteuer des
k^r. Brady" (eines irischen Militärarztes) hervorzu-
heben. Herr Russell gibt gegenwärtig neben seiner
Zeitung für Heer und Flotte noch die trefflich redi-
girte „Sunday-Gazette", ein übersichtliches Wochen-
blatt, heraus. . O. M.
Fns Paris.
i.
(Siehr die Bilder auf S. 5K0, S6r u. 58t.)
Paris war bezwungen, hatte kapitnlirt, einen
Theil der Waffen ansgetiesert, und mußte es sich
gefallen lassen, daß am 1. Marz nach einer Parade,
welche der deutsche Kaiser auf der Promenade von
Longchamvs beim Bonlogner Gehölz abgehalten,
60,000 Mann deutscher Truppen in Paris eiuzogen
und die elyseeischen Felder rind den Eintrachtsplatz
zu einem Feldlager machten. Die geheime Angst
der Pariser, die deutschen Truppen möchten über
die vertragsmäßig ihnen eingeräumten Bezirke hin-
ausgehen und sich auch der übrigen Stadttheile zu
bemächtigen suchen, erwies sich als unbegründet,
und wenn die Pariser nur aus dem Grunde Barri-
kaden erbaut hätten, um die Deutschen an weiterem
Vordringen zu hindern, so Hütten sie sich diese Mühe
ersparen können. Tie Deutschen überschritten die
vertragsmäßige Grenze nicht und benahmen sich
ruhig, selbst dem herausfordernden Treiben eines
Theils des Pariser Pöbels gegenüber. Die Pariser
erkannten dies in ihrem verletzten Hochmuth nicht
an, sondern erhoben einen furchtbaren Skandal, als
sie sahen, daß deutsche Soldaten in den Sälen um-
hergingen, welche die Sammlungen des Louvre be-
herbergen, und daß andere deutsche Soldaten im Tni-
lerieengarten lustwandelten. Fog man nun auch deut-
scherseits, um keine Gelegenheit zu Händeln zu geben,
die Soldaten aus dem Louvre zurück, so überließ
man ihnen, dagegen den Tuilerieengarten zur Be-
nützung. Sie beschauten sich von hier mit verdienter
Geuugthuung die Residenz des entthronten Kaisers
und beraubten die Lorbeerbüsche ihrer Zweige, um
sich damit die Helme zu bekränzen (s. Bild S. 560).
Und fürwahr, wer nur einigermaßen die Muhsale
und Entbehrungen kennt, die unsere Truppen wäh-
rend der verwichenen 5ffs Monate vor Paris zu be-
stehen gehabt hatten, der muß anerkennen, daß sie
den aus des Kaisers Privatgarten entnommenen Lor-
beer verdient hatten.
Mit den Waffen, um welche die republikanische
Regierung, trotz der eingegangenen Vertragspflich-
ten, die deutschen Sieger betrogen und verkürzt hatte,
und mit den angeblich gegen die Deutschen errichte-
ten Barrikaden machten dann die rothen Republi-
kaner ihre Revolution vom 18. März und errichteten
die Negierung der Kommune, d. h. sie verlangten
für Paris, welches ja für sich eine größere Ein-
wohnerzahl hat, als manches deutsche Königreich,
eine Selbstregierung und Selbstverwaltung der Ge-
meinde, anstatt der seither gesetzlichen Bevormun-
dung der Stadt und ihrer ganzen Gemeindever-
waltung durch den Staat. Die Anhänger der Kom-
mune verlangten also eigentlich nichts, als ums
wir in den süddeutschen Staaten schon lange haben
und was die neue preußische Städteordnung nun
auch den übrigen Stadtgemeinden des deutschen
Reiches garantirt. Wäre diese Forderung, die eine
durchaus berechtigte und zeitgemäße ist, ans fried-
lichen: Wege gestellt worden, so hätte die National-
versammlung sie nothwendig genehmigen müssen,
schon, um die seitherige Willkür in der Knechtung
der Gemeinden als ein Ueberbleibsel der napoleo-
nischen Selbstherrschaft nbznschasfen. Allein es stellte
sich leider nur allzu bald heraus, daß der Kampf
um die Selbstregierung des Volkes durch die Ge-
meinde nicht der einzige Zweck der Contre-Nevolution
vom 18. März war, sondern daß die rothe Repu-
blik einen allgemeinen Umsturz aller Verhältnisse
beabsichtigte. Der Pöbel, während der langen Be-
lagerung bewaffnet, eiuexercirt, an Müssiggang ge-
wöhnt und dafür von Staatswegen noch bezahlt,
wollte nicht zur Arbeit zurückkehren, sondern allem
Eigenthum den Krieg erklären. Daruin folgte er dem
sinn- nnd planlosen Treiben der extremen republika-
nischen Partei, welche diese Contre-Nevolution ange-
zettelt und jene Wahlen der provisorischen Regierung
der sogenannten Konuuune ausgeschrieben hatte. Aus
diesen Wahlen, die von der bewaffneten Menge
terrorisirt wurden, ging dann die Regierung hervor,
welche über Paris ein solch furchtbares Elend ver-
hängt hat. Den Moment, wo diese Regierung, die
aus deu Wahlen des 26. März (auf welchen die
Wahlen vertagt worden) hervorgegangen, die Kom-
mune von: Stadthaus aus am 29. März prokla-
mirte, stellt unser zweites Bild auf S. 561 dar.
— Diese Auflehnung des Centralausschusses der
rothen Republikaner und der Regierung der Kom-
mune beschwor nun den Bürgerkrieg herauf und
führte zu jenen Greueln im Innern von Paris
und den: Bombardement der Stadt durch die Fran-
zosen selber. Die Versailler Regierung, welche eben-
falls nur aus der kecken Revolution einer Minder-
heit hervorging und um kein Haar rechtmäßiger ist
als die Regierung der Kommune, erklärte der letz-
teren, als sie sich nicht unbedingt unterwerfen wollte,
den Vernichtungskrieg. Anstatt sich ein warnendes
Beispiel zu nehmen an den Greueln der Zerstörung,
welche die Geschosse der Pariser Forts und Wälle
in dem freundlichen heiteren Städtchen St. Cloud
ungerichtet hatten und von denen unsere beiden
Bilder auf S. 564 einen Begriff geben, beschossen
die Truppen der Versailler Negierung alle diejenigen
Theile der Stadt und ihrer Vorstädte, wohin nnr
irgend ihr Geschütz reichte, und die Pariser ihrerseits
legten nun auf's Neue eine Anzahl freundlicher
Städtchen und Dörfer außerhalb der L-tadtumwal-
lung, worunter namentlich das reizende Neuilly, in
Schutt und Trümmer, so daß die Schrecken und
Verheerungen dieses Bürgerkrieges für Paris un-
bedingt noch größer sind, als die Leiden und Be-
schädigungen, welche das Bombardement durch die
Deutschen über die Stadt verhängt hatte. Das
Städtchen St. Cloud, an einen: Hügelhang des
linken Seineufers bis zu dein nun in Trümmern
liegenden gleichnamigen Schlosse ansteigend, seither
ein beliebter Sommersitz der Pariser voll allerliebster
zierlicher Häuschen, hat nun kein Dutzend bewohn-
barer Häuser mehr aufzuweisen, und die Franzosen
werden die Zerstörungen, die sie dort angerichtet,
den Deutschen beizumessen versuchen. O. M.
Der Erdschlipf in Whitby.
(Siehe die Bilder auf S. 565.)
Erdschlipfe oder Erdrutsche nennt man das Ab-
gleiten und Fortrutschen losgerisfener Erdschichten oder
Felsenmassen, welche meist da Vorkommen, wo sich
unter einer Schicht von Dammerde Schiefer- oder
Thongrund befindet und der Boden eine starke Nei-
gung hat, oder wo Felsgestein von verschiedener Härte
und Dichte in wechselnder Schichtung unter stark ge-
neigten Winkeln übereinanderliegt und wo Regen,
Schnee oder Quellwasser eine der Zwischenschichten
aufgeweicht und gelockert hat, so daß sie unter dem
Druck der schrägen Ueberlagerung weicht und durch
die Wucht ihrer eigenen Schwere niedergleitend, Bäume,
Felsen und Gebäude mit sich fortreißt. Wasser spielt
dabei immer eine Hauptrolle; oft tragen auch Erd-
beben und Erdstöße dazu bei, einen Erdschlipf vorzu-
bereiten. Wo aber vulkanische Thütigkeit nicht in's
Spiel kommt, da ist ein Erdschlipf immer etwas höchst
Ernstes und Erschreckendes. Erdrutsche von größeren:
Umfang kommen ziemlich häufig an der Meeresküste,
sowie an Stellen vor, wo stark geneigte Erdschichten
plötzlich gegen ein Thal oder Flußbett auslaufen,
und wir haben davon schon einige merkwürdige Bei-
spiele in Deutschland und der Schweiz erlebt — wir
führen, abgesehen von der Verschüttung von Goldau
durch den Bergsturz des Rufsi und von den Felsen-
stürzen zu Felsberg -ei Chur, nur die Erdschlipfe bei
Elberfeld im Deccmber 1850. und -ei Biberegg in
der Schweiz 1851 u. s. w. an. Noch häufiger sin-
derartige Erscheinungen an der britischen, namentlich
an der Südküste der Insel Wight, wo zwischen den
Felsenschichten oft eine Schicht -lauen Thonmergcls
eingelagcrt ist, welche leicht von: Wasser aufgcwcicht
wird und dann unter starken Neigungswinkeln des
geschichteten Gesteins in's Nutschen kommt. Dies ge-
schah auch bei Whitby, wie unsere beiden Holzschnitte auf
S. 565 darstellen. Auf die starken Regen um Mitte
Decembcrs v. I. folgte starker Frost; das Gefrieren
des durch die -laue Mcrgclschicht sickernden Tagwas-
scrs und der darin Verlaufendei: Adern: von Quell-
wasser lockerte durch seine ausdchnende Gewalt diese
schlüpfrige Schichte noch mehr und in der Nacht auf
den 21. Deccmber verkündete ein Krachen der Wände
und Decken den Bewohnern der unter der Felsen-
klippe liegenden Häuser die nahende Gefahr. Die
Bestürzung lief von Haus zu Haus und alle beeilten
sich, ihre bewegliche Habe in Sicherheit zu bringen.
Bald zeigte sich, daß der Streifen Land, auf welchen:
die Häuser erbaut, am Boden geborsten war und nach
dem Hafen hinunter zu rutschen begann. Ein Theil
des Kirchhofs und das darüberliegende Feld waren auf
eine Breite von 3—4 Ruthen ebenfalls in Bewegung
gerathen und die dahinter liegenden Häuser rutsch-
ten nach, zerbarsten theilweise und zerdrückten oder
zerbrachen Alles, was darin war. Die ganze Masse
setzte sich jetzt in stärkere Bewegung, welche am
22. Dccember noch den ganzen Tag fortdauerte, so
daß am 23. verschiedene Häuser um 20 Fuß tiefer
standen als zuvor, mehrere ganz, andere theilweise
in Trümmer gelegt wurden, mehrere in die See stürz-
ten und einige andere ganz schief dahingen, als ob
sie einstürzen wollten. Etwa ein Dutzend solcher
Häuser mußten seither abgetragen werden, weil sie
nicht mehr bewohnbar waren. Vor 83 Jahren hatte
in Whitby ein ähnlicher Erdschlipf von noch ernsteren
Folgen stattgefunden. O. M.
Das Leben und Treiben auf dem
Wiener Kongreß.
Geschichtliches Bild
Wilhelm Kirschner.
Der berühmte und berüchtigte Wiener Kongreß,
welcher am 1. Oktober 1814 begann und den
Vertrag des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai
desselben Jahres zur Ausführung bringen, die
zerrissenen Bande der europäischen Völker und
Staaten ordnen und auf's Neue verknüpfen sollte,
auf dessen Grundlagen daher unser europäisches
Staatensystem bis zum letzten Kriege mit Frank-
reich beruhte, hat neben dieser welthistorischen,
allgemeinen noch eine andere eigenthümliche Be-
deutung und steht dieserhalb in der Geschichte als
einziges Beispiel da. Nicht nur eine große Zahl
europäischer Machthaber hatte sich hier zusam-
mengefunden, sondern auch viele politische, mili-
tärische und literarische Größen der damaligen
Zeit, viele fürstliche und hohe Personen des schö-
nen Geschlechts; der Glanz der Höfe, die höchste
Blüthe der Schönheit, Kunst, Gesellschaft und
wissenschaftlichen Berühmtheit des damaligen Eu-
ropas — Alles voll Siegesstolz, Hoffnung und
Spannung — war hier vereinigt. Dazu denke
mau sich die große weltliche Ueppigkeit, den ur-
sprünglichen Humor und die naive Ungenirtheit
der süddeutschen Kaiserstadt, und man wird sich
einigermaßen ein Bild von dem dortigen Leben
und Treiben während des Kongresses machen
können. Im Volke wie in den hohen und höchsten
Kreisen lebte man tagtäglich in Saus und Braus:
Mummereien, Jagden, Paraden, Hoffeste, Schlitten-
fahrten, Feuerwerke, Konzerte u. dergl. füllten
jeden Tag aus, drängten und lösten sich ab.
Der Kongreß hatte deu Charakter einer großen
Festlichkeit zu Ehren eines allgemeinen Friedens.
Man suchte Entschädigung für die Sorgen und
Drangsale der vorangegaugeneu Kriegsjahre.
Inmitten solcher Festlichkeiten wurden die ver-
wickeltsten und schwierigsten Fragen verhandelt
und entschieden. Auf einem Balle wurden König-
reiche vergrößert oder zerstückelt, auf einem Diner
eine Schadloshaltung bewilligt, eine Verfassung
auf der Jagd entworfen, und bisweilen brachte
ein Bonmot, ein glücklicher Einfall einen Traktat
zu Stande, den zahlreiche Konferenzen und ge-
schäftiger Briefwechsel nur mit Mühe hätten zum
Abschluß bringen können. Treffend vergleicht da-
her ein Geschichtsschreiber den Kongreß mit einem
Vexirbilde, welches von der einen Seite gesehen
die ernsthaftesten Perrückengesichter am grünen Tische,
von der anderen Seite aber eiu Bild der tollsten
Ausgelassenheit zeige.
„Tngebuch aus Nord und Süd", amerikanische Reise-
Erinnerungen, sein treffliches Buch über Canada und
sein geistvoller humoristischer Roman: „Abenteuer des
k^r. Brady" (eines irischen Militärarztes) hervorzu-
heben. Herr Russell gibt gegenwärtig neben seiner
Zeitung für Heer und Flotte noch die trefflich redi-
girte „Sunday-Gazette", ein übersichtliches Wochen-
blatt, heraus. . O. M.
Fns Paris.
i.
(Siehr die Bilder auf S. 5K0, S6r u. 58t.)
Paris war bezwungen, hatte kapitnlirt, einen
Theil der Waffen ansgetiesert, und mußte es sich
gefallen lassen, daß am 1. Marz nach einer Parade,
welche der deutsche Kaiser auf der Promenade von
Longchamvs beim Bonlogner Gehölz abgehalten,
60,000 Mann deutscher Truppen in Paris eiuzogen
und die elyseeischen Felder rind den Eintrachtsplatz
zu einem Feldlager machten. Die geheime Angst
der Pariser, die deutschen Truppen möchten über
die vertragsmäßig ihnen eingeräumten Bezirke hin-
ausgehen und sich auch der übrigen Stadttheile zu
bemächtigen suchen, erwies sich als unbegründet,
und wenn die Pariser nur aus dem Grunde Barri-
kaden erbaut hätten, um die Deutschen an weiterem
Vordringen zu hindern, so Hütten sie sich diese Mühe
ersparen können. Tie Deutschen überschritten die
vertragsmäßige Grenze nicht und benahmen sich
ruhig, selbst dem herausfordernden Treiben eines
Theils des Pariser Pöbels gegenüber. Die Pariser
erkannten dies in ihrem verletzten Hochmuth nicht
an, sondern erhoben einen furchtbaren Skandal, als
sie sahen, daß deutsche Soldaten in den Sälen um-
hergingen, welche die Sammlungen des Louvre be-
herbergen, und daß andere deutsche Soldaten im Tni-
lerieengarten lustwandelten. Fog man nun auch deut-
scherseits, um keine Gelegenheit zu Händeln zu geben,
die Soldaten aus dem Louvre zurück, so überließ
man ihnen, dagegen den Tuilerieengarten zur Be-
nützung. Sie beschauten sich von hier mit verdienter
Geuugthuung die Residenz des entthronten Kaisers
und beraubten die Lorbeerbüsche ihrer Zweige, um
sich damit die Helme zu bekränzen (s. Bild S. 560).
Und fürwahr, wer nur einigermaßen die Muhsale
und Entbehrungen kennt, die unsere Truppen wäh-
rend der verwichenen 5ffs Monate vor Paris zu be-
stehen gehabt hatten, der muß anerkennen, daß sie
den aus des Kaisers Privatgarten entnommenen Lor-
beer verdient hatten.
Mit den Waffen, um welche die republikanische
Regierung, trotz der eingegangenen Vertragspflich-
ten, die deutschen Sieger betrogen und verkürzt hatte,
und mit den angeblich gegen die Deutschen errichte-
ten Barrikaden machten dann die rothen Republi-
kaner ihre Revolution vom 18. März und errichteten
die Negierung der Kommune, d. h. sie verlangten
für Paris, welches ja für sich eine größere Ein-
wohnerzahl hat, als manches deutsche Königreich,
eine Selbstregierung und Selbstverwaltung der Ge-
meinde, anstatt der seither gesetzlichen Bevormun-
dung der Stadt und ihrer ganzen Gemeindever-
waltung durch den Staat. Die Anhänger der Kom-
mune verlangten also eigentlich nichts, als ums
wir in den süddeutschen Staaten schon lange haben
und was die neue preußische Städteordnung nun
auch den übrigen Stadtgemeinden des deutschen
Reiches garantirt. Wäre diese Forderung, die eine
durchaus berechtigte und zeitgemäße ist, ans fried-
lichen: Wege gestellt worden, so hätte die National-
versammlung sie nothwendig genehmigen müssen,
schon, um die seitherige Willkür in der Knechtung
der Gemeinden als ein Ueberbleibsel der napoleo-
nischen Selbstherrschaft nbznschasfen. Allein es stellte
sich leider nur allzu bald heraus, daß der Kampf
um die Selbstregierung des Volkes durch die Ge-
meinde nicht der einzige Zweck der Contre-Nevolution
vom 18. März war, sondern daß die rothe Repu-
blik einen allgemeinen Umsturz aller Verhältnisse
beabsichtigte. Der Pöbel, während der langen Be-
lagerung bewaffnet, eiuexercirt, an Müssiggang ge-
wöhnt und dafür von Staatswegen noch bezahlt,
wollte nicht zur Arbeit zurückkehren, sondern allem
Eigenthum den Krieg erklären. Daruin folgte er dem
sinn- nnd planlosen Treiben der extremen republika-
nischen Partei, welche diese Contre-Nevolution ange-
zettelt und jene Wahlen der provisorischen Regierung
der sogenannten Konuuune ausgeschrieben hatte. Aus
diesen Wahlen, die von der bewaffneten Menge
terrorisirt wurden, ging dann die Regierung hervor,
welche über Paris ein solch furchtbares Elend ver-
hängt hat. Den Moment, wo diese Regierung, die
aus deu Wahlen des 26. März (auf welchen die
Wahlen vertagt worden) hervorgegangen, die Kom-
mune von: Stadthaus aus am 29. März prokla-
mirte, stellt unser zweites Bild auf S. 561 dar.
— Diese Auflehnung des Centralausschusses der
rothen Republikaner und der Regierung der Kom-
mune beschwor nun den Bürgerkrieg herauf und
führte zu jenen Greueln im Innern von Paris
und den: Bombardement der Stadt durch die Fran-
zosen selber. Die Versailler Regierung, welche eben-
falls nur aus der kecken Revolution einer Minder-
heit hervorging und um kein Haar rechtmäßiger ist
als die Regierung der Kommune, erklärte der letz-
teren, als sie sich nicht unbedingt unterwerfen wollte,
den Vernichtungskrieg. Anstatt sich ein warnendes
Beispiel zu nehmen an den Greueln der Zerstörung,
welche die Geschosse der Pariser Forts und Wälle
in dem freundlichen heiteren Städtchen St. Cloud
ungerichtet hatten und von denen unsere beiden
Bilder auf S. 564 einen Begriff geben, beschossen
die Truppen der Versailler Negierung alle diejenigen
Theile der Stadt und ihrer Vorstädte, wohin nnr
irgend ihr Geschütz reichte, und die Pariser ihrerseits
legten nun auf's Neue eine Anzahl freundlicher
Städtchen und Dörfer außerhalb der L-tadtumwal-
lung, worunter namentlich das reizende Neuilly, in
Schutt und Trümmer, so daß die Schrecken und
Verheerungen dieses Bürgerkrieges für Paris un-
bedingt noch größer sind, als die Leiden und Be-
schädigungen, welche das Bombardement durch die
Deutschen über die Stadt verhängt hatte. Das
Städtchen St. Cloud, an einen: Hügelhang des
linken Seineufers bis zu dein nun in Trümmern
liegenden gleichnamigen Schlosse ansteigend, seither
ein beliebter Sommersitz der Pariser voll allerliebster
zierlicher Häuschen, hat nun kein Dutzend bewohn-
barer Häuser mehr aufzuweisen, und die Franzosen
werden die Zerstörungen, die sie dort angerichtet,
den Deutschen beizumessen versuchen. O. M.
Der Erdschlipf in Whitby.
(Siehe die Bilder auf S. 565.)
Erdschlipfe oder Erdrutsche nennt man das Ab-
gleiten und Fortrutschen losgerisfener Erdschichten oder
Felsenmassen, welche meist da Vorkommen, wo sich
unter einer Schicht von Dammerde Schiefer- oder
Thongrund befindet und der Boden eine starke Nei-
gung hat, oder wo Felsgestein von verschiedener Härte
und Dichte in wechselnder Schichtung unter stark ge-
neigten Winkeln übereinanderliegt und wo Regen,
Schnee oder Quellwasser eine der Zwischenschichten
aufgeweicht und gelockert hat, so daß sie unter dem
Druck der schrägen Ueberlagerung weicht und durch
die Wucht ihrer eigenen Schwere niedergleitend, Bäume,
Felsen und Gebäude mit sich fortreißt. Wasser spielt
dabei immer eine Hauptrolle; oft tragen auch Erd-
beben und Erdstöße dazu bei, einen Erdschlipf vorzu-
bereiten. Wo aber vulkanische Thütigkeit nicht in's
Spiel kommt, da ist ein Erdschlipf immer etwas höchst
Ernstes und Erschreckendes. Erdrutsche von größeren:
Umfang kommen ziemlich häufig an der Meeresküste,
sowie an Stellen vor, wo stark geneigte Erdschichten
plötzlich gegen ein Thal oder Flußbett auslaufen,
und wir haben davon schon einige merkwürdige Bei-
spiele in Deutschland und der Schweiz erlebt — wir
führen, abgesehen von der Verschüttung von Goldau
durch den Bergsturz des Rufsi und von den Felsen-
stürzen zu Felsberg -ei Chur, nur die Erdschlipfe bei
Elberfeld im Deccmber 1850. und -ei Biberegg in
der Schweiz 1851 u. s. w. an. Noch häufiger sin-
derartige Erscheinungen an der britischen, namentlich
an der Südküste der Insel Wight, wo zwischen den
Felsenschichten oft eine Schicht -lauen Thonmergcls
eingelagcrt ist, welche leicht von: Wasser aufgcwcicht
wird und dann unter starken Neigungswinkeln des
geschichteten Gesteins in's Nutschen kommt. Dies ge-
schah auch bei Whitby, wie unsere beiden Holzschnitte auf
S. 565 darstellen. Auf die starken Regen um Mitte
Decembcrs v. I. folgte starker Frost; das Gefrieren
des durch die -laue Mcrgclschicht sickernden Tagwas-
scrs und der darin Verlaufendei: Adern: von Quell-
wasser lockerte durch seine ausdchnende Gewalt diese
schlüpfrige Schichte noch mehr und in der Nacht auf
den 21. Deccmber verkündete ein Krachen der Wände
und Decken den Bewohnern der unter der Felsen-
klippe liegenden Häuser die nahende Gefahr. Die
Bestürzung lief von Haus zu Haus und alle beeilten
sich, ihre bewegliche Habe in Sicherheit zu bringen.
Bald zeigte sich, daß der Streifen Land, auf welchen:
die Häuser erbaut, am Boden geborsten war und nach
dem Hafen hinunter zu rutschen begann. Ein Theil
des Kirchhofs und das darüberliegende Feld waren auf
eine Breite von 3—4 Ruthen ebenfalls in Bewegung
gerathen und die dahinter liegenden Häuser rutsch-
ten nach, zerbarsten theilweise und zerdrückten oder
zerbrachen Alles, was darin war. Die ganze Masse
setzte sich jetzt in stärkere Bewegung, welche am
22. Dccember noch den ganzen Tag fortdauerte, so
daß am 23. verschiedene Häuser um 20 Fuß tiefer
standen als zuvor, mehrere ganz, andere theilweise
in Trümmer gelegt wurden, mehrere in die See stürz-
ten und einige andere ganz schief dahingen, als ob
sie einstürzen wollten. Etwa ein Dutzend solcher
Häuser mußten seither abgetragen werden, weil sie
nicht mehr bewohnbar waren. Vor 83 Jahren hatte
in Whitby ein ähnlicher Erdschlipf von noch ernsteren
Folgen stattgefunden. O. M.
Das Leben und Treiben auf dem
Wiener Kongreß.
Geschichtliches Bild
Wilhelm Kirschner.
Der berühmte und berüchtigte Wiener Kongreß,
welcher am 1. Oktober 1814 begann und den
Vertrag des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai
desselben Jahres zur Ausführung bringen, die
zerrissenen Bande der europäischen Völker und
Staaten ordnen und auf's Neue verknüpfen sollte,
auf dessen Grundlagen daher unser europäisches
Staatensystem bis zum letzten Kriege mit Frank-
reich beruhte, hat neben dieser welthistorischen,
allgemeinen noch eine andere eigenthümliche Be-
deutung und steht dieserhalb in der Geschichte als
einziges Beispiel da. Nicht nur eine große Zahl
europäischer Machthaber hatte sich hier zusam-
mengefunden, sondern auch viele politische, mili-
tärische und literarische Größen der damaligen
Zeit, viele fürstliche und hohe Personen des schö-
nen Geschlechts; der Glanz der Höfe, die höchste
Blüthe der Schönheit, Kunst, Gesellschaft und
wissenschaftlichen Berühmtheit des damaligen Eu-
ropas — Alles voll Siegesstolz, Hoffnung und
Spannung — war hier vereinigt. Dazu denke
mau sich die große weltliche Ueppigkeit, den ur-
sprünglichen Humor und die naive Ungenirtheit
der süddeutschen Kaiserstadt, und man wird sich
einigermaßen ein Bild von dem dortigen Leben
und Treiben während des Kongresses machen
können. Im Volke wie in den hohen und höchsten
Kreisen lebte man tagtäglich in Saus und Braus:
Mummereien, Jagden, Paraden, Hoffeste, Schlitten-
fahrten, Feuerwerke, Konzerte u. dergl. füllten
jeden Tag aus, drängten und lösten sich ab.
Der Kongreß hatte deu Charakter einer großen
Festlichkeit zu Ehren eines allgemeinen Friedens.
Man suchte Entschädigung für die Sorgen und
Drangsale der vorangegaugeneu Kriegsjahre.
Inmitten solcher Festlichkeiten wurden die ver-
wickeltsten und schwierigsten Fragen verhandelt
und entschieden. Auf einem Balle wurden König-
reiche vergrößert oder zerstückelt, auf einem Diner
eine Schadloshaltung bewilligt, eine Verfassung
auf der Jagd entworfen, und bisweilen brachte
ein Bonmot, ein glücklicher Einfall einen Traktat
zu Stande, den zahlreiche Konferenzen und ge-
schäftiger Briefwechsel nur mit Mühe hätten zum
Abschluß bringen können. Treffend vergleicht da-
her ein Geschichtsschreiber den Kongreß mit einem
Vexirbilde, welches von der einen Seite gesehen
die ernsthaftesten Perrückengesichter am grünen Tische,
von der anderen Seite aber eiu Bild der tollsten
Ausgelassenheit zeige.