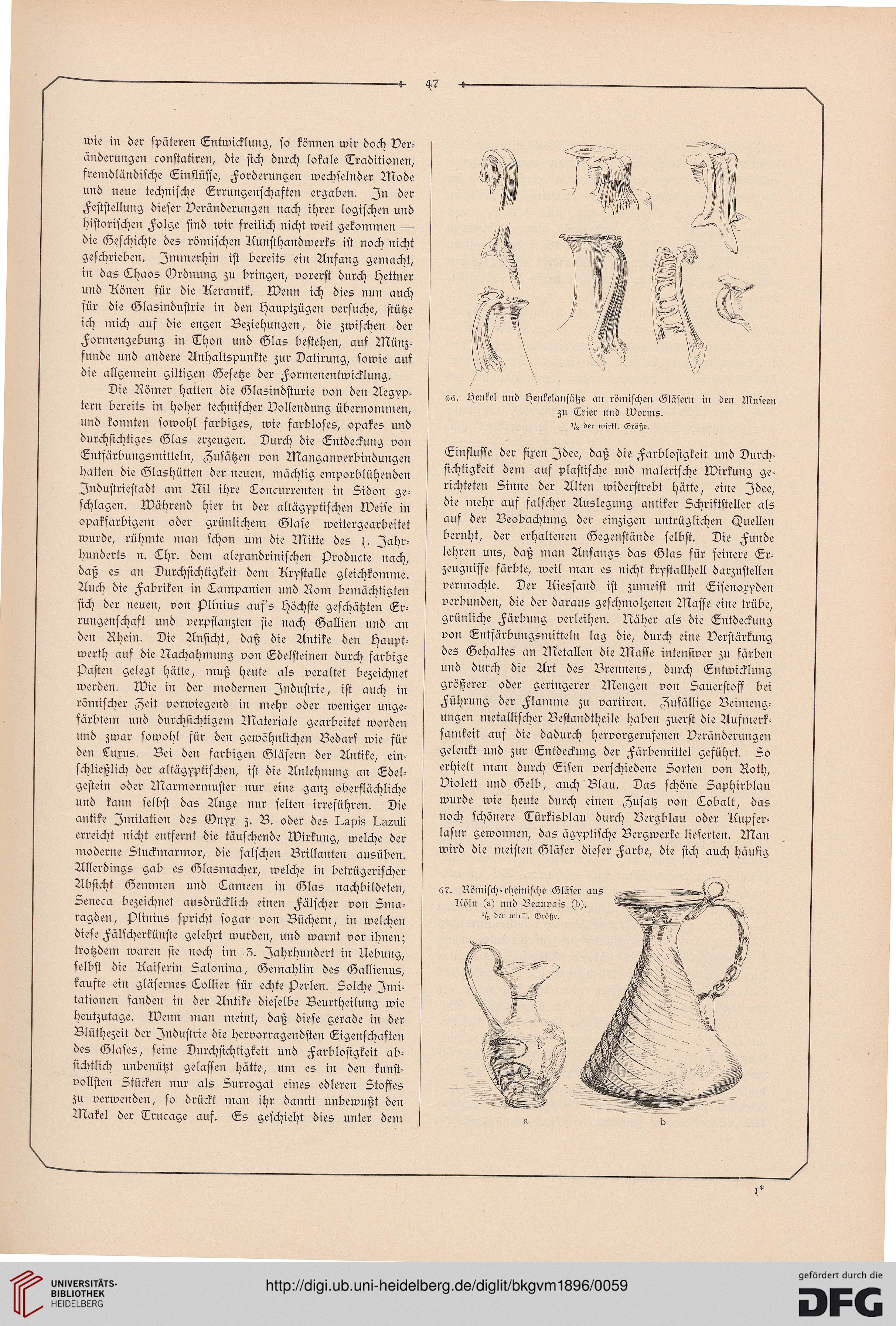+
qck +
/■
wie in der späteren Entwicklung, so können wir doch Ver-
änderungen constatiren, die sich durch lokale Traditionen,
freindländische Einflüsse, Forderungen wechselnder Mode
und neue technische Errungenschaften ergaben, In der
Feststellung dieser Veränderungen nach ihrer logischen und
historischen Folge sind wir freilich nicht weit gekommen —■
die Geschichte des römischen Aunsthandwerks ist noch nicht
geschrieben. Immerhin ist bereits ein Anfang gemacht,
in das Ehaos Ordnung zu bringen, vorerst durch Lettner
und Aönen für die Reramik. Wenn ich dies nun auch
für die Glasindustrie in den Pauptzügen versuche, stütze
ich mich auf die engen Beziehungen, die zwischen der
Formengebung in Thon und Glas bestehen, auf Münz-
funde und andere Anhaltspunkte zur Datirung, sowie auf
die allgemein giltigen Gesetze der Formenentwicklung.
Die Römer hatten die Glasindsturie von den Aegyp-
tern bereits in hoher technischer Vollendung übernommen,
und konnten sowohl farbiges, wie farbloses, opakes und
durchsichtiges Glas erzeugen. Durch die Entdeckung von
Entfärbungsmitteln, Zusätzen von Manganverbindungen
hatten die Glashütten der neuen, mächtig emporblühenden
Industriestadt am Nil ihre Eoncurrenten in Sidon ge-
schlagen. Während hier in der altägyptischen Weise in
opakfarbigem oder grünlichem Glase weitergearbeitet
wurde, rühmte man schon um die Mitte des Jahr-
hunderts n. Ehr. dem alexandrinischen producte nach,
daß es an Durchsichtigkeit dem Arystalle gleichkoinme.
Auch die Fabriken in Lampanien und Rom bemächtigten
sich der neuen, von plinius auf's höchste geschätzten Er-
rungenschaft und verpflanzten sie nach Gallien und an
den Rhein. Die Ansicht, daß die Antike den Paupt-
werth aus die Nachahmung von Edelsteinen durch farbige
Pasten gelegt hätte, muß heute als veraltet bezeichnet
werden. Wie in der modernen Industrie, ist auch in
römischer Zeit vorwiegend in mehr oder weniger unge-
färbten: und durchsichtigem Materiale gearbeitet worden
und zwar sowohl für den gewöhnlichen Bedarf wie für
den Luxus. Bei den farbigen Gläsern der Antike, ein-
schließlich der altägyptischen, ist die Anlehnung an Edel-
gestein oder Marmormuster nur eine ganz oberflächliche
und kann selbst das Auge nur selten irresühren. Die
antike Imitation des Onyx z. B. oder des Eapis Lazuli
erreicht nicht entfernt die täuschende Wirkung, welche der
moderne Stuckmarmor, die falschen Brillanten ausüben.
Allerdings gab es Glasmacher, welche in betrügerischer
Absicht Gemmen und Eameen in Glas nachbildeten,
Seneca bezeichnet ausdrücklich einen Fälscher von Sma-
ragden, plinius spricht sogar von Büchern, in welchen
diese Fälscherkünste gelehrt wurden, und warnt vor ihnen;
trotzdem waren sie noch im 3. Jahrhundert in Uebung,
selbst die Kaiserin Salonina, Gemahlin des Gallienus,
kaufte ein gläsernes Eollier für echte Perlen. Solche Imi-
tationen fanden in der Antike dieselbe Beurtheilung wie
heutzutage. Wenn man meint, daß diese gerade in der
Blüthezeit der Industrie die hervorragendsten Eigenschaften
des Glases, seine Durchsichtigkeit und Farblosigkeit ab-
sichtlich unbenützt gelassen hätte, um es in den kunst-
vollsten Stücken nur als Surrogat eines edleren Stoffes
zu verwenden, so drückt man ihr damit unbewußt den
Makel der Trucage auf. Es geschieht dies unter dem
66. lfenkel und Henkelaiisätze an römischen Gläsern in den Museen
zu Trier und Worms.
1/2 der wirkl. Größe.
Einflüsse der fixen Idee, daß die Farblosigkeit und Durch-
sichtigkeit dem auf plastische und malerische Wirkung ge-
richteten Sinne der Alten widerstrebt hätte, eine Idee,
die mehr aus falscher Auslegung antiker Schriftsteller als
auf der Beobachtung der einzigen untrüglichen Quellen
beruht, der erhaltenen Gegenstände selbst. Die Funde
lehren uns, daß man Anfangs das Glas für feinere Er-
zeugnisse färbte, weil man es nicht krystallhell darzustellen
vermochte. Der Kiessand ist zumeist mit Eisenoxyden
verbunden, die der daraus geschmolzenen Masse eine trübe,
grünliche Färbung verleihen. Näher als die Entdeckung
von Entfärbungsmitteln lag die, durch eine Verstärkung
des Gehaltes an Metallen die Maste intensiver zu färben
und durch die Art des Brennens, durch Entwicklung
größerer oder geringerer Mengen von Sauerstoff bei
Führung der Flamme zu variiren. Zufällige Beimeng-
ungen metallischer Bestandtheile haben zuerst die Aufmerk-
samkeit auf die dadurch hervorgerufenen Veränderungen
gelenkt und zur Entdeckung der Färbemittel geführt. So
erhielt man durch Eisen verschiedene Sorten von Roth,
Violett und Gelb, auch Blau. Das schöne Saphirblau
wurde wie heute durch einen Zusatz von Eobalt, das
noch schönere Türkisblau durch Bergblau oder Kupfer-
lasur gewonnen, das ägyptische Bergwerke lieferten. Man
wird die meisten Gläser dieser Farbe, die sich auch häufig
a b
qck +
/■
wie in der späteren Entwicklung, so können wir doch Ver-
änderungen constatiren, die sich durch lokale Traditionen,
freindländische Einflüsse, Forderungen wechselnder Mode
und neue technische Errungenschaften ergaben, In der
Feststellung dieser Veränderungen nach ihrer logischen und
historischen Folge sind wir freilich nicht weit gekommen —■
die Geschichte des römischen Aunsthandwerks ist noch nicht
geschrieben. Immerhin ist bereits ein Anfang gemacht,
in das Ehaos Ordnung zu bringen, vorerst durch Lettner
und Aönen für die Reramik. Wenn ich dies nun auch
für die Glasindustrie in den Pauptzügen versuche, stütze
ich mich auf die engen Beziehungen, die zwischen der
Formengebung in Thon und Glas bestehen, auf Münz-
funde und andere Anhaltspunkte zur Datirung, sowie auf
die allgemein giltigen Gesetze der Formenentwicklung.
Die Römer hatten die Glasindsturie von den Aegyp-
tern bereits in hoher technischer Vollendung übernommen,
und konnten sowohl farbiges, wie farbloses, opakes und
durchsichtiges Glas erzeugen. Durch die Entdeckung von
Entfärbungsmitteln, Zusätzen von Manganverbindungen
hatten die Glashütten der neuen, mächtig emporblühenden
Industriestadt am Nil ihre Eoncurrenten in Sidon ge-
schlagen. Während hier in der altägyptischen Weise in
opakfarbigem oder grünlichem Glase weitergearbeitet
wurde, rühmte man schon um die Mitte des Jahr-
hunderts n. Ehr. dem alexandrinischen producte nach,
daß es an Durchsichtigkeit dem Arystalle gleichkoinme.
Auch die Fabriken in Lampanien und Rom bemächtigten
sich der neuen, von plinius auf's höchste geschätzten Er-
rungenschaft und verpflanzten sie nach Gallien und an
den Rhein. Die Ansicht, daß die Antike den Paupt-
werth aus die Nachahmung von Edelsteinen durch farbige
Pasten gelegt hätte, muß heute als veraltet bezeichnet
werden. Wie in der modernen Industrie, ist auch in
römischer Zeit vorwiegend in mehr oder weniger unge-
färbten: und durchsichtigem Materiale gearbeitet worden
und zwar sowohl für den gewöhnlichen Bedarf wie für
den Luxus. Bei den farbigen Gläsern der Antike, ein-
schließlich der altägyptischen, ist die Anlehnung an Edel-
gestein oder Marmormuster nur eine ganz oberflächliche
und kann selbst das Auge nur selten irresühren. Die
antike Imitation des Onyx z. B. oder des Eapis Lazuli
erreicht nicht entfernt die täuschende Wirkung, welche der
moderne Stuckmarmor, die falschen Brillanten ausüben.
Allerdings gab es Glasmacher, welche in betrügerischer
Absicht Gemmen und Eameen in Glas nachbildeten,
Seneca bezeichnet ausdrücklich einen Fälscher von Sma-
ragden, plinius spricht sogar von Büchern, in welchen
diese Fälscherkünste gelehrt wurden, und warnt vor ihnen;
trotzdem waren sie noch im 3. Jahrhundert in Uebung,
selbst die Kaiserin Salonina, Gemahlin des Gallienus,
kaufte ein gläsernes Eollier für echte Perlen. Solche Imi-
tationen fanden in der Antike dieselbe Beurtheilung wie
heutzutage. Wenn man meint, daß diese gerade in der
Blüthezeit der Industrie die hervorragendsten Eigenschaften
des Glases, seine Durchsichtigkeit und Farblosigkeit ab-
sichtlich unbenützt gelassen hätte, um es in den kunst-
vollsten Stücken nur als Surrogat eines edleren Stoffes
zu verwenden, so drückt man ihr damit unbewußt den
Makel der Trucage auf. Es geschieht dies unter dem
66. lfenkel und Henkelaiisätze an römischen Gläsern in den Museen
zu Trier und Worms.
1/2 der wirkl. Größe.
Einflüsse der fixen Idee, daß die Farblosigkeit und Durch-
sichtigkeit dem auf plastische und malerische Wirkung ge-
richteten Sinne der Alten widerstrebt hätte, eine Idee,
die mehr aus falscher Auslegung antiker Schriftsteller als
auf der Beobachtung der einzigen untrüglichen Quellen
beruht, der erhaltenen Gegenstände selbst. Die Funde
lehren uns, daß man Anfangs das Glas für feinere Er-
zeugnisse färbte, weil man es nicht krystallhell darzustellen
vermochte. Der Kiessand ist zumeist mit Eisenoxyden
verbunden, die der daraus geschmolzenen Masse eine trübe,
grünliche Färbung verleihen. Näher als die Entdeckung
von Entfärbungsmitteln lag die, durch eine Verstärkung
des Gehaltes an Metallen die Maste intensiver zu färben
und durch die Art des Brennens, durch Entwicklung
größerer oder geringerer Mengen von Sauerstoff bei
Führung der Flamme zu variiren. Zufällige Beimeng-
ungen metallischer Bestandtheile haben zuerst die Aufmerk-
samkeit auf die dadurch hervorgerufenen Veränderungen
gelenkt und zur Entdeckung der Färbemittel geführt. So
erhielt man durch Eisen verschiedene Sorten von Roth,
Violett und Gelb, auch Blau. Das schöne Saphirblau
wurde wie heute durch einen Zusatz von Eobalt, das
noch schönere Türkisblau durch Bergblau oder Kupfer-
lasur gewonnen, das ägyptische Bergwerke lieferten. Man
wird die meisten Gläser dieser Farbe, die sich auch häufig
a b