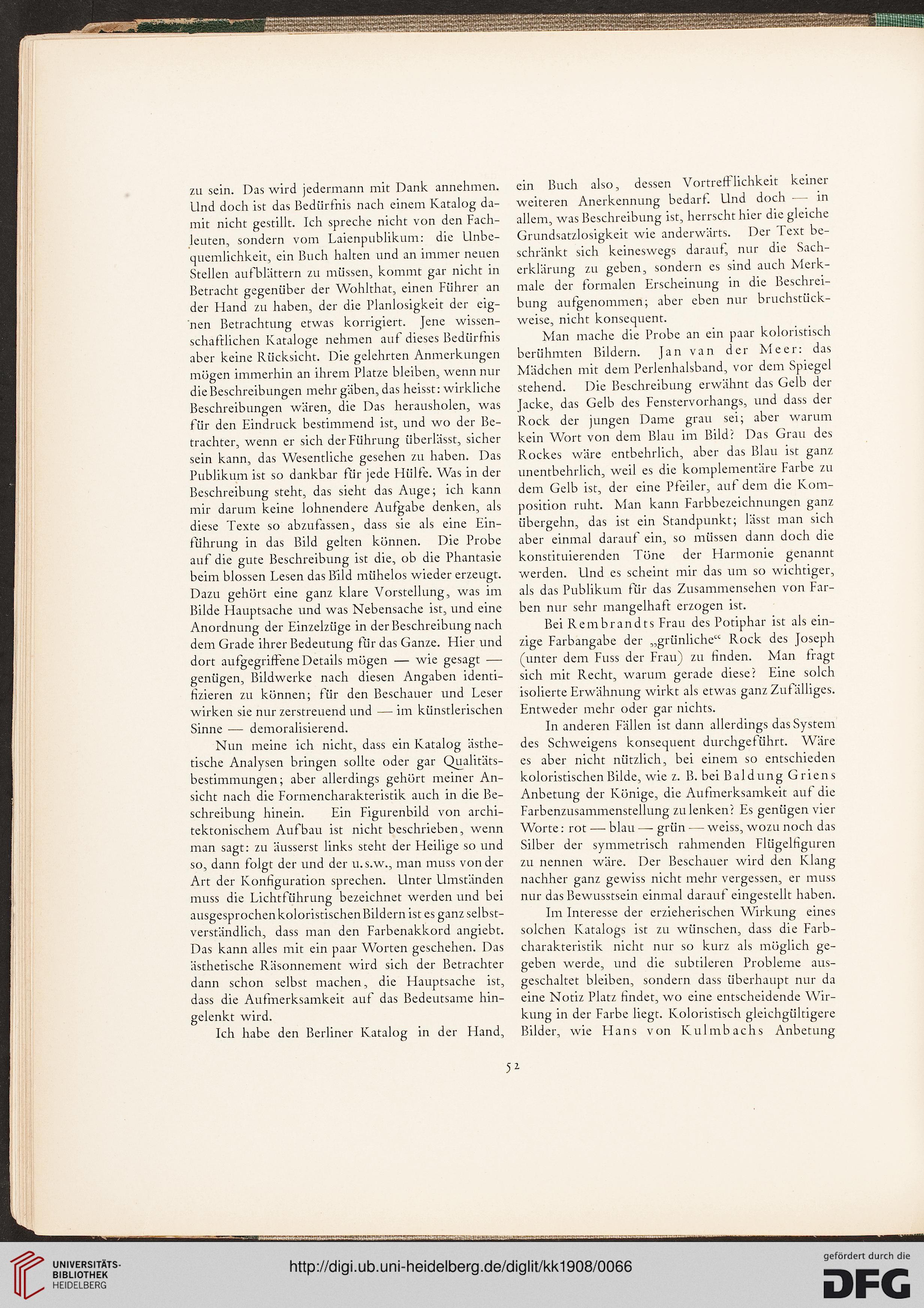zu sein. Das wird jedermann mit Dank annehmen.
Und doch ist das Bedürfnis nach einem Katalog da-
mit nicht gestillt. Ich spreche nicht von den Fach-
leuten, sondern vom Laienpublikum: die Unbe-
quemlichkeit, ein Buch halten und an immer neuen
Stellen aufblättern zu müssen, kommt gar nicht in
Betracht gegenüber der Wohlthat, einen Führer an
der Hand zu haben, der die Planlosigkeit der eig-
nen Betrachtung etwas korrigiert. Jene wissen-
schaftlichen Kataloge nehmen auf dieses Bedürfnis
aber keine Rücksicht. Die gelehrten Anmerkungen
mögen immerhin an ihrem Platze bleiben, wenn nur
die Beschreibungen mehr gaben, das heisst: wirkliche
Beschreibungen wären, die Das herausholen, was
für den Eindruck bestimmend ist, und wo der Be-
trachter, wenn er sich der Führung überlässt, sicher
sein kann, das Wesentliche gesehen zu haben. Das
Publikum ist so dankbar für jede Piülfe. Was in der
Beschreibung steht, das sieht das Auge; ich kann
mir darum keine lohnendere Aufgabe denken, als
diese Texte so abzufassen, dass sie als eine Ein-
führung in das Bild gelten können. Die Probe
auf die gute Beschreibung ist die, ob die Phantasie
beim blossen Lesen das Bild mühelos wieder erzeugt.
Dazu gehört eine ganz klare Vorstellung, was im
Bilde Hauptsache und was Nebensache ist, und eine
Anordnung der Einzelzüge in der Beschreibung nach
dem Grade ihrer Bedeutung für das Ganze. Hier und
dort aufgegriffene Details mögen — wie gesagt —
genügen, Bildwerke nach diesen Angaben identi-
fizieren zu können; für den Beschauer und Leser
wirken sie nur zerstreuend und -- im künstlerischen
Sinne — demoralisierend.
Nun meine ich nicht, dass ein Katalog ästhe-
tische Analysen bringen sollte oder gar Qualitäts-
bestimmungen ; aber allerdings gehört meiner An-
sicht nach die Formencharakteristik auch in die Be-
schreibung hinein. Ein Figurenbild von archi-
tektonischem Aufbau ist nicht beschrieben, wenn
man sagt: zu äusserst links steht der Heilige so und
so, dann folgt der und der u.s.w., man muss von der
Art der Konfiguration sprechen. Unter Umständen
muss die Lichtführung bezeichnet werden und bei
ausgesprochen koloristischen Bildern ist es ganz selbst-
verständlich, dass man den Farbenakkord angiebt.
Das kann alles mit ein paar Worten geschehen. Das
ästhetische Räsonnement wird sich der Betrachter
dann schon selbst machen, die Hauptsache ist,
dass die Aufmerksamkeit auf das Bedeutsame hin-
gelenkt wird.
Ich habe den Berliner Katalog in der Hand,
ein Buch also, dessen Vortrefflichkeit keiner
weiteren Anerkennung bedarf. Und doch — in
allem, was Beschreibung ist, herrscht hier die gleiche
Grundsatzlosigkeit wie anderwärts. Der Text be-
schränkt sich keineswegs darauf, nur die Sach-
erklärung zu geben, sondern es sind auch Merk-
male der formalen Erscheinung in die Beschrei-
bung aufgenommen; aber eben nur bruchstück-
weise, nicht konsequent.
Man mache die Probe an ein paar koloristisch
berühmten Bildern. Jan van der Meer: das
Mädchen mit dem Perlenhalsband, vor dem Spiegel
stehend. Die Beschreibung erwähnt das Gelb der
Jacke, das Gelb des Fenstervorhangs, und dass der
Rock der jungen Dame grau sei; aber warum
kein Wort von dem Blau im Bild? Das Grau des
Rockes wäre entbehrlich, aber das Blau ist ganz
unentbehrlich, weil es die komplementäre Farbe zu
dem Gelb ist, der eine Pfeiler, auf dem die Kom-
position ruht. Man kann Farbbezeichnungen ganz
übergehn, das ist ein Standpunkt; lässt man sich
aber einmal darauf ein, so müssen dann doch die
konstituierenden Töne der Harmonie genannt
werden. Und es scheint mir das um so wichtiger,
als das Publikum für das Zusammensehen von Far-
ben nur sehr mangelhaft erzogen ist.
Bei Rembrandts Frau des Potiphar ist als ein-
zige Farbangabe der „grünliche" Rock des Joseph
(unter dem Fuss der Frau) zu finden. Man fragt
sich mit Recht, warum gerade diese? Eine solch
isolierte Erwähnung wirkt als etwas ganz Zufälliges.
Entweder mehr oder gar nichts.
In anderen Fällen ist dann allerdings das System
des Schweigens konsequent durchgeführt. Wäre
es aber nicht nützlich, bei einem so entschieden
koloristischen Bilde, wie z. B. bei Baidung Griens
Anbetung der Könige, die Aufmerksamkeit auf die
Farbenzusammenstellung zu lenken? Es genügen vier
Worte: rot — blau — grün — weiss, wozu noch das
Silber der symmetrisch rahmenden Flügelfiguren
zu nennen wäre. Der Beschauer wird den Klang
nachher ganz gewiss nicht mehr vergessen, er muss
nur das Bewusstsein einmal darauf eingestellt haben.
Im Interesse der erzieherischen Wirkung eines
solchen Katalogs ist zu wünschen, dass die Farb-
charakteristik nicht nur so kurz als möglich ge-
geben werde, und die subtileren Probleme aus-
geschaltet bleiben, sondern dass überhaupt nur da
eine Notiz Platz findet, wo eine entscheidende Wir-
kung in der Farbe liegt. Koloristisch gleichgültigere
Bilder, wie Hans von Kulmbachs Anbetung
51
l*"~^T*T""
.___
•-'iBil
Und doch ist das Bedürfnis nach einem Katalog da-
mit nicht gestillt. Ich spreche nicht von den Fach-
leuten, sondern vom Laienpublikum: die Unbe-
quemlichkeit, ein Buch halten und an immer neuen
Stellen aufblättern zu müssen, kommt gar nicht in
Betracht gegenüber der Wohlthat, einen Führer an
der Hand zu haben, der die Planlosigkeit der eig-
nen Betrachtung etwas korrigiert. Jene wissen-
schaftlichen Kataloge nehmen auf dieses Bedürfnis
aber keine Rücksicht. Die gelehrten Anmerkungen
mögen immerhin an ihrem Platze bleiben, wenn nur
die Beschreibungen mehr gaben, das heisst: wirkliche
Beschreibungen wären, die Das herausholen, was
für den Eindruck bestimmend ist, und wo der Be-
trachter, wenn er sich der Führung überlässt, sicher
sein kann, das Wesentliche gesehen zu haben. Das
Publikum ist so dankbar für jede Piülfe. Was in der
Beschreibung steht, das sieht das Auge; ich kann
mir darum keine lohnendere Aufgabe denken, als
diese Texte so abzufassen, dass sie als eine Ein-
führung in das Bild gelten können. Die Probe
auf die gute Beschreibung ist die, ob die Phantasie
beim blossen Lesen das Bild mühelos wieder erzeugt.
Dazu gehört eine ganz klare Vorstellung, was im
Bilde Hauptsache und was Nebensache ist, und eine
Anordnung der Einzelzüge in der Beschreibung nach
dem Grade ihrer Bedeutung für das Ganze. Hier und
dort aufgegriffene Details mögen — wie gesagt —
genügen, Bildwerke nach diesen Angaben identi-
fizieren zu können; für den Beschauer und Leser
wirken sie nur zerstreuend und -- im künstlerischen
Sinne — demoralisierend.
Nun meine ich nicht, dass ein Katalog ästhe-
tische Analysen bringen sollte oder gar Qualitäts-
bestimmungen ; aber allerdings gehört meiner An-
sicht nach die Formencharakteristik auch in die Be-
schreibung hinein. Ein Figurenbild von archi-
tektonischem Aufbau ist nicht beschrieben, wenn
man sagt: zu äusserst links steht der Heilige so und
so, dann folgt der und der u.s.w., man muss von der
Art der Konfiguration sprechen. Unter Umständen
muss die Lichtführung bezeichnet werden und bei
ausgesprochen koloristischen Bildern ist es ganz selbst-
verständlich, dass man den Farbenakkord angiebt.
Das kann alles mit ein paar Worten geschehen. Das
ästhetische Räsonnement wird sich der Betrachter
dann schon selbst machen, die Hauptsache ist,
dass die Aufmerksamkeit auf das Bedeutsame hin-
gelenkt wird.
Ich habe den Berliner Katalog in der Hand,
ein Buch also, dessen Vortrefflichkeit keiner
weiteren Anerkennung bedarf. Und doch — in
allem, was Beschreibung ist, herrscht hier die gleiche
Grundsatzlosigkeit wie anderwärts. Der Text be-
schränkt sich keineswegs darauf, nur die Sach-
erklärung zu geben, sondern es sind auch Merk-
male der formalen Erscheinung in die Beschrei-
bung aufgenommen; aber eben nur bruchstück-
weise, nicht konsequent.
Man mache die Probe an ein paar koloristisch
berühmten Bildern. Jan van der Meer: das
Mädchen mit dem Perlenhalsband, vor dem Spiegel
stehend. Die Beschreibung erwähnt das Gelb der
Jacke, das Gelb des Fenstervorhangs, und dass der
Rock der jungen Dame grau sei; aber warum
kein Wort von dem Blau im Bild? Das Grau des
Rockes wäre entbehrlich, aber das Blau ist ganz
unentbehrlich, weil es die komplementäre Farbe zu
dem Gelb ist, der eine Pfeiler, auf dem die Kom-
position ruht. Man kann Farbbezeichnungen ganz
übergehn, das ist ein Standpunkt; lässt man sich
aber einmal darauf ein, so müssen dann doch die
konstituierenden Töne der Harmonie genannt
werden. Und es scheint mir das um so wichtiger,
als das Publikum für das Zusammensehen von Far-
ben nur sehr mangelhaft erzogen ist.
Bei Rembrandts Frau des Potiphar ist als ein-
zige Farbangabe der „grünliche" Rock des Joseph
(unter dem Fuss der Frau) zu finden. Man fragt
sich mit Recht, warum gerade diese? Eine solch
isolierte Erwähnung wirkt als etwas ganz Zufälliges.
Entweder mehr oder gar nichts.
In anderen Fällen ist dann allerdings das System
des Schweigens konsequent durchgeführt. Wäre
es aber nicht nützlich, bei einem so entschieden
koloristischen Bilde, wie z. B. bei Baidung Griens
Anbetung der Könige, die Aufmerksamkeit auf die
Farbenzusammenstellung zu lenken? Es genügen vier
Worte: rot — blau — grün — weiss, wozu noch das
Silber der symmetrisch rahmenden Flügelfiguren
zu nennen wäre. Der Beschauer wird den Klang
nachher ganz gewiss nicht mehr vergessen, er muss
nur das Bewusstsein einmal darauf eingestellt haben.
Im Interesse der erzieherischen Wirkung eines
solchen Katalogs ist zu wünschen, dass die Farb-
charakteristik nicht nur so kurz als möglich ge-
geben werde, und die subtileren Probleme aus-
geschaltet bleiben, sondern dass überhaupt nur da
eine Notiz Platz findet, wo eine entscheidende Wir-
kung in der Farbe liegt. Koloristisch gleichgültigere
Bilder, wie Hans von Kulmbachs Anbetung
51
l*"~^T*T""
.___
•-'iBil