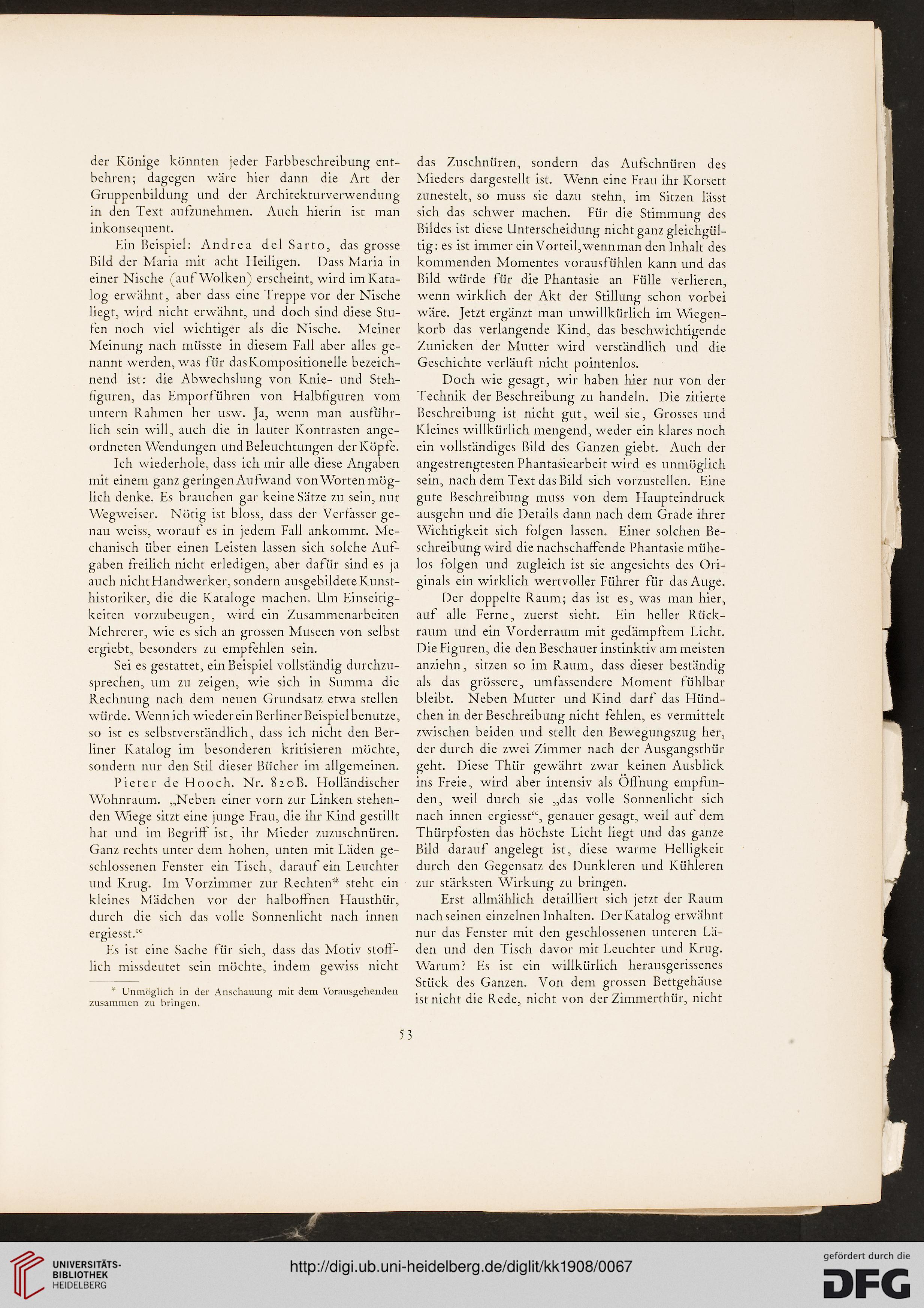der Könige könnten jeder Farbbeschreibung ent-
behren; dagegen wäre hier dann die Art der
Gruppenbildung und der Architekturverwendung
in den Text aufzunehmen. Auch hierin ist man
inkonsequent.
Ein Beispiel: Andrea del Sarto, das grosse
Bild der Maria mit acht Heiligen. Dass Maria in
einer Nische (auf Wolken) erscheint, wird im Kata-
log erwähnt, aber dass eine Treppe vor der Nische
liegt, wird nicht erwähnt, und doch sind diese Stu-
fen noch viel wichtiger als die Nische. Meiner
Meinung nach müsste in diesem Fall aber alles ge-
nannt werden, was für daslvompositionelle bezeich-
nend ist: die Abwechslung von Knie- und Steh-
riguren, das Emporführen von Halbfiguren vom
untern Rahmen her usw. Ja, wenn man ausführ-
lich sein will, auch die in lauter Kontrasten ange-
ordneten Wendungen und Beleuchtungen der Köpfe.
Ich wiederhole, dass ich mir alle diese Angaben
mit einem ganz geringen Aufwand von Worten mög-
lich denke. Es brauchen gar keine Sätze zu sein, nur
Wegweiser. Nötig ist bloss, dass der Verfasser ge-
nau weiss, worauf es in jedem Fall ankommt. Me-
chanisch über einen Leisten lassen sich solche Auf-
gaben freilich nicht erledigen, aber dafür sind es ja
auch nicht Handwerker, sondern ausgebildete Kunst-
historiker, die die Kataloge machen. Um Einseitig-
keiten vorzubeugen, wird ein Zusammenarbeiten
Mehrerer, wie es sich an grossen Museen von selbst
ergiebt, besonders zu empfehlen sein.
Sei es gestattet, ein Beispiel vollständig durchzu-
sprechen, um zu zeigen, wie sich in Summa die
Rechnung nach dem neuen Grundsatz etwa stellen
würde. Wenn ich wieder ein Berliner Beispiel benutze,
so ist es selbstverständlich, dass ich nicht den Ber-
liner Katalog im besonderen kritisieren möchte,
sondern nur den Stil dieser Bücher im allgemeinen.
Pieter deHooch. Nr. 820B. Holländischer
Wohnraum. „Neben einer vorn zur Linken stehen-
den Wiege sitzt eine junge Frau, die ihr Kind gestillt
hat und im Begriff ist, ihr Mieder zuzuschnüren.
Ganz rechts unter dem hohen, unten mit Läden ge-
schlossenen Fenster ein Tisch, darauf ein Leuchter
und Krug. Im Vorzimmer zur Rechten* steht ein
kleines Mädchen vor der halboffnen Hausthür,
durch die sich das volle Sonnenlicht nach innen
ergiesst."
Es ist eine Sache für sich, dass das Motiv stoff-
lich missdeutet sein möchte, indem gewiss nicht
* Unmöglich in der Anschauung mit dem Vorausgehenden
zusammen zu bringen.
das Zuschnüren, sondern das Aufschnüren des
Mieders dargestellt ist. Wenn eine Frau ihr Korsett
zunestelt, so muss sie dazu stehn, im Sitzen lässt
sich das schwer machen. Für die Stimmung des
Bildes ist diese Unterscheidung nicht ganz gleichgül-
tig: es ist immer ein Vorteil, wenn man den Inhalt des
kommenden Momentes vorausfühlen kann und das
Bild würde für die Phantasie an Fülle verlieren,
wenn wirklich der Akt der Stillung schon vorbei
wäre. Jetzt ergänzt man unwillkürlich im Wiegen-
korb das verlangende Kind, das beschwichtigende
Zunicken der Mutter wird verständlich und die
Geschichte verläuft nicht pointenlos.
Doch wie gesagt, wir haben hier nur von der
Technik der Beschreibung zu handeln. Die zitierte
Beschreibung ist nicht gut, weil sie, Grosses und
Kleines willkürlich mengend, weder ein klares noch
ein vollständiges Bild des Ganzen giebt. Auch der
angestrengtesten Phantasiearbeit wird es unmöglich
sein, nach dem Text das Bild sich vorzustellen. Eine
gute Beschreibung muss von dem Haupteindruck
ausgehn und die Details dann nach dem Grade ihrer
Wichtigkeit sich folgen lassen. Einer solchen Be-
schreibung wird die nachschafFende Phantasie mühe-
los folgen und zugleich ist sie angesichts des Ori-
ginals ein wirklich wertvoller Führer für das Auge.
Der doppelte Raum; das ist es, was man hier,
auf alle Ferne, zuerst sieht. Ein heller Rück-
raum und ein Vorderraum mit gedämpftem Licht.
Die Figuren, die den Beschauer instinktiv am meisten
anziehn, sitzen so im Raum, dass dieser beständig
als das grössere, umfassendere Moment fühlbar
bleibt. Neben Mutter und Kind darf das Hünd-
chen in der Beschreibung nicht fehlen, es vermittelt
zwischen beiden und stellt den Bewegungszug her,
der durch die zwei Zimmer nach der Ausgangsthür
geht. Diese Thür gewährt zwar keinen Ausblick
ins Freie, wird aber intensiv als Öffnung empfun-
den, weil durch sie „das volle Sonnenlicht sich
nach innen ergiesst", genauer gesagt, weil auf dem
Thürpfosten das höchste Licht liegt und das ganze
Bild darauf angelegt ist, diese warme Helligkeit
durch den Gegensatz des Dunkleren und Kühleren
zur stärksten Wirkung zu bringen.
Erst allmählich detailliert sich jetzt der Raum
nach seinen einzelnen Inhalten. Der Katalog erwähnt
nur das Fenster mit den geschlossenen unteren Lä-
den und den Tisch davor mit Leuchter und Krug.
Warum? Es ist ein willkürlich herausgerissenes
Stück des Ganzen. Von dem grossen Bettgehäuse
ist nicht die Rede, nicht von der Zimmer thür, nicht
53
behren; dagegen wäre hier dann die Art der
Gruppenbildung und der Architekturverwendung
in den Text aufzunehmen. Auch hierin ist man
inkonsequent.
Ein Beispiel: Andrea del Sarto, das grosse
Bild der Maria mit acht Heiligen. Dass Maria in
einer Nische (auf Wolken) erscheint, wird im Kata-
log erwähnt, aber dass eine Treppe vor der Nische
liegt, wird nicht erwähnt, und doch sind diese Stu-
fen noch viel wichtiger als die Nische. Meiner
Meinung nach müsste in diesem Fall aber alles ge-
nannt werden, was für daslvompositionelle bezeich-
nend ist: die Abwechslung von Knie- und Steh-
riguren, das Emporführen von Halbfiguren vom
untern Rahmen her usw. Ja, wenn man ausführ-
lich sein will, auch die in lauter Kontrasten ange-
ordneten Wendungen und Beleuchtungen der Köpfe.
Ich wiederhole, dass ich mir alle diese Angaben
mit einem ganz geringen Aufwand von Worten mög-
lich denke. Es brauchen gar keine Sätze zu sein, nur
Wegweiser. Nötig ist bloss, dass der Verfasser ge-
nau weiss, worauf es in jedem Fall ankommt. Me-
chanisch über einen Leisten lassen sich solche Auf-
gaben freilich nicht erledigen, aber dafür sind es ja
auch nicht Handwerker, sondern ausgebildete Kunst-
historiker, die die Kataloge machen. Um Einseitig-
keiten vorzubeugen, wird ein Zusammenarbeiten
Mehrerer, wie es sich an grossen Museen von selbst
ergiebt, besonders zu empfehlen sein.
Sei es gestattet, ein Beispiel vollständig durchzu-
sprechen, um zu zeigen, wie sich in Summa die
Rechnung nach dem neuen Grundsatz etwa stellen
würde. Wenn ich wieder ein Berliner Beispiel benutze,
so ist es selbstverständlich, dass ich nicht den Ber-
liner Katalog im besonderen kritisieren möchte,
sondern nur den Stil dieser Bücher im allgemeinen.
Pieter deHooch. Nr. 820B. Holländischer
Wohnraum. „Neben einer vorn zur Linken stehen-
den Wiege sitzt eine junge Frau, die ihr Kind gestillt
hat und im Begriff ist, ihr Mieder zuzuschnüren.
Ganz rechts unter dem hohen, unten mit Läden ge-
schlossenen Fenster ein Tisch, darauf ein Leuchter
und Krug. Im Vorzimmer zur Rechten* steht ein
kleines Mädchen vor der halboffnen Hausthür,
durch die sich das volle Sonnenlicht nach innen
ergiesst."
Es ist eine Sache für sich, dass das Motiv stoff-
lich missdeutet sein möchte, indem gewiss nicht
* Unmöglich in der Anschauung mit dem Vorausgehenden
zusammen zu bringen.
das Zuschnüren, sondern das Aufschnüren des
Mieders dargestellt ist. Wenn eine Frau ihr Korsett
zunestelt, so muss sie dazu stehn, im Sitzen lässt
sich das schwer machen. Für die Stimmung des
Bildes ist diese Unterscheidung nicht ganz gleichgül-
tig: es ist immer ein Vorteil, wenn man den Inhalt des
kommenden Momentes vorausfühlen kann und das
Bild würde für die Phantasie an Fülle verlieren,
wenn wirklich der Akt der Stillung schon vorbei
wäre. Jetzt ergänzt man unwillkürlich im Wiegen-
korb das verlangende Kind, das beschwichtigende
Zunicken der Mutter wird verständlich und die
Geschichte verläuft nicht pointenlos.
Doch wie gesagt, wir haben hier nur von der
Technik der Beschreibung zu handeln. Die zitierte
Beschreibung ist nicht gut, weil sie, Grosses und
Kleines willkürlich mengend, weder ein klares noch
ein vollständiges Bild des Ganzen giebt. Auch der
angestrengtesten Phantasiearbeit wird es unmöglich
sein, nach dem Text das Bild sich vorzustellen. Eine
gute Beschreibung muss von dem Haupteindruck
ausgehn und die Details dann nach dem Grade ihrer
Wichtigkeit sich folgen lassen. Einer solchen Be-
schreibung wird die nachschafFende Phantasie mühe-
los folgen und zugleich ist sie angesichts des Ori-
ginals ein wirklich wertvoller Führer für das Auge.
Der doppelte Raum; das ist es, was man hier,
auf alle Ferne, zuerst sieht. Ein heller Rück-
raum und ein Vorderraum mit gedämpftem Licht.
Die Figuren, die den Beschauer instinktiv am meisten
anziehn, sitzen so im Raum, dass dieser beständig
als das grössere, umfassendere Moment fühlbar
bleibt. Neben Mutter und Kind darf das Hünd-
chen in der Beschreibung nicht fehlen, es vermittelt
zwischen beiden und stellt den Bewegungszug her,
der durch die zwei Zimmer nach der Ausgangsthür
geht. Diese Thür gewährt zwar keinen Ausblick
ins Freie, wird aber intensiv als Öffnung empfun-
den, weil durch sie „das volle Sonnenlicht sich
nach innen ergiesst", genauer gesagt, weil auf dem
Thürpfosten das höchste Licht liegt und das ganze
Bild darauf angelegt ist, diese warme Helligkeit
durch den Gegensatz des Dunkleren und Kühleren
zur stärksten Wirkung zu bringen.
Erst allmählich detailliert sich jetzt der Raum
nach seinen einzelnen Inhalten. Der Katalog erwähnt
nur das Fenster mit den geschlossenen unteren Lä-
den und den Tisch davor mit Leuchter und Krug.
Warum? Es ist ein willkürlich herausgerissenes
Stück des Ganzen. Von dem grossen Bettgehäuse
ist nicht die Rede, nicht von der Zimmer thür, nicht
53