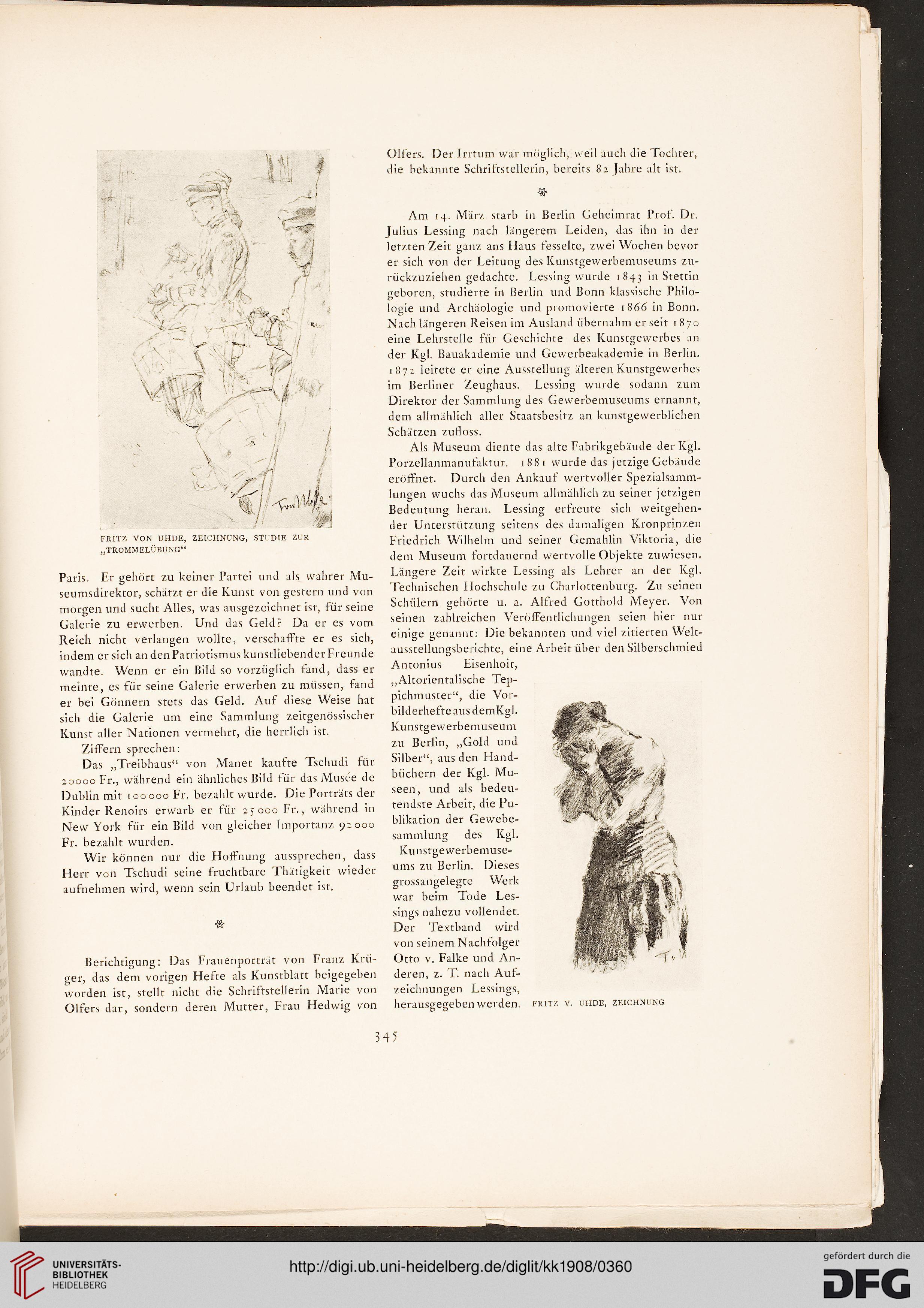J
r
f1
FRITZ VON UHDE, ZEICHNUNG, STI DIE ZUR
„TROMMELÜBUNG"
Paris. Er gehört zu keiner Partei und als wahrer Mu-
seumsdirektor, schätzt er die Kunst von gestern und von
morgen und sucht Alles, was ausgezeichnet ist, für seine
Galerie zu erwerben. Und das Geld? Da er es vom
Reich nicht verlangen wollte, verschaffte er es sich,
indem er sich an den Patriotismus kunstliebender Freunde
wandte. Wenn er ein Bild so vorzüglich fand, dass er
meinte, es für seine Galerie erwerben zu müssen, fand
er bei Gönnern stets das Geld. Auf diese Weise hat
sich die Galerie um eine Sammlung zeitgenössischer
Kunst aller Nationen vermehrt, die herrlich ist.
Ziffern sprechen:
Das „Treibhaus" von Manet kaufte Tschudi für
20000 Fr., während ein ähnliches Bild i'ür das Musee de
Dublin mit 100000 Fr. bezahlt wurde. Die Porträts der
Kinder Renoirs erwarb er für :;ooo Fr., während in
New York für ein Bild von gleicher Importanz 91000
Fr. bezahlt wurden.
Wir können nur die Hoffnung aussprechen, dass
Herr von Tschudi seine fruchtbare Thätigkeit wieder
aufnehmen wird, wenn sein Urlaub beendet ist.
Berichtigung: Das Frauenporträt von Franz Krü-
ger, das dem vorigen Hefte als Kunstblatt beigegeben
worden ist, stellt nicht die Schriftstellerin Marie von
Olfers dar, sondern deren Mutter, Frau Hedwig von
Olfers. Der Irrtum war möglich, weil auch die Tochter,
die bekannte Schriftstellerin, bereits 82 Jahre alt ist.
Am 14. März starb in Berlin Geheimrat Prof. Dr.
Julius Lessing nach längerem Leiden, das ihn in der
letzten Zeit ganz ans Haus fesselte, zwei Wochen bevor
er sich von der Leitung des Kunstgewerbemuseums zu-
rückzuziehen gedachte. Lessing wurde 1843 in Stettin
geboren, studierte in Berlin und Bonn klassische Philo-
logie und Archäologie und piomovierte 1866 in Bonn.
Nach längeren Reisen im Ausland übernahm er seit 1870
eine Lehrstelle für Geschichte des Kunstgewerbes an
der Kgl. Bauakademie und Gewerbeakademie in Berlin.
1871 leitete er eine Ausstellung älteren Kunstgewerbes
im Berliner Zeughaus. Lessing wurde sodann zum
Direktor der Sammlung des Gewerbemuseums ernannt,
dem allmählich aller Staatsbesitz an kunstgewerblichen
Schätzen zulloss.
Als Museum diente das alte Fabrikgebäude der Kgl.
Porzellanmanufaktur. 1881 wurde das jetzige Gebäude
eröffnet. Durch den Ankauf wertvoller Spezialsamm-
lungen wuchs das Museum allmählich zu seiner jetzigen
Bedeutung heran. Lessing erfreute sich weitgehen-
der Unterstützung seitens des damaligen Kronprinzen
Friedrich Wilhelm und seiner Gemahlin Viktoria, die
dem Museum tortdauernd wertvolle Objekte zuwiesen.
Längere Zeit wirkte Lessing als Lehrer an der Kgl.
ö f ö
Technischen Hochschule zu Charlottenburg. Zu seinen
Schülern gehörte u. a. Alfred Gotthold Meyer. Von
seinen zahlreichen Veröffentlichungen seien hier nur
einige genannt: Die bekannten und viel zitierten Welt-
ausstellungsberichte, eine Arbeit über den Silberschmied
Antonius Eisenhoit,
„Altorientalische Tep-
pichmuster", die Vor-
bilderhefte aus demKgl.
Kunstgewerbemuseum
zu Berlin, „Gold und
Silber", aus den Hand-
büchern der Kgl. Mu-
seen, und als bedeu-
tendste Arbeit, die Pu-
blikation der Gewebe-
sammlung des Kgl.
Kunstgewerbemuse-
ums zu Berlin. Dieses
grossangelegte Werk
war beim Tode Les-
sings nahezu vollendet.
Der Textband wird
von seinem Nachfolger
Otto v. Falke und An-
deren, z. T. nach Auf-
zeichnungen Lessings,
herausgegeben werden, fkit/, v. uhde, Zeichnung
345
r
f1
FRITZ VON UHDE, ZEICHNUNG, STI DIE ZUR
„TROMMELÜBUNG"
Paris. Er gehört zu keiner Partei und als wahrer Mu-
seumsdirektor, schätzt er die Kunst von gestern und von
morgen und sucht Alles, was ausgezeichnet ist, für seine
Galerie zu erwerben. Und das Geld? Da er es vom
Reich nicht verlangen wollte, verschaffte er es sich,
indem er sich an den Patriotismus kunstliebender Freunde
wandte. Wenn er ein Bild so vorzüglich fand, dass er
meinte, es für seine Galerie erwerben zu müssen, fand
er bei Gönnern stets das Geld. Auf diese Weise hat
sich die Galerie um eine Sammlung zeitgenössischer
Kunst aller Nationen vermehrt, die herrlich ist.
Ziffern sprechen:
Das „Treibhaus" von Manet kaufte Tschudi für
20000 Fr., während ein ähnliches Bild i'ür das Musee de
Dublin mit 100000 Fr. bezahlt wurde. Die Porträts der
Kinder Renoirs erwarb er für :;ooo Fr., während in
New York für ein Bild von gleicher Importanz 91000
Fr. bezahlt wurden.
Wir können nur die Hoffnung aussprechen, dass
Herr von Tschudi seine fruchtbare Thätigkeit wieder
aufnehmen wird, wenn sein Urlaub beendet ist.
Berichtigung: Das Frauenporträt von Franz Krü-
ger, das dem vorigen Hefte als Kunstblatt beigegeben
worden ist, stellt nicht die Schriftstellerin Marie von
Olfers dar, sondern deren Mutter, Frau Hedwig von
Olfers. Der Irrtum war möglich, weil auch die Tochter,
die bekannte Schriftstellerin, bereits 82 Jahre alt ist.
Am 14. März starb in Berlin Geheimrat Prof. Dr.
Julius Lessing nach längerem Leiden, das ihn in der
letzten Zeit ganz ans Haus fesselte, zwei Wochen bevor
er sich von der Leitung des Kunstgewerbemuseums zu-
rückzuziehen gedachte. Lessing wurde 1843 in Stettin
geboren, studierte in Berlin und Bonn klassische Philo-
logie und Archäologie und piomovierte 1866 in Bonn.
Nach längeren Reisen im Ausland übernahm er seit 1870
eine Lehrstelle für Geschichte des Kunstgewerbes an
der Kgl. Bauakademie und Gewerbeakademie in Berlin.
1871 leitete er eine Ausstellung älteren Kunstgewerbes
im Berliner Zeughaus. Lessing wurde sodann zum
Direktor der Sammlung des Gewerbemuseums ernannt,
dem allmählich aller Staatsbesitz an kunstgewerblichen
Schätzen zulloss.
Als Museum diente das alte Fabrikgebäude der Kgl.
Porzellanmanufaktur. 1881 wurde das jetzige Gebäude
eröffnet. Durch den Ankauf wertvoller Spezialsamm-
lungen wuchs das Museum allmählich zu seiner jetzigen
Bedeutung heran. Lessing erfreute sich weitgehen-
der Unterstützung seitens des damaligen Kronprinzen
Friedrich Wilhelm und seiner Gemahlin Viktoria, die
dem Museum tortdauernd wertvolle Objekte zuwiesen.
Längere Zeit wirkte Lessing als Lehrer an der Kgl.
ö f ö
Technischen Hochschule zu Charlottenburg. Zu seinen
Schülern gehörte u. a. Alfred Gotthold Meyer. Von
seinen zahlreichen Veröffentlichungen seien hier nur
einige genannt: Die bekannten und viel zitierten Welt-
ausstellungsberichte, eine Arbeit über den Silberschmied
Antonius Eisenhoit,
„Altorientalische Tep-
pichmuster", die Vor-
bilderhefte aus demKgl.
Kunstgewerbemuseum
zu Berlin, „Gold und
Silber", aus den Hand-
büchern der Kgl. Mu-
seen, und als bedeu-
tendste Arbeit, die Pu-
blikation der Gewebe-
sammlung des Kgl.
Kunstgewerbemuse-
ums zu Berlin. Dieses
grossangelegte Werk
war beim Tode Les-
sings nahezu vollendet.
Der Textband wird
von seinem Nachfolger
Otto v. Falke und An-
deren, z. T. nach Auf-
zeichnungen Lessings,
herausgegeben werden, fkit/, v. uhde, Zeichnung
345