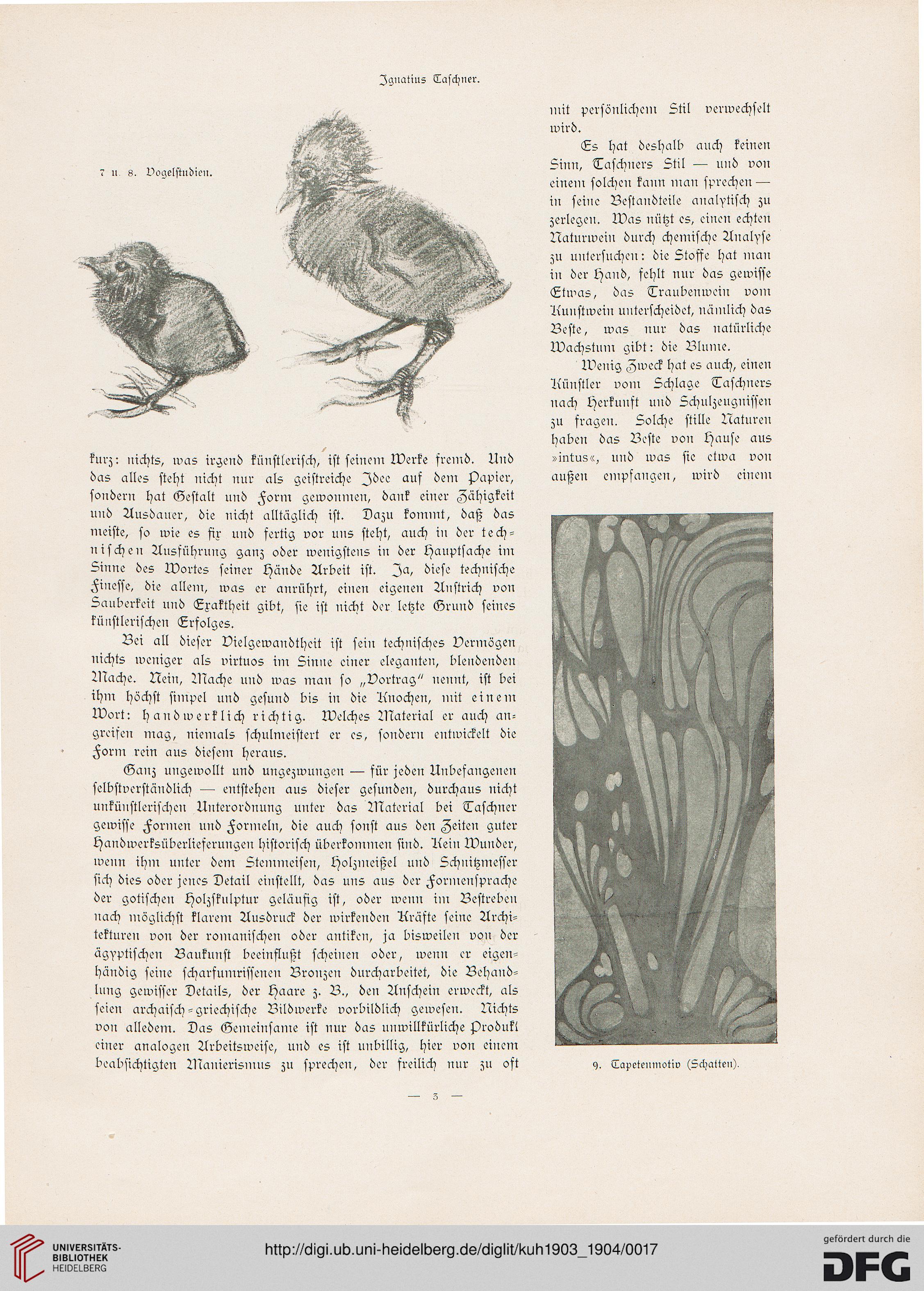Ignatius Taschner.
/
kurz: nichts, was irgend künstlerisch- ist seinem Merke fremd. Und
das alles steht nicht nur als geistreiche Idee auf dem Papier,
sondern hat Gestalt und Form gcwonmen, dank einer Zähigkeit
und Ausdauer, die nicht alltäglich ist. Dazu kommt, daß das
meiste, so wie es fix und fertig vor uns steht, auch in der tech-
nischen Ausführung ganz oder wenigstens in der Hauptsache im
Sinne des Wortes seiner pände Arbeit ist. Ja, diese technische
Finesse, die allein, was er anrührt, eilten eigeneit Anstrich von
Sauberkeit und Exaktheit gibt, sie ist nicht der letzte Grund seines
künstlerischen Erfolges.
Bei all dieser Dielgewandtheit ist sein technisches Vermögen
nichts weniger als virtuos im Sinne einer eleganten, blendenden
Mache. Nein, wache und was man so „Vortrag" nennt, ist bei
ihm höchst sintpel und gesund bis in die Knochen, mit einem
Wort: handwerklich richtig, welches Material er auch an-
grcifen mag, niemals schulmeistert er cs, sondern entwickelt die
Form rein aus diesen: heraus.
Ganz ungewollt und ungezwungen — für jeden Unbefangenen
selbstverständlich —■ entstehen aus dieser gesunden, durchaus nicht
unkünstlerischen Unterordnung unter das Material bei Taschner
gewisse Fornten und Formeln, die auch sonst aus den Zeiten guter
pandwerksüberlieferungen historisch überkommen sind. Kein Wunder,
wenn ihn: unter dem Stentmeisen, polzmeißel und Schnitzmesser
sich dies oder jenes Detail einstellt, das uns aus der Formensprache
der gotischen Polzskulptur geläufig ist, oder wenn in: Bestreben
nach möglichst klarem Ausdruck der wirkenden Kräfte seine Archi-
tekturen von der romanischen oder antiken, ja bisweilen von der
ägyptischen Baukunst beeinflußt scheinen oder, wenn er eigen-
händig seine scharfumrissenen Bronzen durcharbeitet, die Behand-
lung gewisser Details, der paare z. B., den Anschein erweckt, als
feieit archaisch-griechische Bildwerke vorbildlich gewesen. Nichts
voit alledem. Das Gemeinsante ist nur das unwillkürliche Produkt
einer analogen Arbeitsweise, und es ist unbillig, hier von einem
beabsichtigten Manierisinus zu sprechen, der freilich nur zu oft
mit persönlichem Stil verwechselt
wird.
Es hat deshalb auch keinen
Sinn, Taschners Stil — und von
einem solchen kann inan sprechen—-
in seine Bestandteile analytisch zu
zerlegen, was nützt cs, einen echten
Naturweilt durch chemische Analyse
zu untersuchen: die Stoffe hat man
in der pand, fehlt nur das gewisse
Etwas, das Traubenwein von:
Kunstwein unterscheidet, näiitlich das
Beste, was nur das natürliche
Wachstuin gibt: die Blume.
wenig Zweck hat es auch, einen
Künstler vom Schlage Taschners
nach perkunft und Schulzeugnissen
zu fragen. Solche stille Naturen
haben das Beste von Pause aus
»intus«, und was sic etwa voit
außen empfangen, wird einem
q. Tapetenmotiv (Schutte»).
/
kurz: nichts, was irgend künstlerisch- ist seinem Merke fremd. Und
das alles steht nicht nur als geistreiche Idee auf dem Papier,
sondern hat Gestalt und Form gcwonmen, dank einer Zähigkeit
und Ausdauer, die nicht alltäglich ist. Dazu kommt, daß das
meiste, so wie es fix und fertig vor uns steht, auch in der tech-
nischen Ausführung ganz oder wenigstens in der Hauptsache im
Sinne des Wortes seiner pände Arbeit ist. Ja, diese technische
Finesse, die allein, was er anrührt, eilten eigeneit Anstrich von
Sauberkeit und Exaktheit gibt, sie ist nicht der letzte Grund seines
künstlerischen Erfolges.
Bei all dieser Dielgewandtheit ist sein technisches Vermögen
nichts weniger als virtuos im Sinne einer eleganten, blendenden
Mache. Nein, wache und was man so „Vortrag" nennt, ist bei
ihm höchst sintpel und gesund bis in die Knochen, mit einem
Wort: handwerklich richtig, welches Material er auch an-
grcifen mag, niemals schulmeistert er cs, sondern entwickelt die
Form rein aus diesen: heraus.
Ganz ungewollt und ungezwungen — für jeden Unbefangenen
selbstverständlich —■ entstehen aus dieser gesunden, durchaus nicht
unkünstlerischen Unterordnung unter das Material bei Taschner
gewisse Fornten und Formeln, die auch sonst aus den Zeiten guter
pandwerksüberlieferungen historisch überkommen sind. Kein Wunder,
wenn ihn: unter dem Stentmeisen, polzmeißel und Schnitzmesser
sich dies oder jenes Detail einstellt, das uns aus der Formensprache
der gotischen Polzskulptur geläufig ist, oder wenn in: Bestreben
nach möglichst klarem Ausdruck der wirkenden Kräfte seine Archi-
tekturen von der romanischen oder antiken, ja bisweilen von der
ägyptischen Baukunst beeinflußt scheinen oder, wenn er eigen-
händig seine scharfumrissenen Bronzen durcharbeitet, die Behand-
lung gewisser Details, der paare z. B., den Anschein erweckt, als
feieit archaisch-griechische Bildwerke vorbildlich gewesen. Nichts
voit alledem. Das Gemeinsante ist nur das unwillkürliche Produkt
einer analogen Arbeitsweise, und es ist unbillig, hier von einem
beabsichtigten Manierisinus zu sprechen, der freilich nur zu oft
mit persönlichem Stil verwechselt
wird.
Es hat deshalb auch keinen
Sinn, Taschners Stil — und von
einem solchen kann inan sprechen—-
in seine Bestandteile analytisch zu
zerlegen, was nützt cs, einen echten
Naturweilt durch chemische Analyse
zu untersuchen: die Stoffe hat man
in der pand, fehlt nur das gewisse
Etwas, das Traubenwein von:
Kunstwein unterscheidet, näiitlich das
Beste, was nur das natürliche
Wachstuin gibt: die Blume.
wenig Zweck hat es auch, einen
Künstler vom Schlage Taschners
nach perkunft und Schulzeugnissen
zu fragen. Solche stille Naturen
haben das Beste von Pause aus
»intus«, und was sic etwa voit
außen empfangen, wird einem
q. Tapetenmotiv (Schutte»).