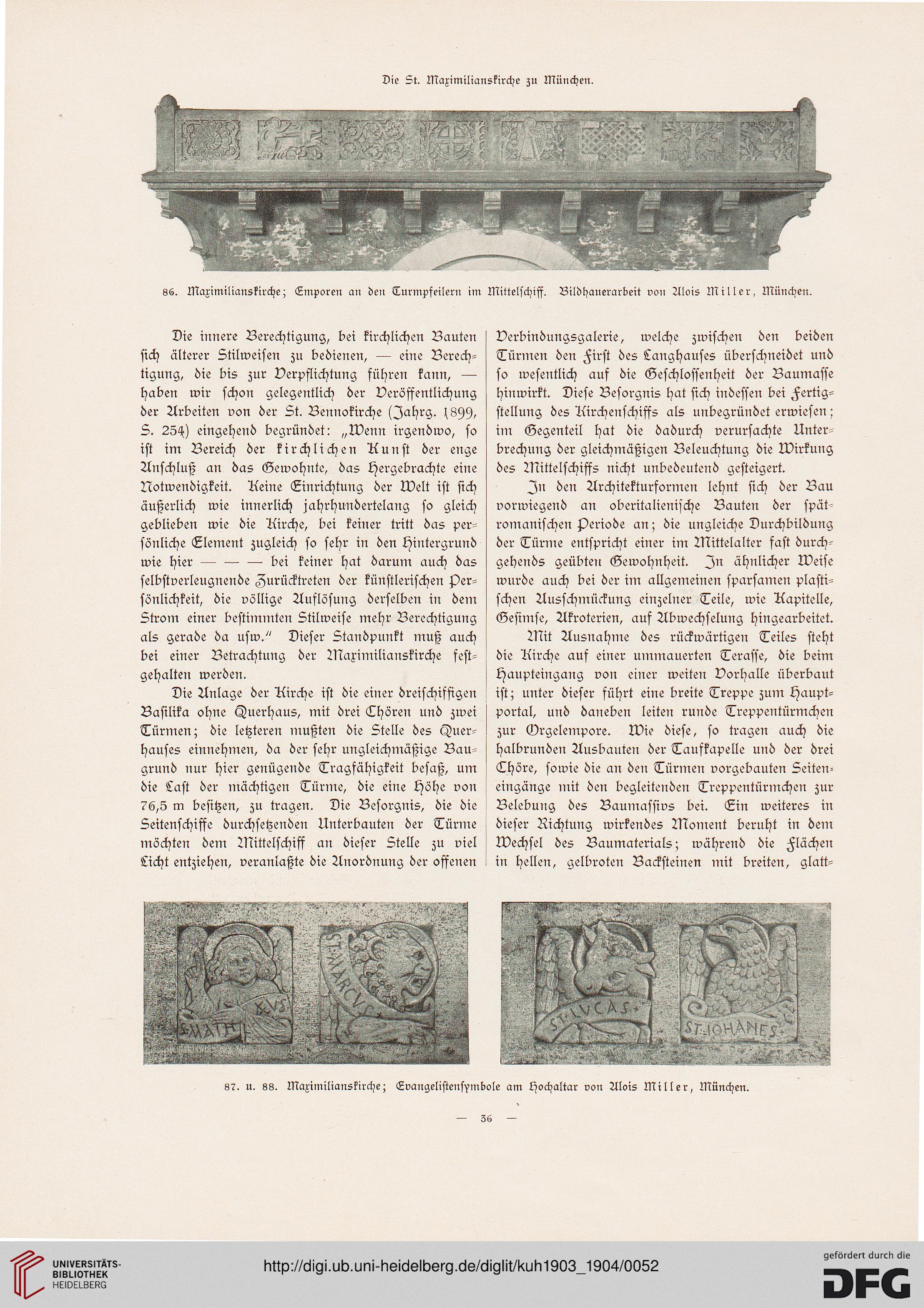Die St. Maximilianskirche zu München.
66. Maximilianskirche; Emporen an den Turmpfeilern im Mittelschiff. Bildhanerarbeit von Alois Miller. München.
Die innere Berechtigung, bei kirchlichen Bauten
sich älterer Stilweisen zu bedienen, — eine Berech-
tigung, die bis zur Verpflichtung führen kann, —
haben wir schon gelegentlich der Veröffentlichung
der Arbeiten von der 5t. Bennokirche (Iahrg. f8si9,
S. 254) eingehend begründet: „Wenn irgendwo, so
ist im Bereich der kirchlichen Kunst der enge
Altschluß an das Gewohnte, das hergebrachte eine
Notwendigkeit. Keine Einrichtung der Welt ist sich
äußerlich wie innerlich jahrhundertelang so gleich
geblieben wie die Kirche, bei keiner tritt das per-
sönliche Element zugleich so sehr in den Hintergrund
wie hier —-bei keiner hat darum auch das
selbstverleugnende Zurücktreten der künstlerischen Per-
sönlichkeit, die völlige Auslösung derselben in dem
Strom einer bestinrmten Stilweise mehr Berechtigung
als gerade da ufw." Dieser Standpunkt ntuß auch
bei einer Betrachtung der Waximilianskirche fest-
gehalten werden.
Die Anlage der Kirche ist die einer dreifchiffigen
Basilika ohne Querhaus, mit drei Ehören und zwei
Türmen; die letzteren mußten die Stelle des Quer-
hauses einnehmen, da der sehr ungleichmäßige Bau -
grund nur hier genügende Tragfähigkeit besaß, um
die Last der mächtigen Türme, die eine höhe voit
76,5 m besitzen, zu tragen. Die Besorgnis, die die
Seitenschiffe durchsetzendett Unterbauten der Türme
möchten dem Wittelschiff an dieser Stelle zu viel
Licht entziehen, veranlaßte die Anordnung der offetien
Verbindungsgalerie, welche zwischen den beiden
Türmen den First des Langhauses überschneidet und
so wesentlich auf die Geschlossenheit der Baumasse
hitiwirkt. Diese Besorgnis hat sich indessen bei Fertig-
stellung des Kirchenschiffs als unbegründet erwiesen;
int Gegenteil hat die dadurch verursachte Unter-
brechung der gleichntäßigen Beleuchtung die Wirkung
des Wittelschiffs nicht unbedeutend gesteigert.
In den Architekturformen lehnt sich der Bau
vorwiegend an oberitalienische Bauten der spät
romanischen Periode an; die ungleiche Durchbildung
der Türme entspricht einer im Wittelalter fast durch-
gehends geübten Gewohnheit. In ähnlicher Weise
wurde auch bei der im allgemeinen sparsamen plasti-
schen Ausschmückung einzelner Teile, wie Kapitelle,
Gesimse, Akroterien, aus Abwechselung hingearbeitet.
Nit Ausnahme des rückwärtigen Teiles steht
die Kirche auf einer ummauerten Teraffe, die beim
Haupteingang von einer weiten Vorhalle überbaut
ist; unter dieser führt eine breite Treppe zum Haupt-
portal, und daneben leiten runde Treppentürmchen
zur Orgelempore. Wie diese, so tragen auch die
halbrunden Ausbauten der Taufkapelle und der drei
Ehöre, sowie die an den Türmen vorgebauten Seiten-
eingänge mit den begleitenden Treppentürmchen zur
Belebung des Baumassivs bei. Ein weiteres in
dieser Richtung wirkendes Woment beruht in detn
Wechsel des Baumaterials; während die Flächen
in Hellen, gelbroten Backsteinen mit breiten, glatt-
87. u. 88. Maximilianskirche; Lvangelistenfyntbole am Hochaltar von Alois Miller, München.
36
66. Maximilianskirche; Emporen an den Turmpfeilern im Mittelschiff. Bildhanerarbeit von Alois Miller. München.
Die innere Berechtigung, bei kirchlichen Bauten
sich älterer Stilweisen zu bedienen, — eine Berech-
tigung, die bis zur Verpflichtung führen kann, —
haben wir schon gelegentlich der Veröffentlichung
der Arbeiten von der 5t. Bennokirche (Iahrg. f8si9,
S. 254) eingehend begründet: „Wenn irgendwo, so
ist im Bereich der kirchlichen Kunst der enge
Altschluß an das Gewohnte, das hergebrachte eine
Notwendigkeit. Keine Einrichtung der Welt ist sich
äußerlich wie innerlich jahrhundertelang so gleich
geblieben wie die Kirche, bei keiner tritt das per-
sönliche Element zugleich so sehr in den Hintergrund
wie hier —-bei keiner hat darum auch das
selbstverleugnende Zurücktreten der künstlerischen Per-
sönlichkeit, die völlige Auslösung derselben in dem
Strom einer bestinrmten Stilweise mehr Berechtigung
als gerade da ufw." Dieser Standpunkt ntuß auch
bei einer Betrachtung der Waximilianskirche fest-
gehalten werden.
Die Anlage der Kirche ist die einer dreifchiffigen
Basilika ohne Querhaus, mit drei Ehören und zwei
Türmen; die letzteren mußten die Stelle des Quer-
hauses einnehmen, da der sehr ungleichmäßige Bau -
grund nur hier genügende Tragfähigkeit besaß, um
die Last der mächtigen Türme, die eine höhe voit
76,5 m besitzen, zu tragen. Die Besorgnis, die die
Seitenschiffe durchsetzendett Unterbauten der Türme
möchten dem Wittelschiff an dieser Stelle zu viel
Licht entziehen, veranlaßte die Anordnung der offetien
Verbindungsgalerie, welche zwischen den beiden
Türmen den First des Langhauses überschneidet und
so wesentlich auf die Geschlossenheit der Baumasse
hitiwirkt. Diese Besorgnis hat sich indessen bei Fertig-
stellung des Kirchenschiffs als unbegründet erwiesen;
int Gegenteil hat die dadurch verursachte Unter-
brechung der gleichntäßigen Beleuchtung die Wirkung
des Wittelschiffs nicht unbedeutend gesteigert.
In den Architekturformen lehnt sich der Bau
vorwiegend an oberitalienische Bauten der spät
romanischen Periode an; die ungleiche Durchbildung
der Türme entspricht einer im Wittelalter fast durch-
gehends geübten Gewohnheit. In ähnlicher Weise
wurde auch bei der im allgemeinen sparsamen plasti-
schen Ausschmückung einzelner Teile, wie Kapitelle,
Gesimse, Akroterien, aus Abwechselung hingearbeitet.
Nit Ausnahme des rückwärtigen Teiles steht
die Kirche auf einer ummauerten Teraffe, die beim
Haupteingang von einer weiten Vorhalle überbaut
ist; unter dieser führt eine breite Treppe zum Haupt-
portal, und daneben leiten runde Treppentürmchen
zur Orgelempore. Wie diese, so tragen auch die
halbrunden Ausbauten der Taufkapelle und der drei
Ehöre, sowie die an den Türmen vorgebauten Seiten-
eingänge mit den begleitenden Treppentürmchen zur
Belebung des Baumassivs bei. Ein weiteres in
dieser Richtung wirkendes Woment beruht in detn
Wechsel des Baumaterials; während die Flächen
in Hellen, gelbroten Backsteinen mit breiten, glatt-
87. u. 88. Maximilianskirche; Lvangelistenfyntbole am Hochaltar von Alois Miller, München.
36