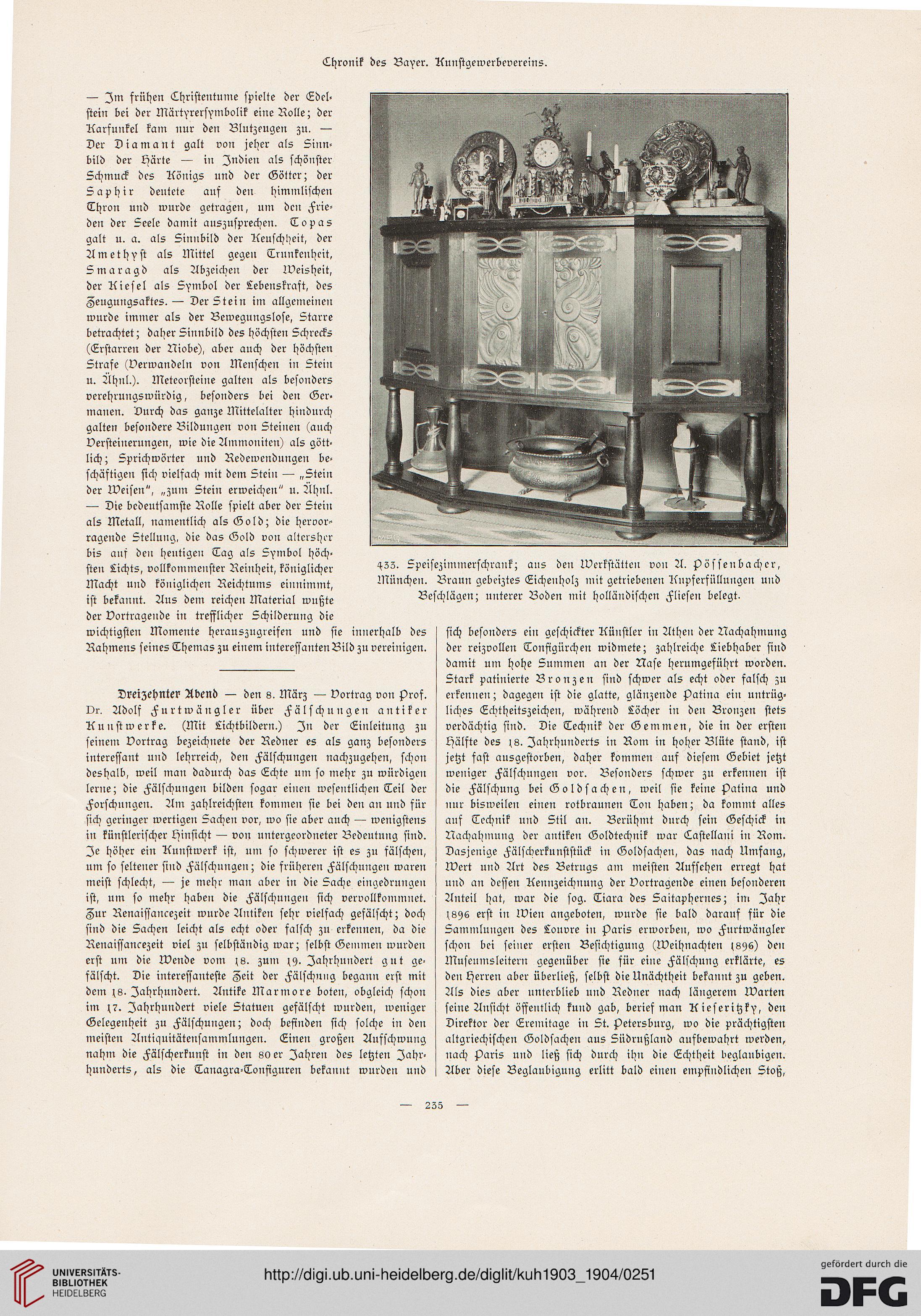Ehronik des Bayer. Kunstgewerbevereins.
433. Sxeisezimmerschrank; aus den Werkstätten von A. Pössenbachcr,
München. Braun gebeiztes Eichenholz mit getriebenen Knpferfüllungcn und
Beschlägen; unterer Loden mit holländischen Fliesen belegt.
— 3m frühen Ehristentume spielte der Edel-
stein bei der Märtyrersymbolik eine Rolle; der
Karfunkel kain nur den Blutzeugen zu. —
Der Diamant galt von jeher als Sinn-
bild der kjärte — in Indien als schönster
Schmuck des Königs und der Götter; der
Saphir deutete ans den himmlischen
Thron und wurde getragen, um den Frie-
den der Seele damit auszusprechen. Topas
galt u. a. als Sinnbild der Keuschheit, der
Amethyst als Mittel gegen Trunkenheit,
Smaragd als Abzeichen der Weisheit,
der Kiesel als Symbol der Lebenskraft, des
Zeugungsaktes.— Der Stein im allgemeinen
wurde immer als der Bewegungslose, Starre
betrachtet; daher Sinnbild des höchsten Schrecks
(Erstarren der Niobe), aber auch der höchsten
Strafe (Derwandeln von Menschen in Stein
u. Ähnl.). Meteorsteine galten als besonders
vcrehrungswürdig, besonders bei den Ger-
manen. Durch das ganze Mittelalter hindurch
galten besondere Bildungen von Steinen (auch
Dersteinerungen, wie die Ammoniten) als gött-
lich; Sprichwörter und Redewendungen be-
schäftigen sich vielfach mit dem Stein — „Stein
der Weisen", „zum Stein erweichen" n. Ahnl.
— Die bedeutsamste Rolle spielt aber der Stein
als Metall, namentlich als Gold; die hervor-
ragende Stellung, die das Gold von altersher
bis auf den heutigen Tag als Symbol höch-
sten Lichts, vollkommenster Reinheit, königlicher
Macht und königlichen Reichtums einnimmt,
ist bekannt. Aus dem reichen Material wußte
der Dortragende in trefflicher Schilderung die
wichtigsten Momente herauszugreifen und sie innerhalb des
Rahmens seines Themas zu einem interessanten Bild zu vereinigen.
Dreizehnter Abend — den 8. März — Dortrag von Prof.
Or. Adolf Furtwängler über Fälschungen antiker
Kunstwerke. (Mit Lichtbildern.) Iu der Einleitung zu
seinem Dortrag bezeichnete der Redner es als ganz besonders
interessant und lehrreich, den Fälschungen nachzugehen, schon
deshalb, weil man dadurch das Echte um so inehr zu würdigen
lerne; die Fälschungen bilden sogar einen wesentlichen Teil der
Forschungen. Am zahlreichsten kommen sie bei den an und für
sich geringer wertigen Sachen vor, wo sie aber auch — wenigstens
in künstlerischer Einsicht — von untergeordneter Bedeutung sind.
Je höher ein Kunstwerk ist, um so schwerer ist es zu fälschen,
um so seltener sind Fälschungen; die früheren Fälschungen waren
meist schlecht, — je mehr man aber in die Sache eingedrungen
ist, UM so mehr haben die Fälschungen sich vervollkommnet.
Zur Renaissaucezeit wurde Antiken sehr vielfach gefälscht; doch
sind die Sachen leicht als echt oder falsch zu erkennen, da die
Renaissaneezeit viel zu selbständig war; selbst Gemmen wurden
erst um die Wende vom *8. zum Jahrhundert gut ge-
fälscht. Die interessanteste Zeit der Fälschung begann erst mit
dem ^8. Jahrhundert. Antike Marmore boten, obgleich schon
im \7. Jahrhundert viele Statuen gefälscht wurden, weniger
Gelegenheit zu Fälschungen; doch befinden sich solche in den
meisten Antiquitätensammlungen. Einen großen Aufschwung
nahin die Fälscherknnst in den 80 er Jahren des letzten Jahr-
hunderts, als die Tanagra-Tonfiguren bekannt wurden und
sich besonders ein geschickter Künstler in Athen der Nachahmung
der reizvollen Tonfigürchen widmete; zahlreiche Liebhaber sind
damit um hohe Summen an der Nase herumgeführt worden.
Stark xatinierte Bronzen sind schwer als echt oder falsch zu
erkennen; dagegen ist die glatte, glänzende Patina ein untrüg-
liches Echtheitszeichen, während Löcher in den Bronzen stets
verdächtig sind. Die Technik der Gemmen, die in der ersten
thälfte des ;8. Jahrhunderts in Rom in hoher Blüte stand, ist
jetzt fast ausgestorben, daher kommen auf diesem Gebiet jetzt
weniger Fälschungen vor. Besonders schwer zu erkennen ist
die Fälschung bei Goldsachen, weil sie keine Patina und
nur bisweilen einen rotbraunen Ton haben; da kommt alles
auf Technik und Stil an. Berühmt durch fein Geschick in
Nachahmung der antiken Goldtcchnik war Eastellani in Rom.
Dasjenige Fälscbcrkunststück in Goldsachen, das nach Umfang,
Wert und Art des Betrugs am ineisten Aufsehen erregt hat
und an dessen Kennzeichnung der Dortragende einen besonderen
Anteil hat, war die sog. Tiara des Saitaphernes; im Jahr
Z8A6 erst in Ivien angcboten, wurde sie bald darauf für die
Sammlungen des Louvre in Paris erworben, wo Furtwängler
schon bei seiner ersten Besichtigung (Weihnachten ;8gs) den
Museumsleitern gegenüber sie für eine Fälschung erklärte, es
den Herren aber überließ, selbst die Unächtheit bekannt zu geben.
Als dies aber unterblieb und Redner nach längerem Warten
seine Ansicht öffentlich kund gab, berief man K icserihky, den
Direktor der Ereiuitage in St. Petersburg, wo die prächtigsten
altgriechischeil Goldsachen aus Südrußland aufbewahrt werden,
nach Paris und ließ sich durch ihn die Echtheit beglaubigen.
Aber diese Beglaubigung erlitt bald einen emxfiirdlichen Stoß,
235
433. Sxeisezimmerschrank; aus den Werkstätten von A. Pössenbachcr,
München. Braun gebeiztes Eichenholz mit getriebenen Knpferfüllungcn und
Beschlägen; unterer Loden mit holländischen Fliesen belegt.
— 3m frühen Ehristentume spielte der Edel-
stein bei der Märtyrersymbolik eine Rolle; der
Karfunkel kain nur den Blutzeugen zu. —
Der Diamant galt von jeher als Sinn-
bild der kjärte — in Indien als schönster
Schmuck des Königs und der Götter; der
Saphir deutete ans den himmlischen
Thron und wurde getragen, um den Frie-
den der Seele damit auszusprechen. Topas
galt u. a. als Sinnbild der Keuschheit, der
Amethyst als Mittel gegen Trunkenheit,
Smaragd als Abzeichen der Weisheit,
der Kiesel als Symbol der Lebenskraft, des
Zeugungsaktes.— Der Stein im allgemeinen
wurde immer als der Bewegungslose, Starre
betrachtet; daher Sinnbild des höchsten Schrecks
(Erstarren der Niobe), aber auch der höchsten
Strafe (Derwandeln von Menschen in Stein
u. Ähnl.). Meteorsteine galten als besonders
vcrehrungswürdig, besonders bei den Ger-
manen. Durch das ganze Mittelalter hindurch
galten besondere Bildungen von Steinen (auch
Dersteinerungen, wie die Ammoniten) als gött-
lich; Sprichwörter und Redewendungen be-
schäftigen sich vielfach mit dem Stein — „Stein
der Weisen", „zum Stein erweichen" n. Ahnl.
— Die bedeutsamste Rolle spielt aber der Stein
als Metall, namentlich als Gold; die hervor-
ragende Stellung, die das Gold von altersher
bis auf den heutigen Tag als Symbol höch-
sten Lichts, vollkommenster Reinheit, königlicher
Macht und königlichen Reichtums einnimmt,
ist bekannt. Aus dem reichen Material wußte
der Dortragende in trefflicher Schilderung die
wichtigsten Momente herauszugreifen und sie innerhalb des
Rahmens seines Themas zu einem interessanten Bild zu vereinigen.
Dreizehnter Abend — den 8. März — Dortrag von Prof.
Or. Adolf Furtwängler über Fälschungen antiker
Kunstwerke. (Mit Lichtbildern.) Iu der Einleitung zu
seinem Dortrag bezeichnete der Redner es als ganz besonders
interessant und lehrreich, den Fälschungen nachzugehen, schon
deshalb, weil man dadurch das Echte um so inehr zu würdigen
lerne; die Fälschungen bilden sogar einen wesentlichen Teil der
Forschungen. Am zahlreichsten kommen sie bei den an und für
sich geringer wertigen Sachen vor, wo sie aber auch — wenigstens
in künstlerischer Einsicht — von untergeordneter Bedeutung sind.
Je höher ein Kunstwerk ist, um so schwerer ist es zu fälschen,
um so seltener sind Fälschungen; die früheren Fälschungen waren
meist schlecht, — je mehr man aber in die Sache eingedrungen
ist, UM so mehr haben die Fälschungen sich vervollkommnet.
Zur Renaissaucezeit wurde Antiken sehr vielfach gefälscht; doch
sind die Sachen leicht als echt oder falsch zu erkennen, da die
Renaissaneezeit viel zu selbständig war; selbst Gemmen wurden
erst um die Wende vom *8. zum Jahrhundert gut ge-
fälscht. Die interessanteste Zeit der Fälschung begann erst mit
dem ^8. Jahrhundert. Antike Marmore boten, obgleich schon
im \7. Jahrhundert viele Statuen gefälscht wurden, weniger
Gelegenheit zu Fälschungen; doch befinden sich solche in den
meisten Antiquitätensammlungen. Einen großen Aufschwung
nahin die Fälscherknnst in den 80 er Jahren des letzten Jahr-
hunderts, als die Tanagra-Tonfiguren bekannt wurden und
sich besonders ein geschickter Künstler in Athen der Nachahmung
der reizvollen Tonfigürchen widmete; zahlreiche Liebhaber sind
damit um hohe Summen an der Nase herumgeführt worden.
Stark xatinierte Bronzen sind schwer als echt oder falsch zu
erkennen; dagegen ist die glatte, glänzende Patina ein untrüg-
liches Echtheitszeichen, während Löcher in den Bronzen stets
verdächtig sind. Die Technik der Gemmen, die in der ersten
thälfte des ;8. Jahrhunderts in Rom in hoher Blüte stand, ist
jetzt fast ausgestorben, daher kommen auf diesem Gebiet jetzt
weniger Fälschungen vor. Besonders schwer zu erkennen ist
die Fälschung bei Goldsachen, weil sie keine Patina und
nur bisweilen einen rotbraunen Ton haben; da kommt alles
auf Technik und Stil an. Berühmt durch fein Geschick in
Nachahmung der antiken Goldtcchnik war Eastellani in Rom.
Dasjenige Fälscbcrkunststück in Goldsachen, das nach Umfang,
Wert und Art des Betrugs am ineisten Aufsehen erregt hat
und an dessen Kennzeichnung der Dortragende einen besonderen
Anteil hat, war die sog. Tiara des Saitaphernes; im Jahr
Z8A6 erst in Ivien angcboten, wurde sie bald darauf für die
Sammlungen des Louvre in Paris erworben, wo Furtwängler
schon bei seiner ersten Besichtigung (Weihnachten ;8gs) den
Museumsleitern gegenüber sie für eine Fälschung erklärte, es
den Herren aber überließ, selbst die Unächtheit bekannt zu geben.
Als dies aber unterblieb und Redner nach längerem Warten
seine Ansicht öffentlich kund gab, berief man K icserihky, den
Direktor der Ereiuitage in St. Petersburg, wo die prächtigsten
altgriechischeil Goldsachen aus Südrußland aufbewahrt werden,
nach Paris und ließ sich durch ihn die Echtheit beglaubigen.
Aber diese Beglaubigung erlitt bald einen emxfiirdlichen Stoß,
235