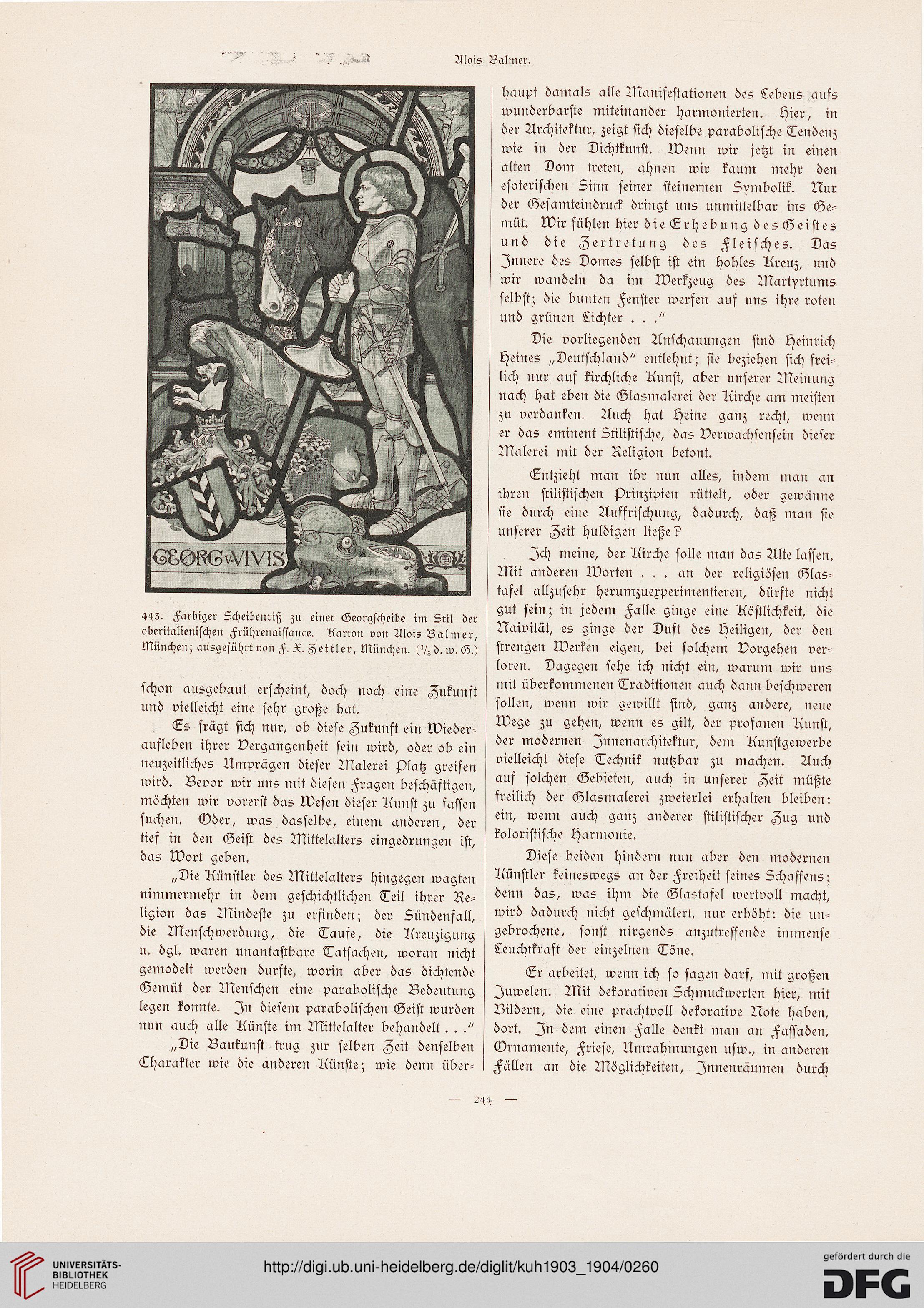Alois Balm er.
443. Farbiger Scheibenriß zu einer Georgschcibe im Stil der
oberitalieuischen Frührenaissance. Karton von Alois Balmer,
München; ausgeführt von F. X. Zeltler, München. ('/5 d. w. G.)
schon ausgebaut erscheint, doch noch eine Zukunft
und vielleicht eine sehr große hat.
<£s fragt sich nur, ob diese Zukunft ein Wieder-
aufleben ihrer Vergangenheit sein wird, oder ob ein
neuzeitliches Umprägen dieser Walerei Platz greifen
wird. Bevor wir uns mit diesen fragen beschäftigeit,
möchten wir vorerst das Wesen dieser Kunst zu fassen
suchen. Oder, was dasselbe, einem anderen, der
tief in den Geist des Mittelalters eingedrungen ist,
das Wort geben.
„Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten
nimmerniehr in den: geschichtlichen Teil ihrer Re-
ligion das Mindeste zu erfinden; der Sündenfall,
die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung
u. dgl. waren unantastbare Tatsachen, woran nicht
gemodelt werden durfte, worin aber das dichtende
Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung
legen konnte. In diesent parabolischen Geist wurden
nun auch alle Künste im Mittelalter behandelt. . ."
„Die Baukunst trug zur selben Zeit denselben
Charakter wie die anderen Künste; wie denn über-
haupt danmls alle Manifestationen des Lebens aufs
wunderbarste miteinander harmonierten. Pier, in
der Architektur, zeigt sich dieselbe parabolische Tendenz
wie in der Dichtkunst. Wenn wir jetzt in einen
alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr den
esoterischen Sinn seiner steinernen Symbolik. Nur
der Gesamteindruck dringt uns unmittelbar ins Ge-
müt. Wir fühlen hier dieErhebung desGeistes
und die Zertretung des Fleisches. Das
Innere des Domes selbst ist ein hohles Kreuz, und
wir wandeln da im Werkzeug des Martyriums
selbst; die bunten Fenster werfen auf uns ihre roten
und grünen Lichter ..."
Die vorliegenden Anschauungen sind peinrich
Peines „Deutschland" entlehnt; sie beziehen sich frei-
lich nur auf kirchliche Kunst, aber unserer Meinung
nach hat eben die Glasmalerei der Kirche am meisten
zu verdanken. Auch hat Peine ganz recht, wenn
er das eminent Stilistische, das Verwachsensein dieser
Malerei mit der Religion betont.
Entzieht man ihr nun alles, indem man an
ihren stilistischen Prinzipien rüttelt, oder gewänne
sie durch eine Auffrischung, dadurch, daß man sie
unserer Zeit huldigen ließe?
Ich meine, der Kirche solle man das Alte lassen.
Mit anderen Worten ... an der religiösen Glas-
tafel allzusehr herumzuexperimentieren, dürfte nicht
gut sein; in jedem Falle ginge eine Köstlichkeit, die
Naivität, es ginge der Duft des peiligen, der den
strengen Werken eigen, bei solchem Vorgehen ver-
loren. Dagegen sehe ich nicht ein, warum wir uns
mit überkommenen Traditionen auch dann beschweren
sollen, wenn wir gewillt sind, ganz andere, neue
Wege zu geheu, wenn es gilt, der profanen Kunst,
der modernen Innenarchitektur, dem Kunstgewerbe
vielleicht diese Technik nutzbar zu machen. Auch
auf solchen Gebieten, auch in unserer Zeit müßte
freilich der Glasmalerei zweierlei erhalten bleiben:
ein, wenn auch ganz anderer stilistischer Zug und
koloristische parmonie.
Diese beiden hindern nun aber den modernen
Künstler keineswegs an der Freiheit seines Schaffens;
denn das, was ihm die Glastafel wertvoll macht,
wird dadurch nicht geschmälert, nur erhöht: die un-
gebrochene, sonst nirgends anzutreffende immense
Leuchtkraft der einzelnen Tone.
Er arbeitet, wenn ich so sagen darf, mit großen
Juwelen. Mit dekorativen Schmuckwerten hier, mit
Bildern, die eine prachtvoll dekorative Note haben,
dort. In dem einen Falle denkt man an Fassaden,
Vrnamente, Friese, Umrahmungen usw., in anderen
Fällen an die Möglichkeiten, Innenräumen durch
443. Farbiger Scheibenriß zu einer Georgschcibe im Stil der
oberitalieuischen Frührenaissance. Karton von Alois Balmer,
München; ausgeführt von F. X. Zeltler, München. ('/5 d. w. G.)
schon ausgebaut erscheint, doch noch eine Zukunft
und vielleicht eine sehr große hat.
<£s fragt sich nur, ob diese Zukunft ein Wieder-
aufleben ihrer Vergangenheit sein wird, oder ob ein
neuzeitliches Umprägen dieser Walerei Platz greifen
wird. Bevor wir uns mit diesen fragen beschäftigeit,
möchten wir vorerst das Wesen dieser Kunst zu fassen
suchen. Oder, was dasselbe, einem anderen, der
tief in den Geist des Mittelalters eingedrungen ist,
das Wort geben.
„Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten
nimmerniehr in den: geschichtlichen Teil ihrer Re-
ligion das Mindeste zu erfinden; der Sündenfall,
die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung
u. dgl. waren unantastbare Tatsachen, woran nicht
gemodelt werden durfte, worin aber das dichtende
Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung
legen konnte. In diesent parabolischen Geist wurden
nun auch alle Künste im Mittelalter behandelt. . ."
„Die Baukunst trug zur selben Zeit denselben
Charakter wie die anderen Künste; wie denn über-
haupt danmls alle Manifestationen des Lebens aufs
wunderbarste miteinander harmonierten. Pier, in
der Architektur, zeigt sich dieselbe parabolische Tendenz
wie in der Dichtkunst. Wenn wir jetzt in einen
alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr den
esoterischen Sinn seiner steinernen Symbolik. Nur
der Gesamteindruck dringt uns unmittelbar ins Ge-
müt. Wir fühlen hier dieErhebung desGeistes
und die Zertretung des Fleisches. Das
Innere des Domes selbst ist ein hohles Kreuz, und
wir wandeln da im Werkzeug des Martyriums
selbst; die bunten Fenster werfen auf uns ihre roten
und grünen Lichter ..."
Die vorliegenden Anschauungen sind peinrich
Peines „Deutschland" entlehnt; sie beziehen sich frei-
lich nur auf kirchliche Kunst, aber unserer Meinung
nach hat eben die Glasmalerei der Kirche am meisten
zu verdanken. Auch hat Peine ganz recht, wenn
er das eminent Stilistische, das Verwachsensein dieser
Malerei mit der Religion betont.
Entzieht man ihr nun alles, indem man an
ihren stilistischen Prinzipien rüttelt, oder gewänne
sie durch eine Auffrischung, dadurch, daß man sie
unserer Zeit huldigen ließe?
Ich meine, der Kirche solle man das Alte lassen.
Mit anderen Worten ... an der religiösen Glas-
tafel allzusehr herumzuexperimentieren, dürfte nicht
gut sein; in jedem Falle ginge eine Köstlichkeit, die
Naivität, es ginge der Duft des peiligen, der den
strengen Werken eigen, bei solchem Vorgehen ver-
loren. Dagegen sehe ich nicht ein, warum wir uns
mit überkommenen Traditionen auch dann beschweren
sollen, wenn wir gewillt sind, ganz andere, neue
Wege zu geheu, wenn es gilt, der profanen Kunst,
der modernen Innenarchitektur, dem Kunstgewerbe
vielleicht diese Technik nutzbar zu machen. Auch
auf solchen Gebieten, auch in unserer Zeit müßte
freilich der Glasmalerei zweierlei erhalten bleiben:
ein, wenn auch ganz anderer stilistischer Zug und
koloristische parmonie.
Diese beiden hindern nun aber den modernen
Künstler keineswegs an der Freiheit seines Schaffens;
denn das, was ihm die Glastafel wertvoll macht,
wird dadurch nicht geschmälert, nur erhöht: die un-
gebrochene, sonst nirgends anzutreffende immense
Leuchtkraft der einzelnen Tone.
Er arbeitet, wenn ich so sagen darf, mit großen
Juwelen. Mit dekorativen Schmuckwerten hier, mit
Bildern, die eine prachtvoll dekorative Note haben,
dort. In dem einen Falle denkt man an Fassaden,
Vrnamente, Friese, Umrahmungen usw., in anderen
Fällen an die Möglichkeiten, Innenräumen durch