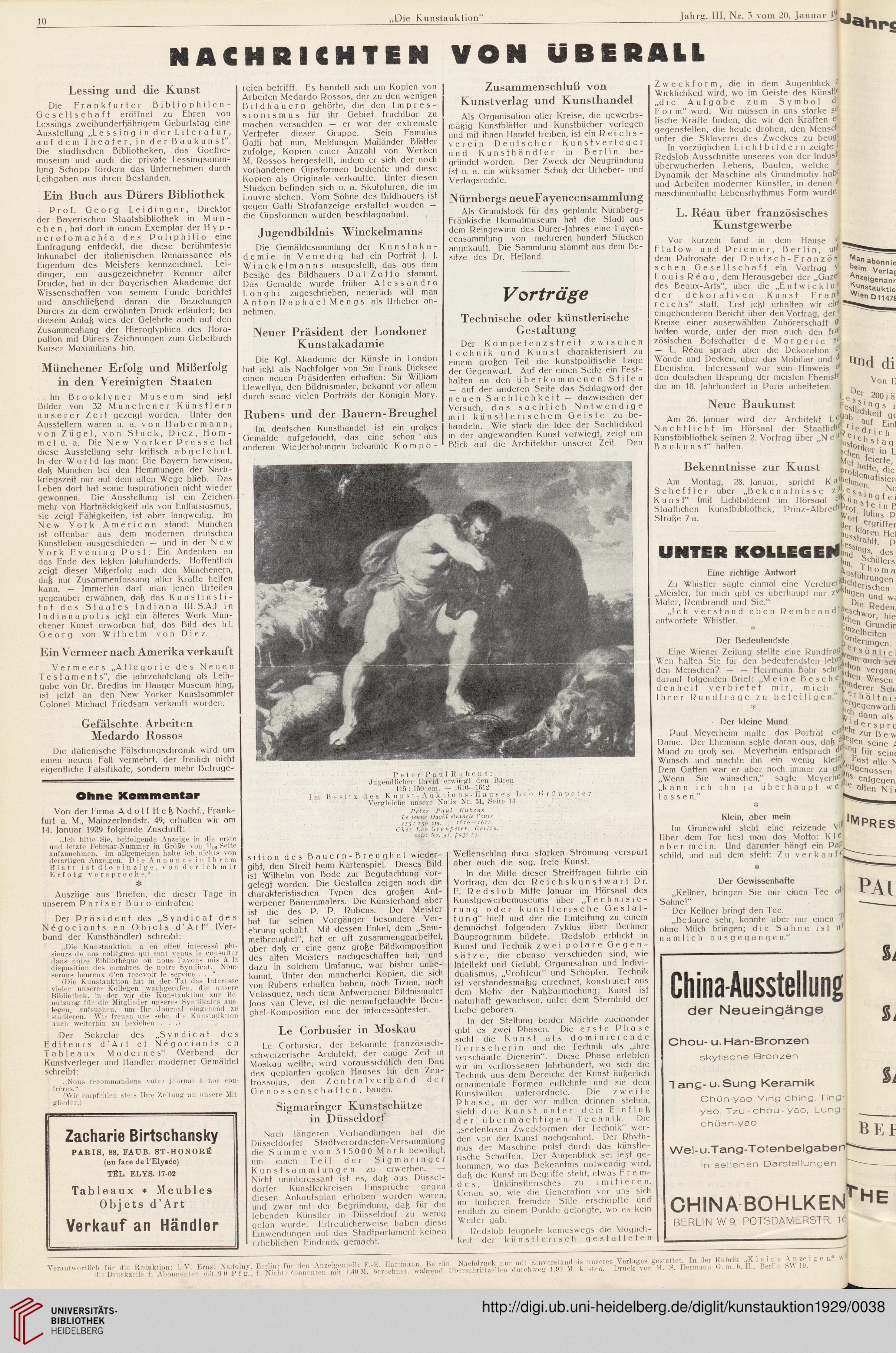w
„Die Kunstauktion"
NACHRICHTEN
ERALL
Lessing und die Kunst
Die Frankfurter Bibliophilcn-
Oesellschaft eröffnet zu Ehren von
Lessings zweihundertjährigem Geburtstag eine
Ausstellung „Lessing in der Literatur,
auf dem Theater, in der Baukuns t“.
Die städtischen Bibliotheken, das Goeihe-
museum und auch die private Lessingsamm-
lung Schopp fördern das Unternehmen durch
Leihgaben aus ihren Beständen.
Ein Buch aus Dürers Bibliothek
Prof. Georg Leidinger, Direktor
der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün-
chen, hat dort in einem Exemplar der Hyp-
nerotomachia des Poliphilio eine
Eintragung entdeckt, die diese berühmteste
Inkunabel der italienischen Renaissance als
Eigentum des Meisters kennzeichnet. Lei-
dinger, ein ausgezeichneter Kenner alter
Drucke, hat in der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften von seinem Funde berichtet
und anschließend daran die Beziehungen
Dürers zu dem erwähnten Druck erläutert; bei
diesem Anlaß wies der Gelehrte auch auf den
Zusammenhang der Hieroglyphica des Hora-
pallon mit Dürers Zeichnungen zum Gebetbuch
Kaiser Maximilians hin.
Münchener Erfolg und Mißerfolg
in den Vereinigten Staaten
Im Brooklyner Museum sind jeßt
Bilder von 32 Münchener Künstlern
unserer Zeit gezeigt worden. Unter den
Ausstellern waren u. a. von Habermann,
von Zügel, von Stuck, Diez, Hom-
me 1 u. a. Die New Yorker Presse hat
diese Ausstellung sehr kritisch a b g e 1 e h n t.
In der World las man: Die Bayern beweisen,
daß München bei den Hemmungen der Nach-
kriegszeit nur auf dem alten Wege blieb. Das
I eben dort hat seine Inspirationen nicht wieder
gewonnen. Die Ausstellung ist ein Zeichen
mehr von Hartnäckigkeit als von Enthusiasmus;
sie zeigt Fähigkeiten, ist aber langweilig. Im
New York American stand: München
ist offenbar aus dem modernen deutschen
Kunstleben ausgeschieden — und in der New
York Evening Post: Ein Andenken an
das Ende des leßten Jahrhunderts. Hoffentlich
zeigt dieser Mißerfolg auch den Münchenern,
daß nur Zusammenfassung aller Kräfte helfen
kann. — Immerhin darf man jenen Urteilen
gegenüber erwähnen, daß das Kunstinsii-
tut des Staates Indiana (U. S.A.) i n
Indianapolis jeßt ein älteres Werk Mün-
chener Kunst erworben hat, das Bild des h I.
Georg von Wilhelm von Diez.
Ein Vermeer nach Amerika verkauft
Vermeers „Allegorie des Neuen
Testaments", die jahrzehntelang als Leih-
gabe von Dr. Bredius im Haager Museum hing,
ist jetzt an den New Yorker Kunstsammler
Colonel Michael Friedsam verkauft worden.
Gefälschte Arbeiten
Medardo Rossos
Die italienische Fälschungschronik wird um
einen neuen Fall vermehrt, der freilich nicht
eigentliche Falsifikate, sondern mehr Betrüge-
Ohne Kommentar
Von der Firma A d o 1 f H e ß Nachf., Frank-
furt a. M., Mainzerlandstr. 49, erhalten wir am
14. Januar 1929 folgende Zuschrift:
..Ich bitte Sie, beifolgende Anzeige in die erste
und letzte Februar-Nummer in Größe von ,l1g Seite
aufzunehmen. Im allgemeinen halte ich nichts von
derartigen Anzeigen. Die Annonce in Ihrem
Blatt ist. die einzige, von der ich mir
Erfolg verspreche.“
*
Auszüge aus Briefen, die dieser Tage in
unserem Pariser Büro eintrafen:
Der Präsident des „Syndicat des
Negociants en Objets d’Art“ (Ver-
band der Kunsthändler) schreibt:
„Die Kunstauktion a en effetl Interesse plu-
sieurs de nos eollegues qui sont venus le eonsulter
dans notre Bibliotheque oii nous l’avons mis ä la
dispositlon des membre® de notre Syndicat. Nous
serons heureux d’en recevoir le Service . . .“
(Die Kunstauktion hat in der Tat das Interesse
vieler unserer Kollegen wachgerufen, die unsere
Bibliothek, in der wir die Kunstauktion zur Be
nutzung für die Mitglieder unseres Syndikates aus-
legen. aufsuchen, um Ihr Journal eingehend zv
studieren. Wir freuen uns sehr, die Kunstaüktion
auch weiterhin zu beziehen . . .)
Der Sekretär des „Syndicat des
Editeurs d’Art et Negociants en
Tableaux Modernes“ (Verband der
Kunstverleger und Händler moderner Gemälde)
schreibt:
„Nous recommandons votr? jcurnal ä nos con-
freres.“
(Wir empfehlen stets Ihre Zeitung an unsere Mit-
glieder.)
Zacharie Birtschansky
PARIS, 88, FAÜB. ST-HONORß
(en face de l’Elysee)
TfiL. ELYS. 17-02
Tableaux * Meubles
Obj ets d’Art
Verkauf an Händler
reien betrifft. Es handelt sich um Kopien von
Arbeiten Medardo Rossos, der zu den wenigen
Bildhauern gehörte, die den Impres-
sionismus für ihr Gebiet fruchtbar zu
machen versuchten — er war der extremste
Vertreter dieser Gruppe. Sein Famulus
Gatti hat nun, Meldungen Mailänder Blätter
zufolge, Kopien einer Anzahl von Werken
M. Rossos hergestellt, indem er sich der noch
vorhandenen Gipsformen bediente und diese
Kopien als Originale verkaufte. Unter diesen
Stücken befinden sich u. a. Skulpturen, die irn
Louvre stehen. Vom Sohne des Bildhauers ist
gegen Gatti Strafanzeige erstattet worden —
die Gipsformen wurden beschlagnahmt.
Jugendbildnis Winckelmanns
Die Gemäldesammlung der Kunstaka-
demie in Venedig hat ein Porträt J. J.
Winckelmanns ausgestellt, das aus dem
Besiße des Bildhauers Dal Z o 11 o stammt.
Das Gemälde wurde früher Alessandro
Longhi zugeschrieben, neuerlich will man
Anton Raphael Mengs als Urheber an-
nehmen.
Neuer Präsident der Londoner
Kunstakadamie
Die Kgl. Akademie der Künste in London
hat jeßt als Nachfolger von Sir Frank Dicksee
einen neuen Präsidenten erhalten: Sir William
Llewellyn, den Bildnismaler, bekannt vor allem
durch seine vielen Porträts der Königin Mary.
Rubens und der Bauern-Breughel
Im deutschen Kunsthandel ist ein großes
Gemälde aufgetaucht, das eine schon aus
anderen Wiederholungen bekannte Kompö-
Zusammenschluß von
Kunstverlag und Kunsthandel
Als Organisation aller Kreise, die gewerbs-
mäßig Kunstblätter und Kunstbücher verlegen
und mit ihnen Handel treiben, ist ein Reichs-
verein Deutscher Kunstverleger
und Kunsthändler in Berlin be-
gründet worden. Der Zweck der Neugründung
ist ü. a. ein wirksamer Schuß der Urheber- und
Verlagsrechte.
Nürnbergs neueF ayencensammlung
Als Grundstock für das geplante Nürnberg-
Fränkische Heimatmuseum hat die Stadt aus
dem Reingewinn des Dürer-Jahres eine Fayen-
censammlung von mehreren hundert Stücken
angekauft. Die Sammlung stammt aus dem Be-
sitze des Dr. Heiland.
Vorträge
Technische oder künstlerische
Gestaltung
Der Kompetenzstreit zwischen
Technik und Kunst charakterisiert zu
einem großen Teil die kunstpolitische Lage
der Gegenwart. Auf der einen Seite ein Fest-
halten an den überkommenen Stilen
— auf der anderen Seite das Schlagwort der
neuen Sachlichkeit — dazwischen der
Versuch, das sachlich Notwendige
mit künstlerischem Geiste zu be-
handeln. Wie stark die Idee der Sachlichkeit
in der angewandten Kunst vorwiegt, zeigt ein
Blick auf die Architektur unserer Zeit. Den
Peter P a u 1 Rubens:
•Jugendlicher David erwürgt den Bären
115 : 150 cm. — 1610—1612
Im Besitz des K u n s t - A u k t i o n s - H a u s e s Leo Grün p.eter
Vergleiche unsere Notiz Nr. 51, Seite 14
Peter Paul Rubens
Re jeune David- etrangle l'ours
115:150 cm. — 1610—1612.
Chez Leo Grünpeter, Berlin,
voir: Nr. 'ji, p'age 14.
sition des Bauern-Breughel wieder-
gibt, den Streit beim Kartenspiel. Dieses Bild
ist Wilhelm von Bode zur Begutachtung vor-
gelegt worden. Die Gestalten zeigen noch die
charakteristischen Typen des großen Ant-
werpener Bauernmalers. Die Künsterhand aber
ist die des P. P. Rubens. Der Meister
hat für seinen Vorgänger besondere Ver-
ehrung gehabt. Mit dessen Enkel, dem „Sam-
metbreughel“, hat er oft zusammengearbeitet,
aber daß er eine ganz große Bildkomposition
des alten Meisters nachgeschaffen hat, und
dazu in solchem Umfange, war bisher unbe-
kannt. Unter den mancherlei Kopien, die sich
von Rubens erhalten haben, nach Tizian, nach
Velasquez, nach dem Antwerpener Bildnismaler
Joos van Cleve, ist die neuaufgetauchte Breu-
ghel-Komposition eine der interessantesten.
Le Corbusier in Moskau
Le Corbusier, der bekannte französisch-
schweizerische Architekt, der einige Zeit in
Moskau weilte, wird voraussichtlich den Bau
des geplanten großen Hauses für den Zen-
trossojus, den Zentralverband der
Genossenschaften, bauen.
Sigmaringer Kunstschätze
in Düsseldorf
Nach längeren Verhandlungen hat die
Düsseldorfer Stadtverordneten-Versammlung
die Summe von 315000 Mark bewilligt,
um einen Teil der Sigma ringer
Kunstsammlungen zu erwerben. —
Nicht uninferessanf ist es, daß aus Düssel-
dorfer Künstlerkreisen Einsprüche gegen
diesen Ankaufsplan erhoben worden waren,
und zwar mit der Begründung, daß für die
lebenden Künstler in Düsseldorf zu wenig
geian wurde. Erfreulicherweise haben diese
Einwendungen auf das Stadtparlament keinen
erheblichen Eindruck gemacht.
Wellenschlag ihrer starken Strömung verspürt
aber auch die sog. freie Kunst.
In die Mitte dieser Streitfragen führte em
Vortrag, den der Reichskunstwart Dr.
E. R e d s 1 o b Mitte Januar im Hörsaal des
Kunstgewerbemuseums über „Technisie-
rung oder künstlerische Gestal-
tung“ hielt und der die Einleitung zu einem
demnächst folgenden Zyklus über Berliner
Bauprogramm bildete. Redslob erblickt in
Kunst und Technik zwei polare Gegen-
sätze, die ebenso verschieden sind, wie
Intellekt und Gefühl, Organisation und Indivi-
dualismus, „Profiteur“ und Schöpfer. Technik
ist verstandesmäßig errechnet, konstruiert aus
dem Motiv der Nußbarmachung; Kunst ist
natuihaft gewachsen, unter dem Sternbild der
Liebe geboren.
In der Stellung beider Mächte zueinander
gibt es zwei Phasen. Die erste Phase
sieht die Kunst als dominierende
Herrscherin und die Technik als „ihre
verschämte Dienerin". Diese Phase erlebten
wir im verflossenen Jahrhundert, wo sich die
Technik aus dem Bereiche der Kunst äußerlich
ornamentale Formen entlehnte und sie dem
Kunsiwillen unterordnete. Die zweite
Phase, in der wir mitten drinnen stehen,
sieht die Kunst unter dem Einfluß
der übermächtigen Technik. Die
„seelenlosen Zweckformen der Technik" wer-
den von der Kunst nachgeahmt. Der Rhyth-
mus der Maschine pulst durch das künstle-
rische Schaffen. Der Augenblick sei jeßt ge-
kommen, wo das Bekenntnis notwendig wird,
daß die Kunst im Begriffe steht, etwas Frem-
des, Unkünstlensches zu imitieren.
Genau so, wie die Generation vor uns sich
im Imitieren fremder Stile erschöpfte und
endlich zu einem Punkte gelangte, wo es kein
Weiter gab.
Redslob leugnete keineswegs die Möglich-
keit der künstlerisch gestalteten
Zweckform, die in dem Augenblick
Wirklichkeit wird, wo im Geiste des KünstK
„die Aufgabe zum Symbol d1
Form" wird. Wir müssen in uns starke
lische Kräfte finden, die wir den Kräften
gegenstellen, die heute drohen, den Mensch1
unter die Sklaverei des Zweckes zu beu9^
In vorzüglichen Lichtbildern zeigte J
Redslob Ausschnitte unseres von der IndusF
überwucherten Lebens, Bauten, welche
Dynamik der Maschine als Grundmotiv habj
und Arbeiten moderner Künstler, in denen
maschinenhafte Lebensrhyfhmus Form wurde.
PAL
Tee i’h1
Si
^an abonnie
Ae,,n Verlac
nzeigenanr
^"«auktio
2lenDii47£
einen 1
ist u1
Chou- u. Han-Bronzen
skytische Bronzen
CHINA BOHLKEN!,'He
BERLIN W9, POTSDAMERSTR. l6
lang-u.Sung Keramik
Chün-yao, Ving- ching. Ting'
yao, Tzu - chou - yao, Lung-
chüan-yao
Klein, aber mein
Im Grünewald steht eine reizende Vil
über dem Tor liest man das Motto: K1e
aber mein. Und darunter hängt ein PaP'i
Schild, und auf dem steht: Zu verkauft,
*
Der Gewissenhafte
„Kellner, bringen Sie mir einen
Sahne!“
Der Kellner bringt den Tee.
„Bedaure sehr, konnte aber nur
ohne Milch bringen; die Sahne
nämlich ausgegange n."
L. Reau über französisches
Kunstgewerbe
Vor kurzem fand in dem Hause v‘
Flatow und Priemer, Berlin, ubi
dem Patronate der Deutsch-Französ1
sehen Gesellschaft ein Vortrag v<
Louis Reau, dem Herausgeber der „Gaz^
des Beaux-Arts“, über die „Entwicklui1
der dekorativen Kunst F r a n I*
reichs“ statt. Erst jeßt erhalten wir ein!
eingehenderen Bericht über den Vortrag, der 1
Kreise einer auserwählten Zuhörerschaft 0‘
halten wurde, unter der man auch den fral
zösischen Botschafter d e M a r g e r i e s8
— L. Reau sprach über die Dekoration
Wände und Decken, über das Mobiliar und
Ebenisten. Interessant war sein Hinweis ö'
den deutschen Ursprung der meisten EbenisK1
die im 18. Jahrhundert in Paris arbeiteten.
I
China-Ausstellung
der Neueingänge
“nd di
Von E
AT -r, , !-e^r 200 jä
LNeue Baukunst Festig n 9 s ‘
Am 26. Januar wird der Architekt Le?öb amP1 9«
Nachtlicht im Hörsaal der Staatlich1 .r i e <j r ; ,
Kunstbibliothek seinen 2. Vortrag über „N eP,.e i c h « |C 1
Baukunst" halten. ‘"s*OrikL • 9
j^en fej
Bekenntnisse zur Kunst '>ro‘b)'’at,e-. die
Am Montag, 28. Januar, spricht K a^Nhi^g^bsieri
Scheffler über „Bekenntnisse z e s s i
Kunst“ (mit Lichtbildern) im Hörsaal ü n «= 9-f e ’
Staatlichen Kunstbibliothek, Prinz-AlbrecfProf .‘^lnE
Straße 7 a. A()r) ^u'IUs P
_ der Ler9riffer
SS? Hg
UNTER KOLLEGEN jo«
liin ^dullers
Eine richtige Antwort ^*4sfjjf 1 0 rn 0
Zu Whistler sagte einmal eine Verehrer'J*c|)}erN?9cn
„Meister, für mich gibt es überhaupt nur Z^Ugen i,nJn
Maler, Rembrandt und Sie.“ Dje p 9 w<
„Ich verstand eben Rembrand^esef. e9en>
antwortete Whistler. ’’ "ie
*
Der Bedeutendste Federungen
Eine Wiener Zeitung stellte eine RundfraöCe r s ö n 1 i c I
Wen halten Sie für den bedeutendsten leb^A^n auch sei
den Menschen? — — Herrmann Bahr scMjS(?on vergant
darauf folgenden Brief: „Meine Beseht 5 en Wesen
denheit verbietet mir, mich ^Ot,derer Sch
Ihrer Rundfrage zu beteilige n.“ v e r h ä 11 n i <
* $d9e9enwärti
Der kleine Mund ' d eTs p^
Paul Meyerheim malte das Porträt ci^’r 2ur ß e w
Dame. Der Ehemann seßte daran aus, daß L' 9en seine l
Mund zu groß sei. Meyerheim entsprach Ur>g für sejn(
Wunsch und machte ihn ein wenig kleioL Fast alle b
Dem Gatten war er aber noch immer zu 9ra,lt9enossen
„Wenn Sie wünschen,“ sagte Meyerhel!!’s entgegen
„kann ich ihn ja überhaupt we-t alten Nii
lasse n.“
Verantwortlich für die Redaktion: i. V. Emst Nadolny, Berlin: für den Anzeigenteil: F.-E. Hartmann. Be rlin. Nachdruck nur mit Einverständnis unseres Verlages gestattet. In der Rubrik K 1 e i n e An ze 1 g e 1.“
die Druckzeile f. Abonnenten mit 9 0 Pfg., f. Nichte «onnenten mit 1,40 M. berechnet, während Überschriftzeilen durchweg 1,90 M. kosten. Druck von H. b. Hermann Ix. m. b. H., Berl.n bw 1».
„Die Kunstauktion"
NACHRICHTEN
ERALL
Lessing und die Kunst
Die Frankfurter Bibliophilcn-
Oesellschaft eröffnet zu Ehren von
Lessings zweihundertjährigem Geburtstag eine
Ausstellung „Lessing in der Literatur,
auf dem Theater, in der Baukuns t“.
Die städtischen Bibliotheken, das Goeihe-
museum und auch die private Lessingsamm-
lung Schopp fördern das Unternehmen durch
Leihgaben aus ihren Beständen.
Ein Buch aus Dürers Bibliothek
Prof. Georg Leidinger, Direktor
der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün-
chen, hat dort in einem Exemplar der Hyp-
nerotomachia des Poliphilio eine
Eintragung entdeckt, die diese berühmteste
Inkunabel der italienischen Renaissance als
Eigentum des Meisters kennzeichnet. Lei-
dinger, ein ausgezeichneter Kenner alter
Drucke, hat in der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften von seinem Funde berichtet
und anschließend daran die Beziehungen
Dürers zu dem erwähnten Druck erläutert; bei
diesem Anlaß wies der Gelehrte auch auf den
Zusammenhang der Hieroglyphica des Hora-
pallon mit Dürers Zeichnungen zum Gebetbuch
Kaiser Maximilians hin.
Münchener Erfolg und Mißerfolg
in den Vereinigten Staaten
Im Brooklyner Museum sind jeßt
Bilder von 32 Münchener Künstlern
unserer Zeit gezeigt worden. Unter den
Ausstellern waren u. a. von Habermann,
von Zügel, von Stuck, Diez, Hom-
me 1 u. a. Die New Yorker Presse hat
diese Ausstellung sehr kritisch a b g e 1 e h n t.
In der World las man: Die Bayern beweisen,
daß München bei den Hemmungen der Nach-
kriegszeit nur auf dem alten Wege blieb. Das
I eben dort hat seine Inspirationen nicht wieder
gewonnen. Die Ausstellung ist ein Zeichen
mehr von Hartnäckigkeit als von Enthusiasmus;
sie zeigt Fähigkeiten, ist aber langweilig. Im
New York American stand: München
ist offenbar aus dem modernen deutschen
Kunstleben ausgeschieden — und in der New
York Evening Post: Ein Andenken an
das Ende des leßten Jahrhunderts. Hoffentlich
zeigt dieser Mißerfolg auch den Münchenern,
daß nur Zusammenfassung aller Kräfte helfen
kann. — Immerhin darf man jenen Urteilen
gegenüber erwähnen, daß das Kunstinsii-
tut des Staates Indiana (U. S.A.) i n
Indianapolis jeßt ein älteres Werk Mün-
chener Kunst erworben hat, das Bild des h I.
Georg von Wilhelm von Diez.
Ein Vermeer nach Amerika verkauft
Vermeers „Allegorie des Neuen
Testaments", die jahrzehntelang als Leih-
gabe von Dr. Bredius im Haager Museum hing,
ist jetzt an den New Yorker Kunstsammler
Colonel Michael Friedsam verkauft worden.
Gefälschte Arbeiten
Medardo Rossos
Die italienische Fälschungschronik wird um
einen neuen Fall vermehrt, der freilich nicht
eigentliche Falsifikate, sondern mehr Betrüge-
Ohne Kommentar
Von der Firma A d o 1 f H e ß Nachf., Frank-
furt a. M., Mainzerlandstr. 49, erhalten wir am
14. Januar 1929 folgende Zuschrift:
..Ich bitte Sie, beifolgende Anzeige in die erste
und letzte Februar-Nummer in Größe von ,l1g Seite
aufzunehmen. Im allgemeinen halte ich nichts von
derartigen Anzeigen. Die Annonce in Ihrem
Blatt ist. die einzige, von der ich mir
Erfolg verspreche.“
*
Auszüge aus Briefen, die dieser Tage in
unserem Pariser Büro eintrafen:
Der Präsident des „Syndicat des
Negociants en Objets d’Art“ (Ver-
band der Kunsthändler) schreibt:
„Die Kunstauktion a en effetl Interesse plu-
sieurs de nos eollegues qui sont venus le eonsulter
dans notre Bibliotheque oii nous l’avons mis ä la
dispositlon des membre® de notre Syndicat. Nous
serons heureux d’en recevoir le Service . . .“
(Die Kunstauktion hat in der Tat das Interesse
vieler unserer Kollegen wachgerufen, die unsere
Bibliothek, in der wir die Kunstauktion zur Be
nutzung für die Mitglieder unseres Syndikates aus-
legen. aufsuchen, um Ihr Journal eingehend zv
studieren. Wir freuen uns sehr, die Kunstaüktion
auch weiterhin zu beziehen . . .)
Der Sekretär des „Syndicat des
Editeurs d’Art et Negociants en
Tableaux Modernes“ (Verband der
Kunstverleger und Händler moderner Gemälde)
schreibt:
„Nous recommandons votr? jcurnal ä nos con-
freres.“
(Wir empfehlen stets Ihre Zeitung an unsere Mit-
glieder.)
Zacharie Birtschansky
PARIS, 88, FAÜB. ST-HONORß
(en face de l’Elysee)
TfiL. ELYS. 17-02
Tableaux * Meubles
Obj ets d’Art
Verkauf an Händler
reien betrifft. Es handelt sich um Kopien von
Arbeiten Medardo Rossos, der zu den wenigen
Bildhauern gehörte, die den Impres-
sionismus für ihr Gebiet fruchtbar zu
machen versuchten — er war der extremste
Vertreter dieser Gruppe. Sein Famulus
Gatti hat nun, Meldungen Mailänder Blätter
zufolge, Kopien einer Anzahl von Werken
M. Rossos hergestellt, indem er sich der noch
vorhandenen Gipsformen bediente und diese
Kopien als Originale verkaufte. Unter diesen
Stücken befinden sich u. a. Skulpturen, die irn
Louvre stehen. Vom Sohne des Bildhauers ist
gegen Gatti Strafanzeige erstattet worden —
die Gipsformen wurden beschlagnahmt.
Jugendbildnis Winckelmanns
Die Gemäldesammlung der Kunstaka-
demie in Venedig hat ein Porträt J. J.
Winckelmanns ausgestellt, das aus dem
Besiße des Bildhauers Dal Z o 11 o stammt.
Das Gemälde wurde früher Alessandro
Longhi zugeschrieben, neuerlich will man
Anton Raphael Mengs als Urheber an-
nehmen.
Neuer Präsident der Londoner
Kunstakadamie
Die Kgl. Akademie der Künste in London
hat jeßt als Nachfolger von Sir Frank Dicksee
einen neuen Präsidenten erhalten: Sir William
Llewellyn, den Bildnismaler, bekannt vor allem
durch seine vielen Porträts der Königin Mary.
Rubens und der Bauern-Breughel
Im deutschen Kunsthandel ist ein großes
Gemälde aufgetaucht, das eine schon aus
anderen Wiederholungen bekannte Kompö-
Zusammenschluß von
Kunstverlag und Kunsthandel
Als Organisation aller Kreise, die gewerbs-
mäßig Kunstblätter und Kunstbücher verlegen
und mit ihnen Handel treiben, ist ein Reichs-
verein Deutscher Kunstverleger
und Kunsthändler in Berlin be-
gründet worden. Der Zweck der Neugründung
ist ü. a. ein wirksamer Schuß der Urheber- und
Verlagsrechte.
Nürnbergs neueF ayencensammlung
Als Grundstock für das geplante Nürnberg-
Fränkische Heimatmuseum hat die Stadt aus
dem Reingewinn des Dürer-Jahres eine Fayen-
censammlung von mehreren hundert Stücken
angekauft. Die Sammlung stammt aus dem Be-
sitze des Dr. Heiland.
Vorträge
Technische oder künstlerische
Gestaltung
Der Kompetenzstreit zwischen
Technik und Kunst charakterisiert zu
einem großen Teil die kunstpolitische Lage
der Gegenwart. Auf der einen Seite ein Fest-
halten an den überkommenen Stilen
— auf der anderen Seite das Schlagwort der
neuen Sachlichkeit — dazwischen der
Versuch, das sachlich Notwendige
mit künstlerischem Geiste zu be-
handeln. Wie stark die Idee der Sachlichkeit
in der angewandten Kunst vorwiegt, zeigt ein
Blick auf die Architektur unserer Zeit. Den
Peter P a u 1 Rubens:
•Jugendlicher David erwürgt den Bären
115 : 150 cm. — 1610—1612
Im Besitz des K u n s t - A u k t i o n s - H a u s e s Leo Grün p.eter
Vergleiche unsere Notiz Nr. 51, Seite 14
Peter Paul Rubens
Re jeune David- etrangle l'ours
115:150 cm. — 1610—1612.
Chez Leo Grünpeter, Berlin,
voir: Nr. 'ji, p'age 14.
sition des Bauern-Breughel wieder-
gibt, den Streit beim Kartenspiel. Dieses Bild
ist Wilhelm von Bode zur Begutachtung vor-
gelegt worden. Die Gestalten zeigen noch die
charakteristischen Typen des großen Ant-
werpener Bauernmalers. Die Künsterhand aber
ist die des P. P. Rubens. Der Meister
hat für seinen Vorgänger besondere Ver-
ehrung gehabt. Mit dessen Enkel, dem „Sam-
metbreughel“, hat er oft zusammengearbeitet,
aber daß er eine ganz große Bildkomposition
des alten Meisters nachgeschaffen hat, und
dazu in solchem Umfange, war bisher unbe-
kannt. Unter den mancherlei Kopien, die sich
von Rubens erhalten haben, nach Tizian, nach
Velasquez, nach dem Antwerpener Bildnismaler
Joos van Cleve, ist die neuaufgetauchte Breu-
ghel-Komposition eine der interessantesten.
Le Corbusier in Moskau
Le Corbusier, der bekannte französisch-
schweizerische Architekt, der einige Zeit in
Moskau weilte, wird voraussichtlich den Bau
des geplanten großen Hauses für den Zen-
trossojus, den Zentralverband der
Genossenschaften, bauen.
Sigmaringer Kunstschätze
in Düsseldorf
Nach längeren Verhandlungen hat die
Düsseldorfer Stadtverordneten-Versammlung
die Summe von 315000 Mark bewilligt,
um einen Teil der Sigma ringer
Kunstsammlungen zu erwerben. —
Nicht uninferessanf ist es, daß aus Düssel-
dorfer Künstlerkreisen Einsprüche gegen
diesen Ankaufsplan erhoben worden waren,
und zwar mit der Begründung, daß für die
lebenden Künstler in Düsseldorf zu wenig
geian wurde. Erfreulicherweise haben diese
Einwendungen auf das Stadtparlament keinen
erheblichen Eindruck gemacht.
Wellenschlag ihrer starken Strömung verspürt
aber auch die sog. freie Kunst.
In die Mitte dieser Streitfragen führte em
Vortrag, den der Reichskunstwart Dr.
E. R e d s 1 o b Mitte Januar im Hörsaal des
Kunstgewerbemuseums über „Technisie-
rung oder künstlerische Gestal-
tung“ hielt und der die Einleitung zu einem
demnächst folgenden Zyklus über Berliner
Bauprogramm bildete. Redslob erblickt in
Kunst und Technik zwei polare Gegen-
sätze, die ebenso verschieden sind, wie
Intellekt und Gefühl, Organisation und Indivi-
dualismus, „Profiteur“ und Schöpfer. Technik
ist verstandesmäßig errechnet, konstruiert aus
dem Motiv der Nußbarmachung; Kunst ist
natuihaft gewachsen, unter dem Sternbild der
Liebe geboren.
In der Stellung beider Mächte zueinander
gibt es zwei Phasen. Die erste Phase
sieht die Kunst als dominierende
Herrscherin und die Technik als „ihre
verschämte Dienerin". Diese Phase erlebten
wir im verflossenen Jahrhundert, wo sich die
Technik aus dem Bereiche der Kunst äußerlich
ornamentale Formen entlehnte und sie dem
Kunsiwillen unterordnete. Die zweite
Phase, in der wir mitten drinnen stehen,
sieht die Kunst unter dem Einfluß
der übermächtigen Technik. Die
„seelenlosen Zweckformen der Technik" wer-
den von der Kunst nachgeahmt. Der Rhyth-
mus der Maschine pulst durch das künstle-
rische Schaffen. Der Augenblick sei jeßt ge-
kommen, wo das Bekenntnis notwendig wird,
daß die Kunst im Begriffe steht, etwas Frem-
des, Unkünstlensches zu imitieren.
Genau so, wie die Generation vor uns sich
im Imitieren fremder Stile erschöpfte und
endlich zu einem Punkte gelangte, wo es kein
Weiter gab.
Redslob leugnete keineswegs die Möglich-
keit der künstlerisch gestalteten
Zweckform, die in dem Augenblick
Wirklichkeit wird, wo im Geiste des KünstK
„die Aufgabe zum Symbol d1
Form" wird. Wir müssen in uns starke
lische Kräfte finden, die wir den Kräften
gegenstellen, die heute drohen, den Mensch1
unter die Sklaverei des Zweckes zu beu9^
In vorzüglichen Lichtbildern zeigte J
Redslob Ausschnitte unseres von der IndusF
überwucherten Lebens, Bauten, welche
Dynamik der Maschine als Grundmotiv habj
und Arbeiten moderner Künstler, in denen
maschinenhafte Lebensrhyfhmus Form wurde.
PAL
Tee i’h1
Si
^an abonnie
Ae,,n Verlac
nzeigenanr
^"«auktio
2lenDii47£
einen 1
ist u1
Chou- u. Han-Bronzen
skytische Bronzen
CHINA BOHLKEN!,'He
BERLIN W9, POTSDAMERSTR. l6
lang-u.Sung Keramik
Chün-yao, Ving- ching. Ting'
yao, Tzu - chou - yao, Lung-
chüan-yao
Klein, aber mein
Im Grünewald steht eine reizende Vil
über dem Tor liest man das Motto: K1e
aber mein. Und darunter hängt ein PaP'i
Schild, und auf dem steht: Zu verkauft,
*
Der Gewissenhafte
„Kellner, bringen Sie mir einen
Sahne!“
Der Kellner bringt den Tee.
„Bedaure sehr, konnte aber nur
ohne Milch bringen; die Sahne
nämlich ausgegange n."
L. Reau über französisches
Kunstgewerbe
Vor kurzem fand in dem Hause v‘
Flatow und Priemer, Berlin, ubi
dem Patronate der Deutsch-Französ1
sehen Gesellschaft ein Vortrag v<
Louis Reau, dem Herausgeber der „Gaz^
des Beaux-Arts“, über die „Entwicklui1
der dekorativen Kunst F r a n I*
reichs“ statt. Erst jeßt erhalten wir ein!
eingehenderen Bericht über den Vortrag, der 1
Kreise einer auserwählten Zuhörerschaft 0‘
halten wurde, unter der man auch den fral
zösischen Botschafter d e M a r g e r i e s8
— L. Reau sprach über die Dekoration
Wände und Decken, über das Mobiliar und
Ebenisten. Interessant war sein Hinweis ö'
den deutschen Ursprung der meisten EbenisK1
die im 18. Jahrhundert in Paris arbeiteten.
I
China-Ausstellung
der Neueingänge
“nd di
Von E
AT -r, , !-e^r 200 jä
LNeue Baukunst Festig n 9 s ‘
Am 26. Januar wird der Architekt Le?öb amP1 9«
Nachtlicht im Hörsaal der Staatlich1 .r i e <j r ; ,
Kunstbibliothek seinen 2. Vortrag über „N eP,.e i c h « |C 1
Baukunst" halten. ‘"s*OrikL • 9
j^en fej
Bekenntnisse zur Kunst '>ro‘b)'’at,e-. die
Am Montag, 28. Januar, spricht K a^Nhi^g^bsieri
Scheffler über „Bekenntnisse z e s s i
Kunst“ (mit Lichtbildern) im Hörsaal ü n «= 9-f e ’
Staatlichen Kunstbibliothek, Prinz-AlbrecfProf .‘^lnE
Straße 7 a. A()r) ^u'IUs P
_ der Ler9riffer
SS? Hg
UNTER KOLLEGEN jo«
liin ^dullers
Eine richtige Antwort ^*4sfjjf 1 0 rn 0
Zu Whistler sagte einmal eine Verehrer'J*c|)}erN?9cn
„Meister, für mich gibt es überhaupt nur Z^Ugen i,nJn
Maler, Rembrandt und Sie.“ Dje p 9 w<
„Ich verstand eben Rembrand^esef. e9en>
antwortete Whistler. ’’ "ie
*
Der Bedeutendste Federungen
Eine Wiener Zeitung stellte eine RundfraöCe r s ö n 1 i c I
Wen halten Sie für den bedeutendsten leb^A^n auch sei
den Menschen? — — Herrmann Bahr scMjS(?on vergant
darauf folgenden Brief: „Meine Beseht 5 en Wesen
denheit verbietet mir, mich ^Ot,derer Sch
Ihrer Rundfrage zu beteilige n.“ v e r h ä 11 n i <
* $d9e9enwärti
Der kleine Mund ' d eTs p^
Paul Meyerheim malte das Porträt ci^’r 2ur ß e w
Dame. Der Ehemann seßte daran aus, daß L' 9en seine l
Mund zu groß sei. Meyerheim entsprach Ur>g für sejn(
Wunsch und machte ihn ein wenig kleioL Fast alle b
Dem Gatten war er aber noch immer zu 9ra,lt9enossen
„Wenn Sie wünschen,“ sagte Meyerhel!!’s entgegen
„kann ich ihn ja überhaupt we-t alten Nii
lasse n.“
Verantwortlich für die Redaktion: i. V. Emst Nadolny, Berlin: für den Anzeigenteil: F.-E. Hartmann. Be rlin. Nachdruck nur mit Einverständnis unseres Verlages gestattet. In der Rubrik K 1 e i n e An ze 1 g e 1.“
die Druckzeile f. Abonnenten mit 9 0 Pfg., f. Nichte «onnenten mit 1,40 M. berechnet, während Überschriftzeilen durchweg 1,90 M. kosten. Druck von H. b. Hermann Ix. m. b. H., Berl.n bw 1».