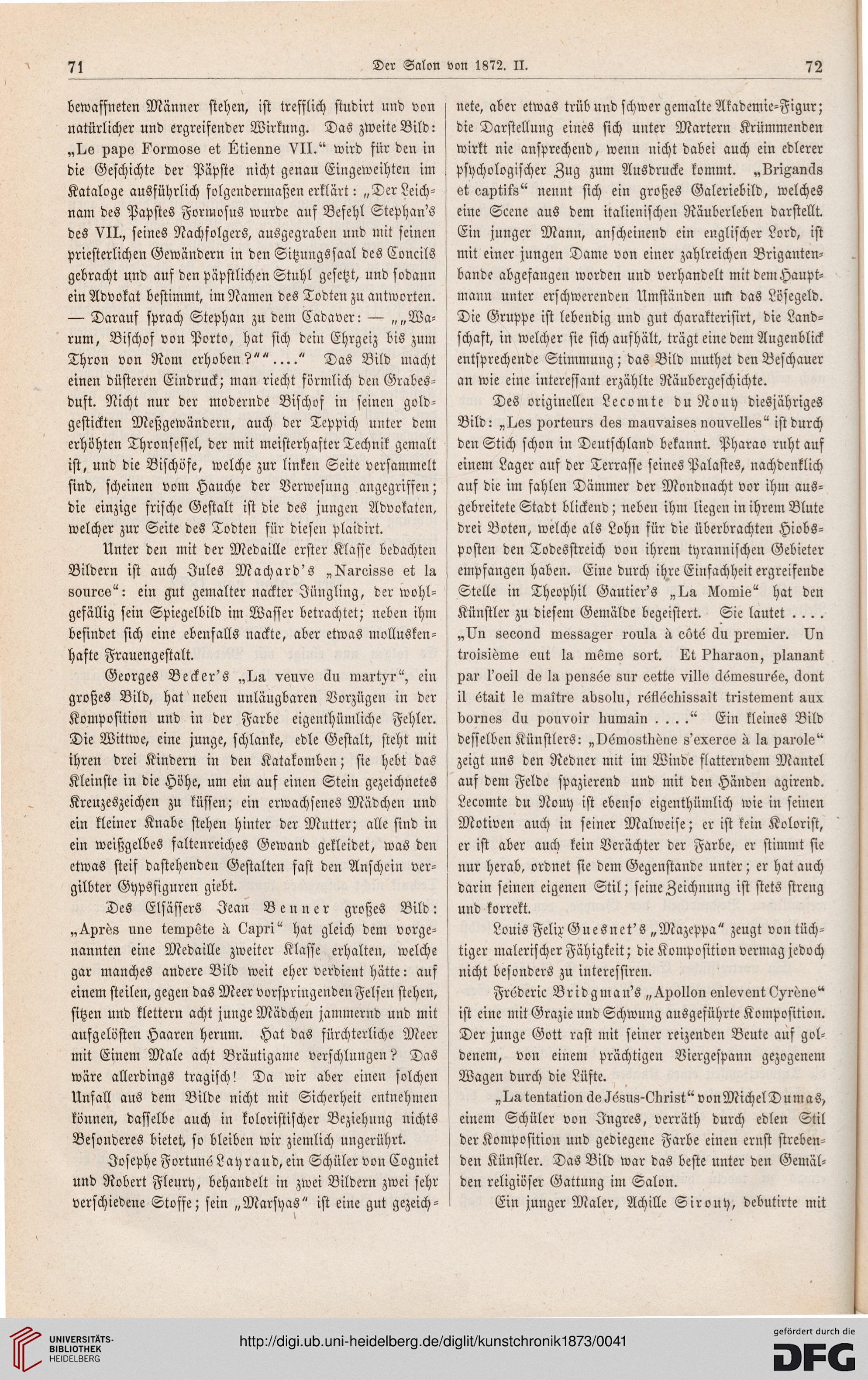71
Der Salon von 1872. II.
72
bewaffneten Männer stehen, ist trefflich studirt und von
natürlicher und ergreifender Wirkung. Das zweite Bild:
„liis paps I?ormo8s st hltisnns VII." wird für den in
die Geschichte der Päpste nicht genau Eingeweihten im
Kataloge ausführlich folgendermaßen erklärt: „Der Leich-
nam des Papstes Formosus wurde auf Befehl Stephan's
des VII., seines Nachfolgers, ausgegraben und mit seinen
priesterlichen Gewändern in den Sitzungssaal des Concils
gebracht und auf den päpstlichen Stuhl gesetzt, und sodann
ein Advokat bestimmt, im Namen des Todten zu antworten.
— Darauf sprach Stephan zu dem Cadaver: — ,,„Wa-
rum, Bischof von Porto, hat sich dein Ehrgeiz bis zum
Thron von Rom erhoben?""—" Das Bild macht
einen düsteren Eindruck; man riecht förmlich den Grabes-
duft. Nicht nur der modernde Bischof in seinen gold-
gestickten Meßgewändern, auch der Teppich unter dem
erhöhten Thronsessel, der mit meisterhafterTechnik gemalt
ist, und die Bischöfe, welche zur linken Seite versammelt
sind, scheinen vom Hauche der Verwesung angegriffen;
die einzige frische Gestalt ist die des jungen Advokaten,
welcher zur Seite des Todten für diesen plaidirt.
Unter den mit der Medaille erster Klasse bedachten
Bildern ist auch Jules Machard's „Xursisss st la
souros": ein gut gemalter nackter Jüngling, der wohl-
gefällig sein Spiegelbild im Wasser betrachtet; neben ihm
befindet sich eine ebenfalls nackte, aber etwas mollusken-
hafte Frauengestalt.
Georges Becker's „Uu vsuvs llu msrt^r", eiu
großes Bild, hat neben unläugbaren Vorzügen in der
Komposition und in der Farbe eigenthümliche Fehler.
Die Wittwe, eine junge, schlanke, edle Gestalt, steht mit
ihren drei Kindern in den Katakomben; sie hebt das
Kleinste in die Höhe, um ein auf einen Stein gezeichnetes
Kreuzeszeichen zu küssen; ein erwachsenes MLdchen und
ein kleiner Knabe stehen hinter der Mutter; alle sind in
ein weißgelbes faltenreiches Gewand gekleidet, was den
etwas steif dastehenden Gestalten fast den Anschein ver-
gilbter Gypsfiguren giebt.
Des Elsässers Jean Benner großes Bild:
„Vprss uus temxsts ü Oapri" hat gleich dem vorge-
nannten eine Medaille zweiter Klasse erhalten, welche
gar manches andere Bild weit eher verdient hätte: auf
einem steilen, gegen das Meer vorspringenden Felsen stehen,
sitzen uud klettern acht junge Mädchen jammernd und mit
aufgelösten Haaren herum. Hat das fürchterliche Meer
mit Einem Male acht Bräutigame verschlungen? Das
wäre allerdings tragisch! Da wir aber einen solchen
Unfall aus dem Bilde nicht mit Sicherheit entnehmen
können, dasselbe auch in koloristischer Beziehung nichts
Besonderes bietet, so bleiben wir ziemlich ungerührt.
Josephe Fortuns Layraud, ein Schüler von Cogniet
und Robert Fleury, behandelt in zwei Bildern zwei sehr
verschiedene Stoffe; sein „Marsyas" ist eine gut gezeich-
nete, aber etwas trüb und schwer gemalte Akademie-Figur;
die Darstellung eines sich unter Martern Krümmenden
wirkt nie ansprechend, wenn nicht dabei auch ein edlerer
psychologischer Zug zum Ausdrucke kommt. „Lri^Lnlls
st saptiks" nennt sich ein großes Galeriebild, welches
eine Scene aus dem italienischen Räuberleben darstellt.
Ein junger Mann, anscheinend ein englischer Lord, ist
mit einer jungen Dame von einer zahlreichen Briganten-
bande abgefangen worden und verhandelt mit demHaupt-
mann unter erschwerenden Umständen utti das Lösegeld.
Die Gruppe ist lebendig und gut charakterisirt, die Land-
schaft, in welcher sie sich aufhält, trägt eine dem Augenblick
entsprechende Stimmung; das Bild muthet den Beschauer
an wie eine interessant erzählte Räubergeschichte.
Des originellen Lecomte du Nouy diesjähriges
Bild: „Iws portsnrs äss munvumss nouvsllss" ist durch
den Stich schon in Deutschland bekannt. Pharao ruht auf
einem Lager auf der Terrasse seines Palastes, nachdenklich
auf die im fahlen Dämmer der Mondnacht vor ihm aus-
gebreitete Stadt blickend; neben ihm liegen in ihrem Blute
drei Boten, welche als Lohn für die überbrachten Hiobs-
posten den Todesstreich von ihrein tyrannischen Gebieter
empfangen haben. Eine durch ihre Einfachheit ergreifende
Stelle in Theophil Gautier's „Im Nomis" hat den
Künstler zu diesem Gemälde begeistert. Sie lautet ....
„IIn ssoollll MsssaAsr roulu L oots äu prsmisr. IIn
troisisms sut Is. msms sort. Ht klisrson, plsnsnt
psr I'osil äs Is psnsss sur ostts vills llsmssurlls, llont
II 6ta.it Is maitrs absolu, rsllso1n88a.it tristsmsnt aux
bornos llu pouvoir bumain . . . ." Ein kleines Bild
desselben Künstlers: „Oömostlisns 8'sxsros ä la parols"
zeigt uns den Redner mit im Winde slatterndem Mantel
auf dem Felde spazierend uud mit den Händen agirend.
Lecomte du Nouy ist ebenso eigenthümlich wie in seinen
Motiven auch in seiner Malweise; er ist kein Kolorist,
er ist aber auch kein Verächter der Farbe, er stimmt sie
nur herab, ordnet sie dem Gegenstande unter; er hat auch
darin seinen eigenen Stil; seineZeichnung ist stets streng
und korrekt.
Louis FelixGuesnet's „Mazeppa" zeugt vontüch-
tiger malerischer Fähigkeit; die Komposition vermagjedoch
uicht besonders zu interessiren.
Frsderic Bridgman's „L.xollon6nlövsnt0^rsns"
ist eine mit Grazie und Schwung ausgeführte Komposition.
Der junge Gott rast mit seiner reizenden Beute auf gvl-
denem, von einem prächtigen Viergespann gezogenem
Wagen durch die Lüfte.
„Ostsntstioll äsIösus-OIirist^vonMichelDumas,
einem Schüler von Jngres, verräth durch edlen Stil
der Komposition und gediegene Farbe einen ernst streben-
den Künstler. Das Bild war das beste unter den Gemäl-
den religiöser Gattung im Salon.
Ein junger Maler, Achille Sirouy, debutirte mit
Der Salon von 1872. II.
72
bewaffneten Männer stehen, ist trefflich studirt und von
natürlicher und ergreifender Wirkung. Das zweite Bild:
„liis paps I?ormo8s st hltisnns VII." wird für den in
die Geschichte der Päpste nicht genau Eingeweihten im
Kataloge ausführlich folgendermaßen erklärt: „Der Leich-
nam des Papstes Formosus wurde auf Befehl Stephan's
des VII., seines Nachfolgers, ausgegraben und mit seinen
priesterlichen Gewändern in den Sitzungssaal des Concils
gebracht und auf den päpstlichen Stuhl gesetzt, und sodann
ein Advokat bestimmt, im Namen des Todten zu antworten.
— Darauf sprach Stephan zu dem Cadaver: — ,,„Wa-
rum, Bischof von Porto, hat sich dein Ehrgeiz bis zum
Thron von Rom erhoben?""—" Das Bild macht
einen düsteren Eindruck; man riecht förmlich den Grabes-
duft. Nicht nur der modernde Bischof in seinen gold-
gestickten Meßgewändern, auch der Teppich unter dem
erhöhten Thronsessel, der mit meisterhafterTechnik gemalt
ist, und die Bischöfe, welche zur linken Seite versammelt
sind, scheinen vom Hauche der Verwesung angegriffen;
die einzige frische Gestalt ist die des jungen Advokaten,
welcher zur Seite des Todten für diesen plaidirt.
Unter den mit der Medaille erster Klasse bedachten
Bildern ist auch Jules Machard's „Xursisss st la
souros": ein gut gemalter nackter Jüngling, der wohl-
gefällig sein Spiegelbild im Wasser betrachtet; neben ihm
befindet sich eine ebenfalls nackte, aber etwas mollusken-
hafte Frauengestalt.
Georges Becker's „Uu vsuvs llu msrt^r", eiu
großes Bild, hat neben unläugbaren Vorzügen in der
Komposition und in der Farbe eigenthümliche Fehler.
Die Wittwe, eine junge, schlanke, edle Gestalt, steht mit
ihren drei Kindern in den Katakomben; sie hebt das
Kleinste in die Höhe, um ein auf einen Stein gezeichnetes
Kreuzeszeichen zu küssen; ein erwachsenes MLdchen und
ein kleiner Knabe stehen hinter der Mutter; alle sind in
ein weißgelbes faltenreiches Gewand gekleidet, was den
etwas steif dastehenden Gestalten fast den Anschein ver-
gilbter Gypsfiguren giebt.
Des Elsässers Jean Benner großes Bild:
„Vprss uus temxsts ü Oapri" hat gleich dem vorge-
nannten eine Medaille zweiter Klasse erhalten, welche
gar manches andere Bild weit eher verdient hätte: auf
einem steilen, gegen das Meer vorspringenden Felsen stehen,
sitzen uud klettern acht junge Mädchen jammernd und mit
aufgelösten Haaren herum. Hat das fürchterliche Meer
mit Einem Male acht Bräutigame verschlungen? Das
wäre allerdings tragisch! Da wir aber einen solchen
Unfall aus dem Bilde nicht mit Sicherheit entnehmen
können, dasselbe auch in koloristischer Beziehung nichts
Besonderes bietet, so bleiben wir ziemlich ungerührt.
Josephe Fortuns Layraud, ein Schüler von Cogniet
und Robert Fleury, behandelt in zwei Bildern zwei sehr
verschiedene Stoffe; sein „Marsyas" ist eine gut gezeich-
nete, aber etwas trüb und schwer gemalte Akademie-Figur;
die Darstellung eines sich unter Martern Krümmenden
wirkt nie ansprechend, wenn nicht dabei auch ein edlerer
psychologischer Zug zum Ausdrucke kommt. „Lri^Lnlls
st saptiks" nennt sich ein großes Galeriebild, welches
eine Scene aus dem italienischen Räuberleben darstellt.
Ein junger Mann, anscheinend ein englischer Lord, ist
mit einer jungen Dame von einer zahlreichen Briganten-
bande abgefangen worden und verhandelt mit demHaupt-
mann unter erschwerenden Umständen utti das Lösegeld.
Die Gruppe ist lebendig und gut charakterisirt, die Land-
schaft, in welcher sie sich aufhält, trägt eine dem Augenblick
entsprechende Stimmung; das Bild muthet den Beschauer
an wie eine interessant erzählte Räubergeschichte.
Des originellen Lecomte du Nouy diesjähriges
Bild: „Iws portsnrs äss munvumss nouvsllss" ist durch
den Stich schon in Deutschland bekannt. Pharao ruht auf
einem Lager auf der Terrasse seines Palastes, nachdenklich
auf die im fahlen Dämmer der Mondnacht vor ihm aus-
gebreitete Stadt blickend; neben ihm liegen in ihrem Blute
drei Boten, welche als Lohn für die überbrachten Hiobs-
posten den Todesstreich von ihrein tyrannischen Gebieter
empfangen haben. Eine durch ihre Einfachheit ergreifende
Stelle in Theophil Gautier's „Im Nomis" hat den
Künstler zu diesem Gemälde begeistert. Sie lautet ....
„IIn ssoollll MsssaAsr roulu L oots äu prsmisr. IIn
troisisms sut Is. msms sort. Ht klisrson, plsnsnt
psr I'osil äs Is psnsss sur ostts vills llsmssurlls, llont
II 6ta.it Is maitrs absolu, rsllso1n88a.it tristsmsnt aux
bornos llu pouvoir bumain . . . ." Ein kleines Bild
desselben Künstlers: „Oömostlisns 8'sxsros ä la parols"
zeigt uns den Redner mit im Winde slatterndem Mantel
auf dem Felde spazierend uud mit den Händen agirend.
Lecomte du Nouy ist ebenso eigenthümlich wie in seinen
Motiven auch in seiner Malweise; er ist kein Kolorist,
er ist aber auch kein Verächter der Farbe, er stimmt sie
nur herab, ordnet sie dem Gegenstande unter; er hat auch
darin seinen eigenen Stil; seineZeichnung ist stets streng
und korrekt.
Louis FelixGuesnet's „Mazeppa" zeugt vontüch-
tiger malerischer Fähigkeit; die Komposition vermagjedoch
uicht besonders zu interessiren.
Frsderic Bridgman's „L.xollon6nlövsnt0^rsns"
ist eine mit Grazie und Schwung ausgeführte Komposition.
Der junge Gott rast mit seiner reizenden Beute auf gvl-
denem, von einem prächtigen Viergespann gezogenem
Wagen durch die Lüfte.
„Ostsntstioll äsIösus-OIirist^vonMichelDumas,
einem Schüler von Jngres, verräth durch edlen Stil
der Komposition und gediegene Farbe einen ernst streben-
den Künstler. Das Bild war das beste unter den Gemäl-
den religiöser Gattung im Salon.
Ein junger Maler, Achille Sirouy, debutirte mit