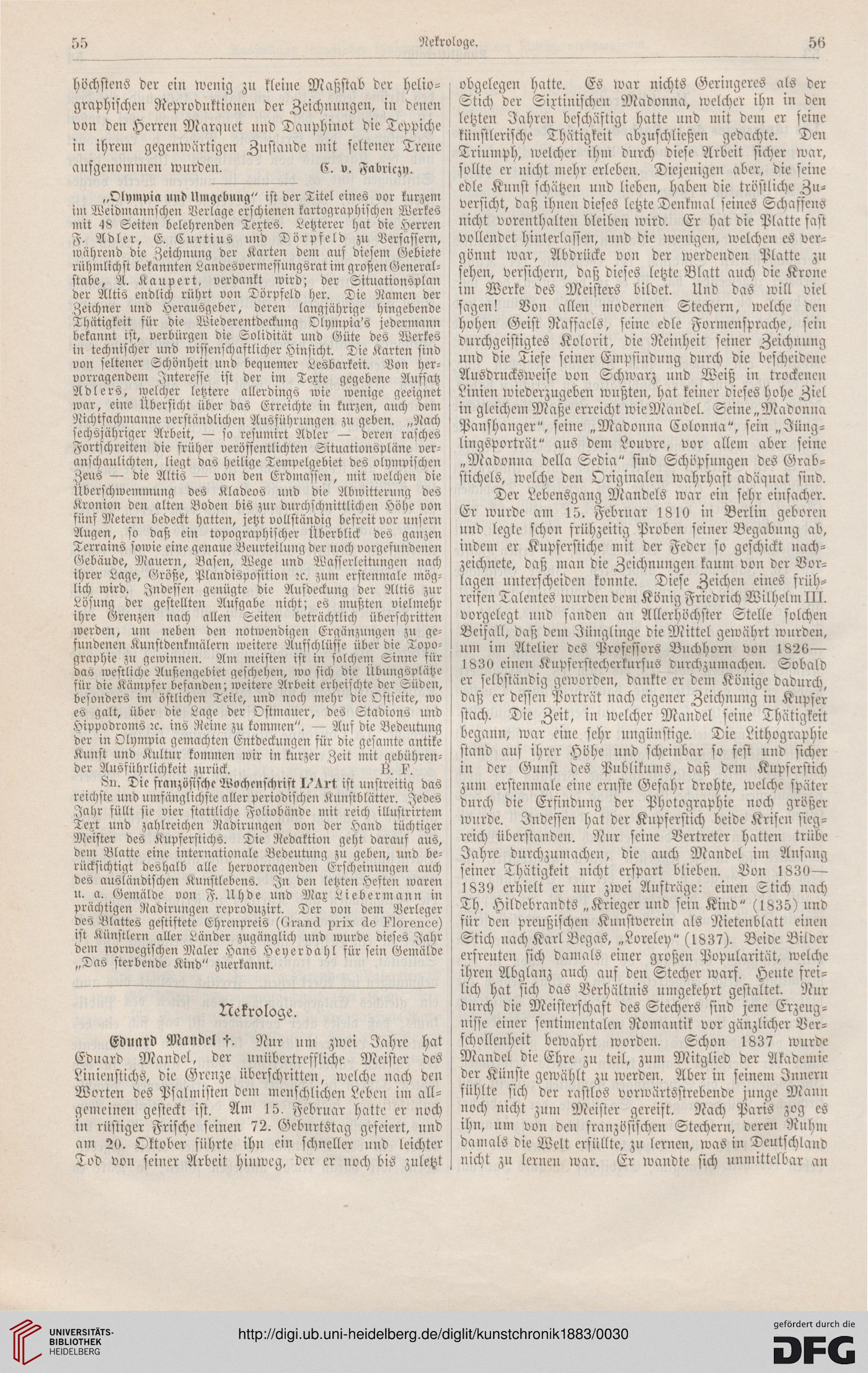Nekrologe.
56
höchstens der ein wenig zu kleine Maßstab der helio-
graphischen Reprodnktionen der Zeichnungen, in denen
von den Herren Marguet und Dauphinot die Teppiche
in ihrem gegenwärtigen Zustande mit seltener Trcue
aufgenommen wurden. E. v, Faliriczy.
„Olympia mid Umgclmng" ist der Trtel eines vor kurzem
nir Weidmannschen Verlage erschiensn kartographrschen Werkes
mit Y8 Seiten belehrenden Textes. Letzterer hat die Herren
F. Adler, E. Curtius und Dörpfeld zu Verfasssrn,
ivährend die Zeichnung der Karten dem auf diesem Geoiete
rühmlichst bekannten Landesvermessungsrat im großen General-
stabe, A. Kaupert, verdankt rvird; der Situationsplan
der Altis endlich rührt von Dörpfeld her. Die Namen der
Zeichner und Herausgebsr, deren langjährigs hingebende
Thätigkeit für dis Wisderentdeckung Olympirüs jsdermamr
bekannt ist, verbürgen die Solidität und Grrte des Werkes
in technischer und wissenschaftlicher Hinsicht. Die Karten sind
von seltener Schönheit u»d bequemer Lesbarkeit. Von her-
vorragendem Jnteresse ist der im Texte gegebene Aufsatz
Adlers, welcher letztere allerdings ivie ivenige geeignet
war, eine Übersicht über das Erreichte in kurzen, auch dem
Nichtfachmanne verständlichsn Ausführungen zu geben. „Nach
sechsjähriger Arbeit, — so resuinirt Adler — deren rasches
Fortschreitsn die früher veröffentlichten Situationspläne ver-
anschaulichten, liegt das heilige Tempelgebiet des olympischen
Zeus — die Altis — von den Erdmassen, mit ivelchen die
Überschwemmung des Kladeos und die Abwitterung des
Kronion den alten Boden bis zur durchschnittlichen Höhe von
fünf Metern bsdeckt hatten, jstzt vollständig befreit vor unsern
Augen, so dah ein topographischer Überblick des ganzen
Terrains sowie eine genaue Beurteilung der noch vorgefundenen
Gebäuds, Mausrn, Basen, Wege und Wasserleitungen nach
ihrer Lage, Größs, Plandisposition rc. zum erstenmals mög-
lich wird. Jndesssn genügte die Aufdeckung dsr Altis zur
Lösung der gestellten Aufgabe nicht; es mußten vielmehr
ihre Grenzen nach allen Seiten beträchtlich überschritten
werden, uin neben den notwendigen Ergünzungeii zu ge-
fundenen Kunstdenkmälern iveitsre Äufschlüffs über die Topo-
graphie zu gewinnen. Am meisten ist in solchem Sinne für
das westliche Außsngebiet geschshen, wo sich die Übungsplätze
für die Kämpfer befanden; weitere Arbeit erheischte der Süden,
besonders im östlichen Teile, und noch mehr die Ostseite, wo
es galt, über die Lage der Ostmauer, des Stadions und
Hippodroms rc. ins Reine zu kommen". — Auf die Bedeutung
der in Olympia gemachten Entdeckungen für die gesamte antiks
Kunst und Kultur kommsn wir in kurzer Zeit mit qebührsn-
der Ausführlichkeit zurück. Ü. i?.
8n. Dic französrschc Wochcirschrist I? V ri ist unstreitig das
reichste und umfänglichste aller periodischen Kunstblätter. Jedes
Jahr füllt sie vier stattliche Foliobände mit reich illustrirtem
Text und zahlreichen Radirungen von der Hand tüchtiger
Meister des Kupfsrstichs. Die Redaktion geht darauf aus,
dem Blatte eine internationale Bedeutung zu geben, und be-
rücksichtigt deshalb alle hervorragenden Erscheinungen auch
des ausländischen Kunstlebens. Jn den letzten Heften waren
u. a. Gsmälde von F. llhde und Max Liebermann in
prächtigsn Radirungen reproduzirt. Der vorr dem Verleger
des Blattes gestiftete Ehrenpreis (Ornnci. prix cko ikiorsiros)
ist Künstlern aller Länder zugänglich und wurde dieses Jahr
dem norwegischen Maler Hans Heysrdahl für sein Gemälde
„Das sterbende Kind" zuerkannt.
Nekrologe.
Ednard Mandel ch. Nur um zwei Jahre hat
Eduard Mandel, der unribertreffliche Meister des
Liuieustichs, die Greuze überschritten, welche nach den
Worten des Psalmisten dem menschlicheu Leben im all-
gemeinen gesteckl ist. Am 15. Februar hatte er nvch
in rüstiger Frische seinen 72. Geburtstag gefeiert, und
am 20. Oktober sührte ihn ein schneller und leichter
Tod von seiner Arbeit hinweg, der er noch bis zuletzt
obgelegen hatte. Es war nichts Geringeres als der
Stich der Sixtinischen Madonna, welcher ihn in den
letzten Jahren beschäftigt hatte und mit dem er seine
künstlerische Thätigkeit abzuschließen gedachte. Den
Triumph, welcher ihm durch diese Arbeit sicher war,
sollte cr nicht nrehr erlcben. Diejenigen aber, die seine
edle Kunst schätzen und lieben, haben die tröstliche Zu-
versicht, daß ihnen dieses letzte Denkmal seines Schaffens
nicht vorenthalten bleibcn wird. Er hat die Platte fast
vollendet hinterlassen, und die wenigen, welchen es ver-
gönnt war, Abdrücke von der werdenden Platte zn
sehen, versichcrn, daß dieses lctzte Blatt auch die Krvne
im Werke des Meisters bildet. Und das will viel
sagen! Von allen modernen Stechern, welche den
hohen Geist Raffacls, feine edle Formensprache, sein
durchgeistigtes Kolorit, die Reinheit seiner Zeichnung
und die Tiefe seiner Empfindnng durch die bescheidene
Ausdrucksweise von Schwarz und Weiß in trockenen
Linien wiederzugeben wußten, hat keiner dieses hohe Ziel
in gleichemMaße erreicht wieMandel. Seine„Madonna
Panshanger", seine „Madonna Colonna", sein „Jüng-
lingsporträt" aus dem Louvre, vor allem aber seine
„Madonna della Sedia" sind Schöpfungen des Grab-
stichels, welche den Originalen wahrhaft adäquat sind.
Der Lebensgang Mandels war ein sehr einfacher.
Er wurde am 15. Febrnar 1810 in Berlin geboren
und legte schon frühzeitig Proben seiner Begabung ab,
indem er Kupferstiche mit der Feder so geschickt nach-
zeichnete, daß man die Zeichnungen kaum von der Vor-
lagen unterscheiden konnte. Diese Zeichen eines früh-
reifen Talentes wurden dcm König Friedrich Wilhelm III.
vorgelegt und fanden an Allerhöchster Stelle solchen
Beifall, daß dem Jünglinge die Mittel gewährt wurden,
um im Atelier des Professors Buchhorn von 1826—
1830 einen Kupferstecherkursus durchzumachen. Sobald
er selbständig geworden, dankte er dem Könige dadurch,
daß er dessen Porträt nach eigener Zeichnung in Kupser
stach. Die Zeit, in welcher Mandel seine Thätigkeit
begann, war eine sehr ungünstige. Die Lithographie
stand auf ihrer Höhe und scheinbar so fest und sicher
in der Gunst des Publikums, daß dem Kupferstich
zunr erstenmale eine ernste Gefahr drohte, welche später
durch die Erfindung der Photographie nvch größer
ivnrde. Jndessen hat der Kupferstich beide Krisen sieg-
reich überstanden. Nur seine Vertreter hatten trübe
Jahre durchzumachen, die auch Mandel im Anfang
seiner Thätigkeit nicht erspart blieben. Von 1830—
1839 erhielt er nur zwei Aufträge: einen Stich nach
Th. Hildebrandts „Krieger und sein Kind" (1835) und
für den preußischen Kunstverein als Nietenblatt einen
Stich nach KarlBegas, „Loreley" (1837). Beide Bilder
erfrenten sich damals einer großen Popularität, welche
ihren Abglanz auch auf den Stecher warf. Heute frei-
lich hat sich das Verhältnis umgekehrt gestaltet. Nur
durch die Meisterschaft des Stechers sind jene Erzeug-
nisse einer sentimentalen Romantik vor gänzlicher Ver-
schollenheit bewahrt worden. Schon 1837 wurde
Mandel die Ehre zn teil, zum Mitglied der Akademie
der Künste gewählt zu werden. Aber in seinem Jnnern
fühlte fich der rastlos vorwärtsstrebende junge Mann
noch nicht zuni Meister gereift. Nach Paris zog es
ihn, um von den französischen Stechern, deren Ruhm
damals die Welt erfüllte, zn lernen, was in Dentschland
nicht zu lernen war. Er wandte sich unnrittelhar an