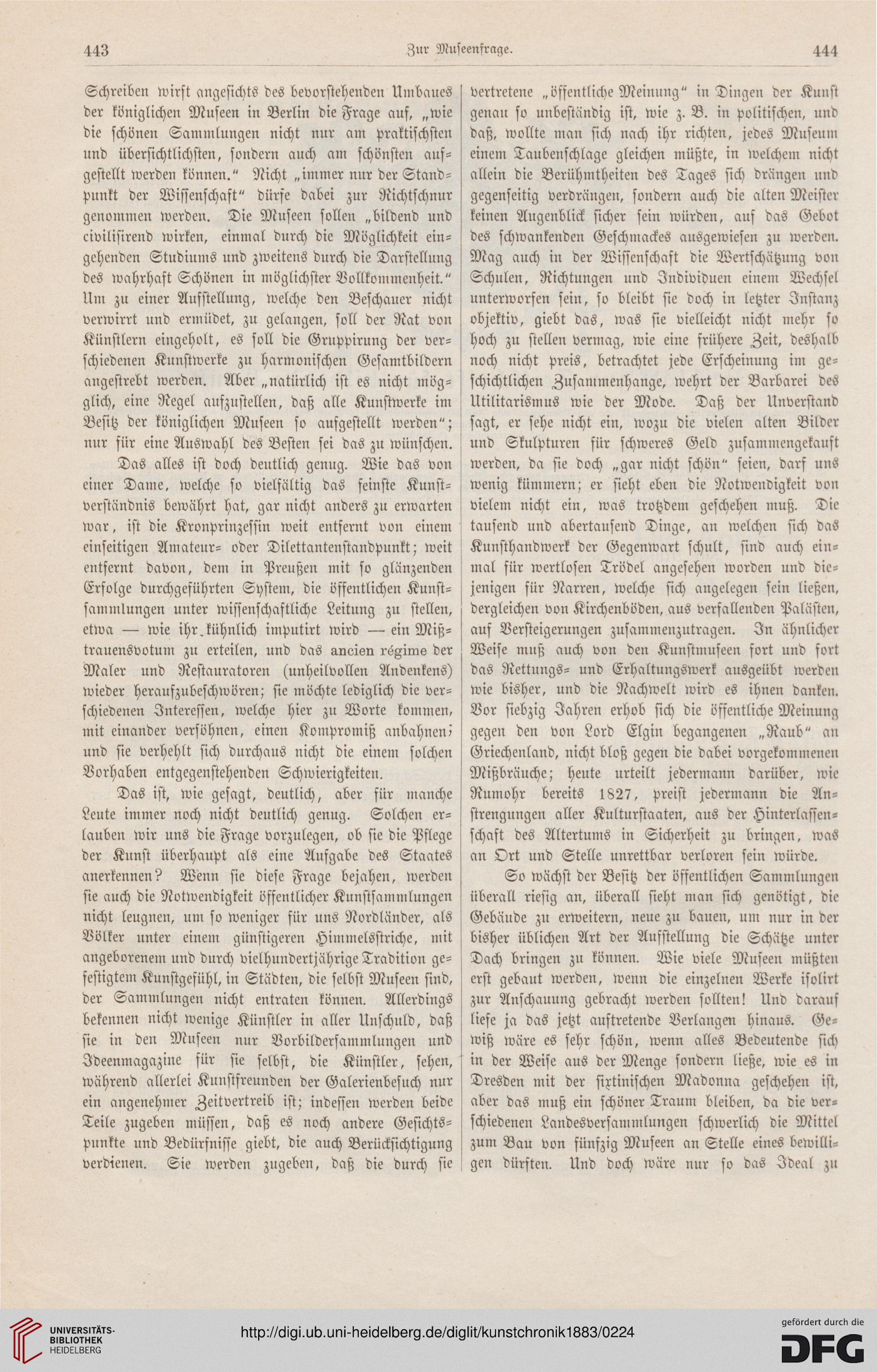443
Zur Museenfrage.
444
Schreiben wirft angesichts des bevorstehenden Umbaues
der königlichen Museen in Berlin die Frage auf, „wie
die schönen Sammlungen nicht nur am praktischsten
und übersichtlichsten, sondern auch am schönsten auf-
gestellt werden können." Nicht „immer nnr der Stand-
punkt der Wiffenschaft" diirse dabei zur Richtfchnur
genommen werden. Die Museen sollen „bildend und
civilisirend wirken, einmal durch die Möglichkeit ein-
gehenden Studiums und zweitens durch die Darstellung
des wahrhaft Schönen in möglichster Vollkonimenheit."
Um zu einer Aufstellung, welche den Beschauer nicht
verwirrt und ermüdet, zu gelangen, soll der Rat von
Künstlern eingeholt, es soll die Gruppirung der ver-
schiedenen Kunstwerke zu harmonischen Gesamtbildern
angestrebt werden. Aber „natürlich ist es nicht mög-
glich, eine Regel aufzustellen, daß alle Kunstwerke im
Besitz der königlichen Museen so ausgestellt werden";
nur für eine Auswahl des Besten sei das zu wünschen.
Das alles ist doch deutlich genug. Wie das von
einer Dame, welche so vielfältig das feinste Kunst-
verständnis bewährt hat, gar nicht anders zu erwarten
war, ist die Kronprinzessin weit entfernt von einem
einseitigen Amateur- oder Dilettantenstandpunkt; weit
entfernt davon, dem in Preußen mit so glänzenden
Erfolge durchgeführten System, die öffentlichen Kunst-
sammlungen unter wissenschaftliche Leitung zu stellen,
etwa — wie ihr.kühnlich imputirt wird —ein Miß-
trauensvotum zu erteilen, und das ullolon rögims der
Maler nnd Restauratoren (unheilvollen Andenkens)
wieder heraufzubeschwören; sie mvchte lediglich die ver-
schiedenen Jntereffen, welche hier zu Worte kommen,
mit einander versöhnen, einen Kompromiß anbahneni
und sie verhehlt sich durchaus nicht die einem solchen
Vorhaben entgegenstehenden Schwierigkeiten.
Das ist, wie gesagt, deutlich, aber für manche
Leute immer noch nicht deutlich genug. Solchen er-
tauben wir uns die Frage vorzulegen, ob sie die Pflege
der Kunst überhaupt als eine Aufgabe des Staates
anerkennen? Wenn sie diese Frage bejahen, werden
sie auch die Notwendigkeit öffentlicher Knnstsammlungen
uicht leugnen, um so weniger für uns Nordländer, als
Völker unter einem günstigeren Himmelsstriche, mit
angeborenem und durch vielhnndertjährige Tradition ge-
festigtem Kunstgefühl, in Städten, die selbst Museen sind,
der Sammlungen nicht entraten können. Allerdings
bekennen nicht wenige Künstler in aller Unschuld, daß
sie in den Museen nur Vorbildersammlungen und
Jdeenmagazine für sie selbst, die Künstler, sehen,
während allerlei Kunstfreunden der Galerienbesuch nur
ein angenehmer Zeitvertreib ist; indessen werden beide
Teile zugeben müssen, daß es noch andere Gesichts-
punkte und Bedürfnisse giebt, die auch Berücksichtigung
verdienen. Sie werden zugeben, daß die durch sie
vertretene „öffentliche Meinung" in Dingen der Kuust
genau so unbeständig ist, wie z. B. in politischen, und
daß, wollte man sich nach ihr richten, jedes Museum
einem Taubenschlage gleichen müßte, in welchem nicht
allein die Berühmtheiten des Tages sich drängen und
gegenseitig verdrängen, sondern auch die alten Meister
keinen Augenblick sicher sein würden, aus das Gebot
des schwankenden Geschmackes ausgewiesen zu werden.
Mag auch in der Wiffenschaft die Wertschätzung von
Schuleu, Richtungen und Jndividuen einem Wechsel
unterworfen sein, so bleibt sie doch in letzter Jnstanz
objektiv, giebt das, was sie vielleicht nicht mehr so
hoch zu stelleu vermag, wie eine frühere Zeit, deshalb
noch nicht preis, betrachtet jede Erscheinung im ge-
schichtlichen Zusammenhange, wehrt der Barbarei des
Utilitarismus wie der Mode. Daß der Unverstand
^ sagt, er sehe nicht ein, wozu die vielen alten Bilder
^ und Skulpturen für schweres Geld zusammengekauft
^ werden, da sie doch „gar nicht schön" seien, darf uns
^ wenig kümmern; er sieht ebeu die Notwendigkeit von
> vielem nicht ein, was trotzdem geschehen muß. Dic
I tausend und abertausend Dinge, an welchen sich das
Kunsthandwerk der Gegenwart schult, sind auch ein-
mal für wertlosen Trödel angesehen worden und die-
jenigen sür Narren, welche sich angelegen sein ließen,
dergleichen von Kirchenböden, aus verfallenden Palästen,
auf Versteigerungen zusammenzutragen. Jn ähnlichcr
Weise muß auch von den Kunstmuseen fort und fort
das Rettungs- und Erhaltungswerk ausgeübt werdcn
wie bisher, und die Nachwelt wird es ihnen danken.
Vor siebzig Jahren erhob sich die öffentliche Meinung
gegen den von Lord Elgin begangenen „Raub" an
Griechenland, nicht bloß gegen die dabei vorgekommenen
Mißbräuche; heute urteilt jedermanu darüber, wie
Rumohr bereits 1827, preist jedermann die An-
strengungen aller Kulturstaaten, aus der Hinterlassen-
schaft des Altertums in Sicherheit zu bringen, was
an Ort und Stelle unrettbar verloren sein würde.
So wächst der Besitz der öffentlichen Sammlungen
überall riesig an, überall sieht man sich genötigt, die
Gebäude zu erweitern, neue zu bauen, um nur in der
bisher üblichen Art der Aufstellung die Schätze unter
Dach bringen zu können. Wie viele Museen müßten
erst gebaut werden, wenn die einzelnen Werke isolirt
zur Anschauung gebracht werden sollten! Und darauf
liefe ja das jetzt auftretende Verlangeu hinaus. Ge-
wiß wäre es sehr schön, wenn alles Bedeutende sich
in der Weise aus der Menge sondern ließe, wie es in
Dresden mit der siptinischen Madonna geschehen ist,
aber das muß eiu schöner Traum bleiben, da die ver-
schiedenen Landesversammlungen schwerlich die Mittel
zum Bau von fünfzig Museen an Stelle eines bewilli-
gen dürsten. Und doch wäre nur so das Jdeal zu
Zur Museenfrage.
444
Schreiben wirft angesichts des bevorstehenden Umbaues
der königlichen Museen in Berlin die Frage auf, „wie
die schönen Sammlungen nicht nur am praktischsten
und übersichtlichsten, sondern auch am schönsten auf-
gestellt werden können." Nicht „immer nnr der Stand-
punkt der Wiffenschaft" diirse dabei zur Richtfchnur
genommen werden. Die Museen sollen „bildend und
civilisirend wirken, einmal durch die Möglichkeit ein-
gehenden Studiums und zweitens durch die Darstellung
des wahrhaft Schönen in möglichster Vollkonimenheit."
Um zu einer Aufstellung, welche den Beschauer nicht
verwirrt und ermüdet, zu gelangen, soll der Rat von
Künstlern eingeholt, es soll die Gruppirung der ver-
schiedenen Kunstwerke zu harmonischen Gesamtbildern
angestrebt werden. Aber „natürlich ist es nicht mög-
glich, eine Regel aufzustellen, daß alle Kunstwerke im
Besitz der königlichen Museen so ausgestellt werden";
nur für eine Auswahl des Besten sei das zu wünschen.
Das alles ist doch deutlich genug. Wie das von
einer Dame, welche so vielfältig das feinste Kunst-
verständnis bewährt hat, gar nicht anders zu erwarten
war, ist die Kronprinzessin weit entfernt von einem
einseitigen Amateur- oder Dilettantenstandpunkt; weit
entfernt davon, dem in Preußen mit so glänzenden
Erfolge durchgeführten System, die öffentlichen Kunst-
sammlungen unter wissenschaftliche Leitung zu stellen,
etwa — wie ihr.kühnlich imputirt wird —ein Miß-
trauensvotum zu erteilen, und das ullolon rögims der
Maler nnd Restauratoren (unheilvollen Andenkens)
wieder heraufzubeschwören; sie mvchte lediglich die ver-
schiedenen Jntereffen, welche hier zu Worte kommen,
mit einander versöhnen, einen Kompromiß anbahneni
und sie verhehlt sich durchaus nicht die einem solchen
Vorhaben entgegenstehenden Schwierigkeiten.
Das ist, wie gesagt, deutlich, aber für manche
Leute immer noch nicht deutlich genug. Solchen er-
tauben wir uns die Frage vorzulegen, ob sie die Pflege
der Kunst überhaupt als eine Aufgabe des Staates
anerkennen? Wenn sie diese Frage bejahen, werden
sie auch die Notwendigkeit öffentlicher Knnstsammlungen
uicht leugnen, um so weniger für uns Nordländer, als
Völker unter einem günstigeren Himmelsstriche, mit
angeborenem und durch vielhnndertjährige Tradition ge-
festigtem Kunstgefühl, in Städten, die selbst Museen sind,
der Sammlungen nicht entraten können. Allerdings
bekennen nicht wenige Künstler in aller Unschuld, daß
sie in den Museen nur Vorbildersammlungen und
Jdeenmagazine für sie selbst, die Künstler, sehen,
während allerlei Kunstfreunden der Galerienbesuch nur
ein angenehmer Zeitvertreib ist; indessen werden beide
Teile zugeben müssen, daß es noch andere Gesichts-
punkte und Bedürfnisse giebt, die auch Berücksichtigung
verdienen. Sie werden zugeben, daß die durch sie
vertretene „öffentliche Meinung" in Dingen der Kuust
genau so unbeständig ist, wie z. B. in politischen, und
daß, wollte man sich nach ihr richten, jedes Museum
einem Taubenschlage gleichen müßte, in welchem nicht
allein die Berühmtheiten des Tages sich drängen und
gegenseitig verdrängen, sondern auch die alten Meister
keinen Augenblick sicher sein würden, aus das Gebot
des schwankenden Geschmackes ausgewiesen zu werden.
Mag auch in der Wiffenschaft die Wertschätzung von
Schuleu, Richtungen und Jndividuen einem Wechsel
unterworfen sein, so bleibt sie doch in letzter Jnstanz
objektiv, giebt das, was sie vielleicht nicht mehr so
hoch zu stelleu vermag, wie eine frühere Zeit, deshalb
noch nicht preis, betrachtet jede Erscheinung im ge-
schichtlichen Zusammenhange, wehrt der Barbarei des
Utilitarismus wie der Mode. Daß der Unverstand
^ sagt, er sehe nicht ein, wozu die vielen alten Bilder
^ und Skulpturen für schweres Geld zusammengekauft
^ werden, da sie doch „gar nicht schön" seien, darf uns
^ wenig kümmern; er sieht ebeu die Notwendigkeit von
> vielem nicht ein, was trotzdem geschehen muß. Dic
I tausend und abertausend Dinge, an welchen sich das
Kunsthandwerk der Gegenwart schult, sind auch ein-
mal für wertlosen Trödel angesehen worden und die-
jenigen sür Narren, welche sich angelegen sein ließen,
dergleichen von Kirchenböden, aus verfallenden Palästen,
auf Versteigerungen zusammenzutragen. Jn ähnlichcr
Weise muß auch von den Kunstmuseen fort und fort
das Rettungs- und Erhaltungswerk ausgeübt werdcn
wie bisher, und die Nachwelt wird es ihnen danken.
Vor siebzig Jahren erhob sich die öffentliche Meinung
gegen den von Lord Elgin begangenen „Raub" an
Griechenland, nicht bloß gegen die dabei vorgekommenen
Mißbräuche; heute urteilt jedermanu darüber, wie
Rumohr bereits 1827, preist jedermann die An-
strengungen aller Kulturstaaten, aus der Hinterlassen-
schaft des Altertums in Sicherheit zu bringen, was
an Ort und Stelle unrettbar verloren sein würde.
So wächst der Besitz der öffentlichen Sammlungen
überall riesig an, überall sieht man sich genötigt, die
Gebäude zu erweitern, neue zu bauen, um nur in der
bisher üblichen Art der Aufstellung die Schätze unter
Dach bringen zu können. Wie viele Museen müßten
erst gebaut werden, wenn die einzelnen Werke isolirt
zur Anschauung gebracht werden sollten! Und darauf
liefe ja das jetzt auftretende Verlangeu hinaus. Ge-
wiß wäre es sehr schön, wenn alles Bedeutende sich
in der Weise aus der Menge sondern ließe, wie es in
Dresden mit der siptinischen Madonna geschehen ist,
aber das muß eiu schöner Traum bleiben, da die ver-
schiedenen Landesversammlungen schwerlich die Mittel
zum Bau von fünfzig Museen an Stelle eines bewilli-
gen dürsten. Und doch wäre nur so das Jdeal zu