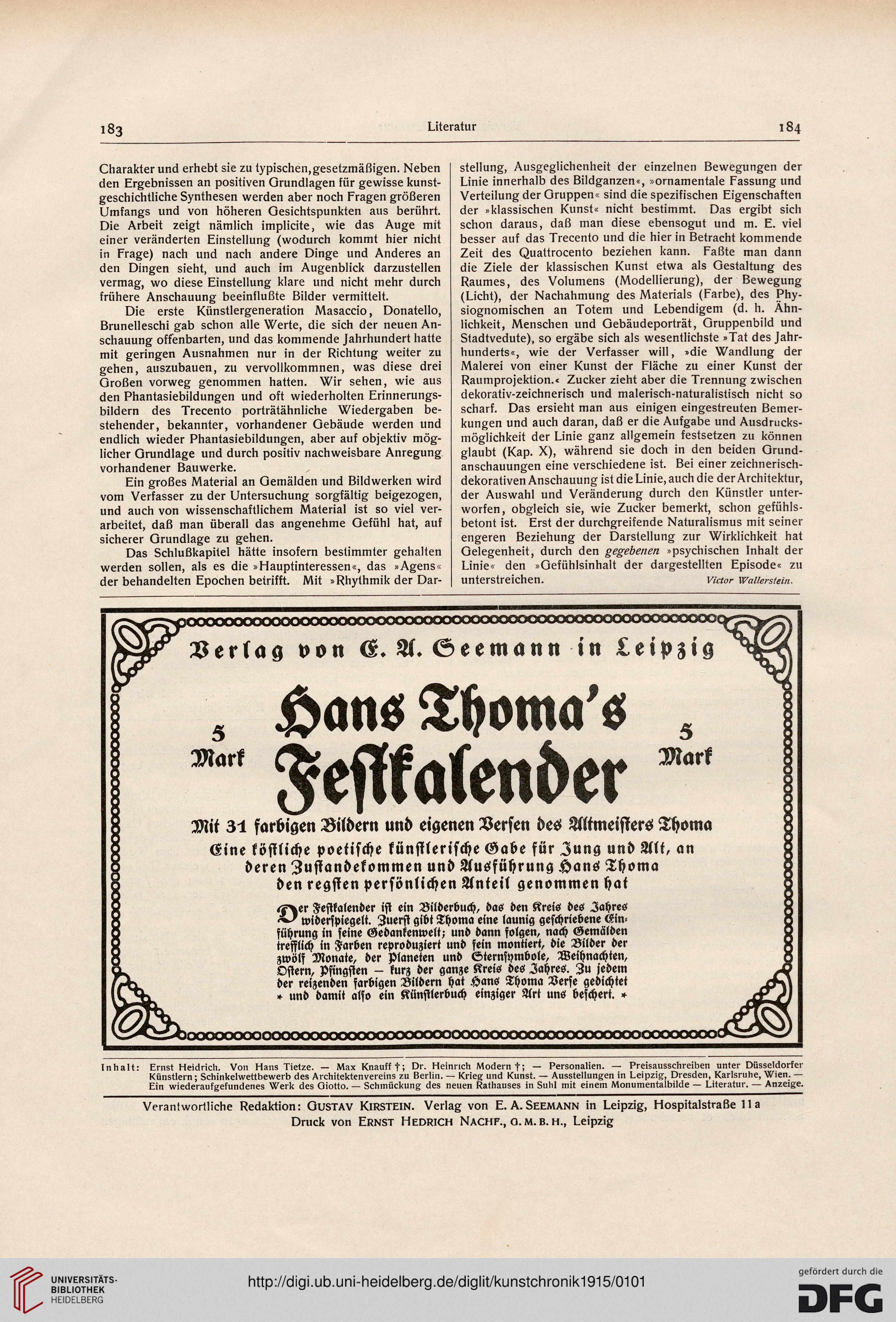i83
Literatur
184
Charakter und erhebt sie zu typischen,gesetzmäßigen. Neben
den Ergebnissen an positiven Grundlagen für gewisse kunst-
geschichtliche Synthesen werden aber noch Fragen größeren
Umfangs und von höheren Gesichtspunkten aus berührt.
Die Arbeit zeigt nämlich implicite, wie das Auge mit
einer veränderten Einstellung (wodurch kommt hier nicht
in Frage) nach und nach andere Dinge und Anderes an
den Dingen sieht, und auch im Augenblick darzustellen
vermag, wo diese Einstellung klare und nicht mehr durch
frühere Anschauung beeinflußte Bilder vermittelt.
Die erste Künstlergeneration Masaccio, Donatello,
Brunelleschi gab schon alle Werte, die sich der neuen An-
schauung offenbarten, und das kommende Jahrhundert hatte
mit geringen Ausnahmen nur in der Richtung weiter zu
gehen, auszubauen, zu vervollkommnen, was diese drei
Großen vorweg genommen hatten. Wir sehen, wie aus
den Phantasiebildungen und oft wiederholten Erinnerungs-
bildern des Trecento porträtähnliche Wiedergaben be-
stehender, bekannter, vorhandener Gebäude werden und
endlich wieder Phantasiebildungen, aber auf objektiv mög-
licher Grundlage und durch positiv nachweisbare Anregung
vorhandener Bauwerke.
Ein großes Material an Gemälden und Bildwerken wird
vom Verfasser zu der Untersuchung sorgfältig beigezogen,
und auch von wissenschaftlichem Material ist so viel ver-
arbeitet, daß man überall das angenehme Gefühl hat, auf
sicherer Grundlage zu gehen.
Das Schlußkapitel hätte insofern bestimmter gehalten
werden sollen, als es die »Hauptinteressen«, das »Agens«
der behandelten Epochen betrifft. Mit »Rhythmik der Dar-
stellung, Ausgeglichenheit der einzelnen Bewegungen der
Linie innerhalb des Bildganzen«, »ornamentale Fassung und
Verteilung der Gruppen« sind die spezifischen Eigenschaften
der »klassischen Kunst« nicht bestimmt. Das ergibt sich
schon daraus, daß man diese ebensogut und m. E. viel
besser auf das Trecento und die hier in Betracht kommende
Zeit des Quattrocento beziehen kann. Faßte man dann
die Ziele der klassischen Kunst etwa als Gestaltung des
Raumes, des Volumens (Modellierung), der Bewegung
(Licht), der Nachahmung des Materials (Farbe), des Phy-
siognomischen an Totem und Lebendigem (d. h. Ähn-
lichkeit, Menschen und Gebäudeporträt, Gruppenbild und
Stadtvedute), so ergäbe sich als wesentlichste »Tat des Jahr-
hunderts«, wie der Verfasser will, »die Wandlung der
Malerei von einer Kunst der Fläche zu einer Kunst der
Raumprojektion.« Zucker zieht aber die Trennung zwischen
dekorativ-zeichnerisch und malerisch-naturalistisch nicht so
scharf. Das ersieht man aus einigen eingestreuten Bemer-
kungen und auch daran, daß er die Aufgabe und Ausdrucks-
möglichkeit der Linie ganz allgemein festsetzen zu können
glaubt (Kap. X), während sie doch in den beiden Grund-
anschauungen eine verschiedene ist. Bei einer zeichnerisch-
dekorativen Anschauung ist die Linie, auch die der Architektur,
der Auswahl und Veränderung durch den Künstler unter-
worfen, obgleich sie, wie Zucker bemerkt, schon gefühls-
betont ist. Erst der durchgreifende Naturalismus mit seiner
engeren Beziehung der Darstellung zur Wirklichkeit hat
Gelegenheit, durch den gegebenen »psychischen Inhalt der
Linie« den »Gefühlsinhalt der dargestellten Episode« zu
unterstreichen. Victor Wallerstein.
3Karf
5
'Marl
3O00000000000O00O000OOCXX30O00O00O0O0OO0OCXX)0O000OO0O0000OC
#er(ag Don (f. <3eemanti in leidig
$ejffa(en&er
Mi 31 farbigen Sitöern unb eigenen Herfen &e$ 3flfmeiffer$ Xboma
(Sine föfHidje poefifdje fünfHerifdje ®af>e für 3una uni> Mit, an
i>eren 3uftani>efommen unf> 3(uäfüfyruna ftanei If)omo
Den regffen perfönlidjen Anteil genommen fyat
<f\tr $eftfa(enber ift ein 33ilber6ua), bat ben ütreig btä 3al?re«
wiberfofegelt. Suerft gifct Storno eine launig geftfjrie&ene (Sin*
füfjrung in feine ©ebanfenwelt; im6 bann folgen, naa) ©emä'lben
trefflldj in jarben reproduziert unt> fein montiert, bie Silber ber
5»ötf OTonate, ber planeren unb ©ternfsjmoole, 3Beif/nad)ten,
Dftern, Pfmgften - furj ber ganae Äreiö be« 3af/re«f. 3u jebem
ber reijenben farbigen Silbern f>at fyawi Sfjoma #erfe gebietet
* unb batnit alfo ein Rünftlerbudj einiger SMrt un«f befdjert. *
>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Inhalt: Ernst Heidrich. Von Hans Tietze. — Max Knaufff; Dr. Heinrich Modern f, — Personalien. — Preisausschreiben unter Düsseldorfer
Künstlern; Schinkelwettbewerb des Architektenvereins zu Berlin. — Krieg und Kunst. — Ausstellungen in Leipzig, Dresden, Karlsruhe, Wien. —
Ein wiederaufgefundenes Werk des Oiotto. — Schmückung des neuen Rathauses in Suhl mit einem Monumentalbilde — Literatur. — Anzeige.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig
Literatur
184
Charakter und erhebt sie zu typischen,gesetzmäßigen. Neben
den Ergebnissen an positiven Grundlagen für gewisse kunst-
geschichtliche Synthesen werden aber noch Fragen größeren
Umfangs und von höheren Gesichtspunkten aus berührt.
Die Arbeit zeigt nämlich implicite, wie das Auge mit
einer veränderten Einstellung (wodurch kommt hier nicht
in Frage) nach und nach andere Dinge und Anderes an
den Dingen sieht, und auch im Augenblick darzustellen
vermag, wo diese Einstellung klare und nicht mehr durch
frühere Anschauung beeinflußte Bilder vermittelt.
Die erste Künstlergeneration Masaccio, Donatello,
Brunelleschi gab schon alle Werte, die sich der neuen An-
schauung offenbarten, und das kommende Jahrhundert hatte
mit geringen Ausnahmen nur in der Richtung weiter zu
gehen, auszubauen, zu vervollkommnen, was diese drei
Großen vorweg genommen hatten. Wir sehen, wie aus
den Phantasiebildungen und oft wiederholten Erinnerungs-
bildern des Trecento porträtähnliche Wiedergaben be-
stehender, bekannter, vorhandener Gebäude werden und
endlich wieder Phantasiebildungen, aber auf objektiv mög-
licher Grundlage und durch positiv nachweisbare Anregung
vorhandener Bauwerke.
Ein großes Material an Gemälden und Bildwerken wird
vom Verfasser zu der Untersuchung sorgfältig beigezogen,
und auch von wissenschaftlichem Material ist so viel ver-
arbeitet, daß man überall das angenehme Gefühl hat, auf
sicherer Grundlage zu gehen.
Das Schlußkapitel hätte insofern bestimmter gehalten
werden sollen, als es die »Hauptinteressen«, das »Agens«
der behandelten Epochen betrifft. Mit »Rhythmik der Dar-
stellung, Ausgeglichenheit der einzelnen Bewegungen der
Linie innerhalb des Bildganzen«, »ornamentale Fassung und
Verteilung der Gruppen« sind die spezifischen Eigenschaften
der »klassischen Kunst« nicht bestimmt. Das ergibt sich
schon daraus, daß man diese ebensogut und m. E. viel
besser auf das Trecento und die hier in Betracht kommende
Zeit des Quattrocento beziehen kann. Faßte man dann
die Ziele der klassischen Kunst etwa als Gestaltung des
Raumes, des Volumens (Modellierung), der Bewegung
(Licht), der Nachahmung des Materials (Farbe), des Phy-
siognomischen an Totem und Lebendigem (d. h. Ähn-
lichkeit, Menschen und Gebäudeporträt, Gruppenbild und
Stadtvedute), so ergäbe sich als wesentlichste »Tat des Jahr-
hunderts«, wie der Verfasser will, »die Wandlung der
Malerei von einer Kunst der Fläche zu einer Kunst der
Raumprojektion.« Zucker zieht aber die Trennung zwischen
dekorativ-zeichnerisch und malerisch-naturalistisch nicht so
scharf. Das ersieht man aus einigen eingestreuten Bemer-
kungen und auch daran, daß er die Aufgabe und Ausdrucks-
möglichkeit der Linie ganz allgemein festsetzen zu können
glaubt (Kap. X), während sie doch in den beiden Grund-
anschauungen eine verschiedene ist. Bei einer zeichnerisch-
dekorativen Anschauung ist die Linie, auch die der Architektur,
der Auswahl und Veränderung durch den Künstler unter-
worfen, obgleich sie, wie Zucker bemerkt, schon gefühls-
betont ist. Erst der durchgreifende Naturalismus mit seiner
engeren Beziehung der Darstellung zur Wirklichkeit hat
Gelegenheit, durch den gegebenen »psychischen Inhalt der
Linie« den »Gefühlsinhalt der dargestellten Episode« zu
unterstreichen. Victor Wallerstein.
3Karf
5
'Marl
3O00000000000O00O000OOCXX30O00O00O0O0OO0OCXX)0O000OO0O0000OC
#er(ag Don (f. <3eemanti in leidig
$ejffa(en&er
Mi 31 farbigen Sitöern unb eigenen Herfen &e$ 3flfmeiffer$ Xboma
(Sine föfHidje poefifdje fünfHerifdje ®af>e für 3una uni> Mit, an
i>eren 3uftani>efommen unf> 3(uäfüfyruna ftanei If)omo
Den regffen perfönlidjen Anteil genommen fyat
<f\tr $eftfa(enber ift ein 33ilber6ua), bat ben ütreig btä 3al?re«
wiberfofegelt. Suerft gifct Storno eine launig geftfjrie&ene (Sin*
füfjrung in feine ©ebanfenwelt; im6 bann folgen, naa) ©emä'lben
trefflldj in jarben reproduziert unt> fein montiert, bie Silber ber
5»ötf OTonate, ber planeren unb ©ternfsjmoole, 3Beif/nad)ten,
Dftern, Pfmgften - furj ber ganae Äreiö be« 3af/re«f. 3u jebem
ber reijenben farbigen Silbern f>at fyawi Sfjoma #erfe gebietet
* unb batnit alfo ein Rünftlerbudj einiger SMrt un«f befdjert. *
>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Inhalt: Ernst Heidrich. Von Hans Tietze. — Max Knaufff; Dr. Heinrich Modern f, — Personalien. — Preisausschreiben unter Düsseldorfer
Künstlern; Schinkelwettbewerb des Architektenvereins zu Berlin. — Krieg und Kunst. — Ausstellungen in Leipzig, Dresden, Karlsruhe, Wien. —
Ein wiederaufgefundenes Werk des Oiotto. — Schmückung des neuen Rathauses in Suhl mit einem Monumentalbilde — Literatur. — Anzeige.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann in Leipzig, Hospitalstraße IIa
Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., Leipzig