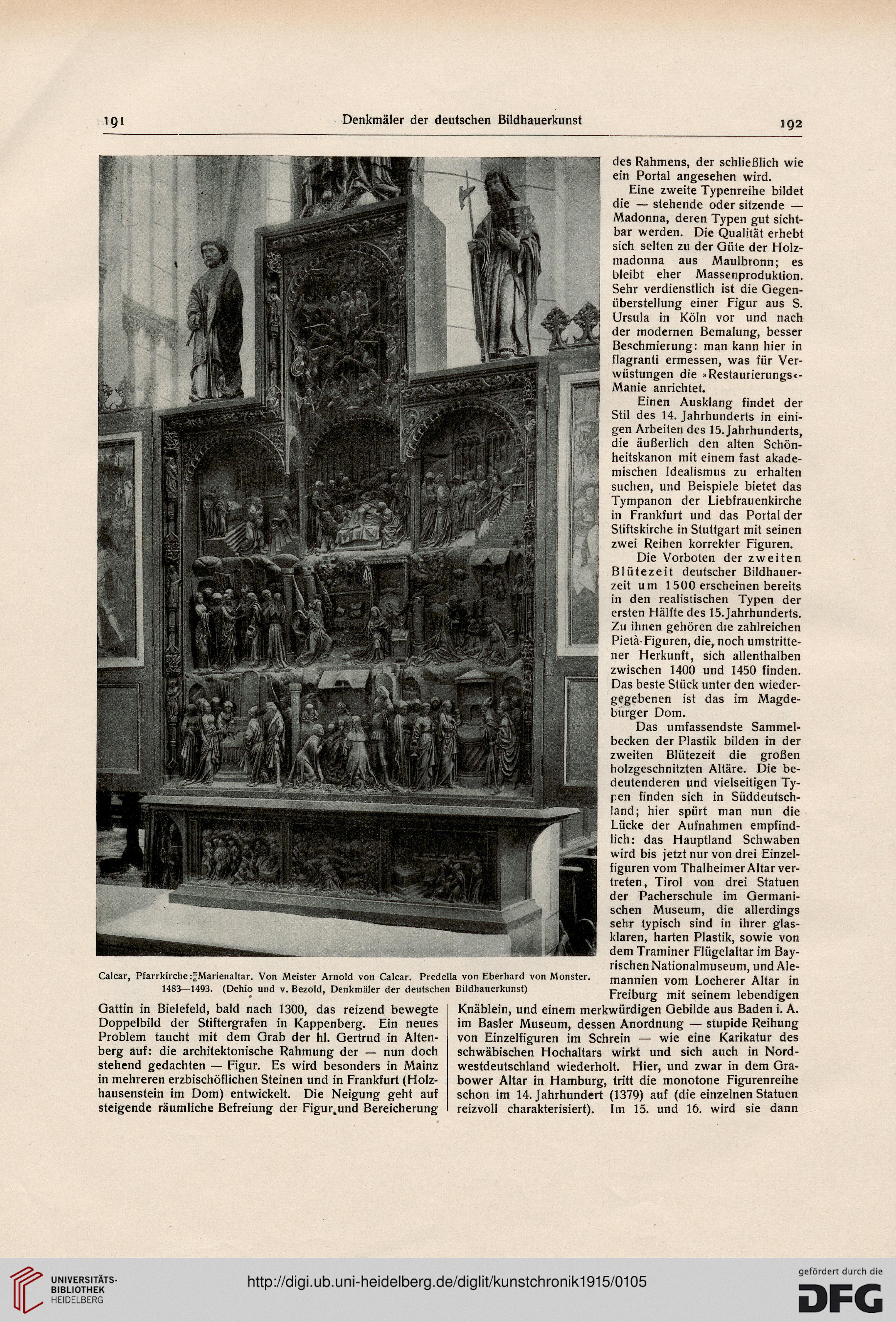l q 1 Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst ig2
Calcar, Pfarrkirche :=Marienaltar. Von Meister Arnold von Calcar. Predella von Eberhard von Monster.
1483—1493. (Dehio und v. Bezold, Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst)
Gattin in Bielefeld, bald nach 1300, das reizend bewegte
Doppelbild der Stiftergrafen in Kappenberg. Ein neues
Problem taucht mit dem Grab der hl. Gertrud in Alten-
berg auf: die architektonische Rahmung der — nun doch
stehend gedachten — Figur. Es wird besonders in Mainz
in mehreren erzbischöflichen Steinen und in Frankfurt (Holz-
hausenstein im Dom) entwickelt. Die Neigung geht auf
steigende räumliche Befreiung der Figur.und Bereicherung
des Rahmens, der schließlich wie
ein Portal angesehen wird.
Eine zweite Typenreihe bildet
die — stehende oder sitzende —
Madonna, deren Typen gut sicht-
bar werden. Die Qualität erhebt
sich selten zu der Güte der Holz-
madonna aus Maulbronn; es
bleibt eher Massenproduktion.
Sehr verdienstlich ist die Gegen-
überstellung einer Figur aus S.
Ursula in Köln vor und nach
der modernen Bemalung, besser
Beschmierung: man kann hier in
flagranti ermessen, was für Ver-
wüstungen die »Restaurierungs«-
Manie anrichtet.
Einen Ausklang findet der
Stil des 14. Jahrhunderts in eini-
gen Arbeiten des 15. Jahrhunderts,
die äußerlich den alten Schön-
heitskanon mit einem fast akade-
mischen Idealismus zu erhalten
suchen, und Beispiele bietet das
Tympanon der Liebfrauenkirche
in Frankfurt und das Portal der
Stiftskirche in Stuttgart mit seinen
zwei Reihen korrekter Figuren.
Die Vorboten der zweiten
Blütezeit deutscher Bildhauer-
zeit um 1 500 erscheinen bereits
in den realistischen Typen der
ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts.
Zu ihnen gehören die zahlreichen
Pietä- Figuren, die, noch umstritte-
ner Herkunft, sich allenthalben
zwischen 1400 und 1450 finden.
Das beste Stück unter den wieder-
gegebenen ist das im Magde-
burger Dom.
Das umfassendste Sammel-
becken der Plastik bilden in der
zweiten Blütezeit die großen
holzgeschnitzten Altäre. Die be-
deutenderen und vielseitigen Ty-
pen finden sich in Süddeutsch-
land; hier spürt man nun die
Lücke der Aufnahmen empfind-
lich: das Hauptland Schwaben
wird bis jetzt nur von drei Einzel-
figuren vom Thalheimer Altar ver-
treten, Tirol von drei Statuen
der Pacherschule im Germani-
schen Museum, die allerdings
sehr typisch sind in ihrer glas-
klaren, harten Plastik, sowie von
dem Traminer Flügelaltar im Bay-
rischen Nationalmuseum, und Ale-
mannien vom Locherer Altar in
Freiburg mit seinem lebendigen
Knäblein, und einem merkwürdigen Gebilde aus Baden i. A.
im Basler Museum, dessen Anordnung — stupide Reihung
von Einzelfiguren im Schrein — wie eine Karikatur des
schwäbischen Hochaltars wirkt und sich auch in Nord-
westdeutschland wiederholt. Hier, und zwar in dem Gra-
bower Altar in Hamburg, tritt die monotone Figurenreihe
schon im 14. Jahrhundert (1379) auf (die einzelnen Statuen
reizvoll charakterisiert). Im 15. und 16. wird sie dann
Calcar, Pfarrkirche :=Marienaltar. Von Meister Arnold von Calcar. Predella von Eberhard von Monster.
1483—1493. (Dehio und v. Bezold, Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst)
Gattin in Bielefeld, bald nach 1300, das reizend bewegte
Doppelbild der Stiftergrafen in Kappenberg. Ein neues
Problem taucht mit dem Grab der hl. Gertrud in Alten-
berg auf: die architektonische Rahmung der — nun doch
stehend gedachten — Figur. Es wird besonders in Mainz
in mehreren erzbischöflichen Steinen und in Frankfurt (Holz-
hausenstein im Dom) entwickelt. Die Neigung geht auf
steigende räumliche Befreiung der Figur.und Bereicherung
des Rahmens, der schließlich wie
ein Portal angesehen wird.
Eine zweite Typenreihe bildet
die — stehende oder sitzende —
Madonna, deren Typen gut sicht-
bar werden. Die Qualität erhebt
sich selten zu der Güte der Holz-
madonna aus Maulbronn; es
bleibt eher Massenproduktion.
Sehr verdienstlich ist die Gegen-
überstellung einer Figur aus S.
Ursula in Köln vor und nach
der modernen Bemalung, besser
Beschmierung: man kann hier in
flagranti ermessen, was für Ver-
wüstungen die »Restaurierungs«-
Manie anrichtet.
Einen Ausklang findet der
Stil des 14. Jahrhunderts in eini-
gen Arbeiten des 15. Jahrhunderts,
die äußerlich den alten Schön-
heitskanon mit einem fast akade-
mischen Idealismus zu erhalten
suchen, und Beispiele bietet das
Tympanon der Liebfrauenkirche
in Frankfurt und das Portal der
Stiftskirche in Stuttgart mit seinen
zwei Reihen korrekter Figuren.
Die Vorboten der zweiten
Blütezeit deutscher Bildhauer-
zeit um 1 500 erscheinen bereits
in den realistischen Typen der
ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts.
Zu ihnen gehören die zahlreichen
Pietä- Figuren, die, noch umstritte-
ner Herkunft, sich allenthalben
zwischen 1400 und 1450 finden.
Das beste Stück unter den wieder-
gegebenen ist das im Magde-
burger Dom.
Das umfassendste Sammel-
becken der Plastik bilden in der
zweiten Blütezeit die großen
holzgeschnitzten Altäre. Die be-
deutenderen und vielseitigen Ty-
pen finden sich in Süddeutsch-
land; hier spürt man nun die
Lücke der Aufnahmen empfind-
lich: das Hauptland Schwaben
wird bis jetzt nur von drei Einzel-
figuren vom Thalheimer Altar ver-
treten, Tirol von drei Statuen
der Pacherschule im Germani-
schen Museum, die allerdings
sehr typisch sind in ihrer glas-
klaren, harten Plastik, sowie von
dem Traminer Flügelaltar im Bay-
rischen Nationalmuseum, und Ale-
mannien vom Locherer Altar in
Freiburg mit seinem lebendigen
Knäblein, und einem merkwürdigen Gebilde aus Baden i. A.
im Basler Museum, dessen Anordnung — stupide Reihung
von Einzelfiguren im Schrein — wie eine Karikatur des
schwäbischen Hochaltars wirkt und sich auch in Nord-
westdeutschland wiederholt. Hier, und zwar in dem Gra-
bower Altar in Hamburg, tritt die monotone Figurenreihe
schon im 14. Jahrhundert (1379) auf (die einzelnen Statuen
reizvoll charakterisiert). Im 15. und 16. wird sie dann