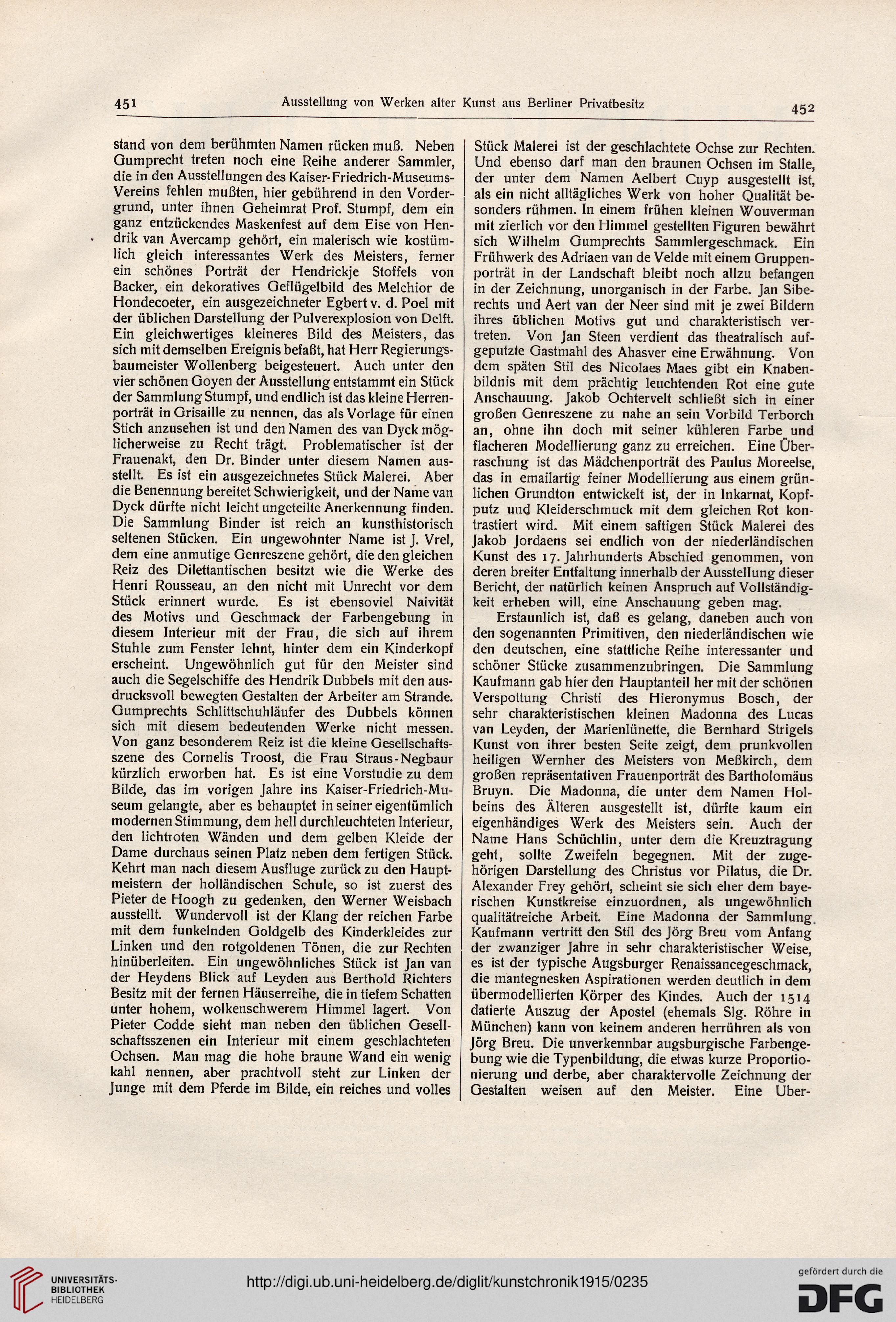451
Ausstellung von Werken alter Kunst aus Berliner Privatbesitz
452
stand von dem berühmten Namen rücken muß. Neben
Gumprecht treten noch eine Reihe anderer Sammler,
die in den Ausstellungen des Kaiser-Friedrich-Museums-
Vereins fehlen mußten, hier gebührend in den Vorder-
grund, unter ihnen Geheimrat Prof. Stumpf, dem ein
ganz entzückendes Maskenfest auf dem Eise von Hen-
drik van Avercamp gehört, ein malerisch wie kostüm-
lich gleich interessantes Werk des Meisters, ferner
ein schönes Porträt der Hendrickje Stoffels von
Backer, ein dekoratives Geflügelbild des Melchior de
Hondecoeter, ein ausgezeichneter Egbert v. d. Poel mit
der üblichen Darstellung der Pulverexplosion von Delft.
Ein gleichwertiges kleineres Bild des Meisters, das
sich mit demselben Ereignis befaßt, hat Herr Regierungs-
baumeister Wollenberg beigesteuert. Auch unter den
vier schönen Goyen der Ausstellung entstammt ein Stück
der Sammlung Stumpf, und endlich ist das kleine Herren-
porträt in Grisaille zu nennen, das als Vorlage für einen
Stich anzusehen ist und den Namen des van Dyck mög-
licherweise zu Recht trägt. Problematischer ist der
Frauenakt, den Dr. Binder unter diesem Namen aus-
stellt. Es ist ein ausgezeichnetes Stück Malerei. Aber
die Benennung bereitet Schwierigkeit, und der Name van
Dyck dürfte nicht leicht ungeteilte Anerkennung finden.
Die Sammlung Binder ist reich an kunsthistorisch
seltenen Stücken. Ein ungewohnter Name ist J. Vrel,
dem eine anmutige Genreszene gehört, die den gleichen
Reiz des Dilettantischen besitzt wie die Werke des
Henri Rousseau, an den nicht mit Unrecht vor dem
Stück erinnert wurde. Es ist ebensoviel Naivität
des Motivs und Geschmack der Farbengebung in
diesem Interieur mit der Frau, die sich auf ihrem
Stuhle zum Fenster lehnt, hinter dem ein Kinderkopf
erscheint. Ungewöhnlich gut für den Meister sind
auch die Segelschiffe des Hendrik Dubbels mit den aus-
drucksvoll bewegten Gestalten der Arbeiter am Strande.
Gumprechts Schlittschuhläufer des Dubbels können
sich mit diesem bedeutenden Werke nicht messen.
Von ganz besonderem Reiz ist die kleine Gesellschafts-
szene des Cornelis Troost, die Frau Straus-Negbaur
kürzlich erworben hat. Es ist eine Vorstudie zu dem
Bilde, das im vorigen Jahre ins Kaiser-Friedrich-Mu-
seum gelangte, aber es behauptet in seiner eigentümlich
modernen Stimmung, dem hell durchleuchteten Interieur,
den lichtroten Wänden und dem gelben Kleide der
Dame durchaus seinen Platz neben dem fertigen Stück.
Kehrt man nach diesem Ausfluge zurück zu den Haupt-
meistern der holländischen Schule, so ist zuerst des
Pieter de Hoogh zu gedenken, den Werner Weisbach
ausstellt. Wundervoll ist der Klang der reichen Farbe
mit dem funkelnden Goldgelb des Kinderkleides zur
Linken und den rotgoldenen Tönen, die zur Rechten
hinüberleiten. Ein ungewöhnliches Stück ist Jan van
der Heydens Blick auf Leyden aus Berthold Richters
Besitz mit der fernen Häuserreihe, die in tiefem Schatten
unter hohem, wolkenschwerem Himmel lagert. Von
Pieter Codde sieht man neben den üblichen Gesell-
schaftsszenen ein Interieur mit einem geschlachteten
Ochsen. Man mag die hohe braune Wand ein wenig
kahl nennen, aber prachtvoll steht zur Linken der
Junge mit dem Pferde im Bilde, ein reiches und volles
Stück Malerei ist der geschlachtete Ochse zur Rechten.
Und ebenso darf man den braunen Ochsen im Stalle,
der unter dem Namen Aelbert Cuyp ausgestellt ist,
als ein nicht alltägliches Werk von hoher Qualität be-
sonders rühmen. In einem frühen kleinen Wouverman
mit zierlich vor den Himmel gestellten Figuren bewährt
sich Wilhelm Gumprechts Sammlergeschmack. Ein
Frühwerk des Adriaen van de Velde mit einem Gruppen-
porträt in der Landschaft bleibt noch allzu befangen
in der Zeichnung, unorganisch in der Farbe. Jan Sibe-
rechts und Aert van der Neer sind mit je zwei Bildern
ihres üblichen Motivs gut und charakteristisch ver-
treten. Von Jan Steen verdient das theatralisch auf-
geputzte Gastmahl des Ahasver eine Erwähnung. Von
dem späten Stil des Nicolaes Maes gibt ein Knaben-
bildnis mit dem prächtig leuchtenden Rot eine gute
Anschauung. Jakob Ochtervelt schließt sich in einer
großen Genreszene zu nahe an sein Vorbild Terborch
an, ohne ihn doch mit seiner kühleren Farbe und
flacheren Modellierung ganz zu erreichen. Eine Über-
raschung ist das Mädchenporträt des Paulus Moreelse,
das in emailartig feiner Modellierung aus einem grün-
lichen Grundton entwickelt ist, der in Inkarnat, Kopf-
putz und Kleiderschmuck mit dem gleichen Rot kon-
trastiert wird. Mit einem saftigen Stück Malerei des
Jakob Jordaens sei endlich von der niederländischen
Kunst des 17. Jahrhunderts Abschied genommen, von
deren breiter Entfaltung innerhalb der Ausstellung dieser
Bericht, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben will, eine Anschauung geben mag.
Erstaunlich ist, daß es gelang, daneben auch von
den sogenannten Primitiven, den niederländischen wie
den deutschen, eine stattliche Reihe interessanter und
schöner Stücke zusammenzubringen. Die Sammlung
Kaufmann gab hier den Hauptanteil her mit der schönen
Verspottung Christi des Hieronymus Bosch, der
sehr charakteristischen kleinen Madonna des Lucas
van Leyden, der Marienlünette, die Bernhard Strigels
Kunst von ihrer besten Seite zeigt, dem prunkvollen
heiligen Wernher des Meisters von Meßkirch, dem
großen repräsentativen Frauenporträt des Bartholomäus
Bruyn. Die Madonna, die unter dem Namen Hol-
beins des Älteren ausgestellt ist, dürfte kaum ein
eigenhändiges Werk des Meisters sein. Auch der
Name Hans Schüchlin, unter dem die Kreuztragung
geht, sollte Zweifeln begegnen. Mit der zuge-
hörigen Darstellung des Christus vor Pilatus, die Dr.
Alexander Frey gehört, scheint sie sich eher dem baye-
rischen Kunstkreise einzuordnen, als ungewöhnlich
qualitätreiche Arbeit. Eine Madonna der Sammlung.
Kaufmann vertritt den Stil des Jörg Breu vom Anfang
der zwanziger Jahre in sehr charakteristischer Weise,
es ist der typische Augsburger Renaissancegeschmack,
die mantegnesken Aspirationen werden deutlich in dem
übermodellierten Körper des Kindes. Auch der 1514
datierte Auszug der Apostel (ehemals Slg. Röhre in
München) kann von keinem anderen herrühren als von
Jörg Breu. Die unverkennbar augsburgische Farbenge-
bung wie die Typenbildung, die etwas kurze Proportio-
nierung und derbe, aber charaktervolle Zeichnung der
Gestalten weisen auf den Meister. Eine Uber-
Ausstellung von Werken alter Kunst aus Berliner Privatbesitz
452
stand von dem berühmten Namen rücken muß. Neben
Gumprecht treten noch eine Reihe anderer Sammler,
die in den Ausstellungen des Kaiser-Friedrich-Museums-
Vereins fehlen mußten, hier gebührend in den Vorder-
grund, unter ihnen Geheimrat Prof. Stumpf, dem ein
ganz entzückendes Maskenfest auf dem Eise von Hen-
drik van Avercamp gehört, ein malerisch wie kostüm-
lich gleich interessantes Werk des Meisters, ferner
ein schönes Porträt der Hendrickje Stoffels von
Backer, ein dekoratives Geflügelbild des Melchior de
Hondecoeter, ein ausgezeichneter Egbert v. d. Poel mit
der üblichen Darstellung der Pulverexplosion von Delft.
Ein gleichwertiges kleineres Bild des Meisters, das
sich mit demselben Ereignis befaßt, hat Herr Regierungs-
baumeister Wollenberg beigesteuert. Auch unter den
vier schönen Goyen der Ausstellung entstammt ein Stück
der Sammlung Stumpf, und endlich ist das kleine Herren-
porträt in Grisaille zu nennen, das als Vorlage für einen
Stich anzusehen ist und den Namen des van Dyck mög-
licherweise zu Recht trägt. Problematischer ist der
Frauenakt, den Dr. Binder unter diesem Namen aus-
stellt. Es ist ein ausgezeichnetes Stück Malerei. Aber
die Benennung bereitet Schwierigkeit, und der Name van
Dyck dürfte nicht leicht ungeteilte Anerkennung finden.
Die Sammlung Binder ist reich an kunsthistorisch
seltenen Stücken. Ein ungewohnter Name ist J. Vrel,
dem eine anmutige Genreszene gehört, die den gleichen
Reiz des Dilettantischen besitzt wie die Werke des
Henri Rousseau, an den nicht mit Unrecht vor dem
Stück erinnert wurde. Es ist ebensoviel Naivität
des Motivs und Geschmack der Farbengebung in
diesem Interieur mit der Frau, die sich auf ihrem
Stuhle zum Fenster lehnt, hinter dem ein Kinderkopf
erscheint. Ungewöhnlich gut für den Meister sind
auch die Segelschiffe des Hendrik Dubbels mit den aus-
drucksvoll bewegten Gestalten der Arbeiter am Strande.
Gumprechts Schlittschuhläufer des Dubbels können
sich mit diesem bedeutenden Werke nicht messen.
Von ganz besonderem Reiz ist die kleine Gesellschafts-
szene des Cornelis Troost, die Frau Straus-Negbaur
kürzlich erworben hat. Es ist eine Vorstudie zu dem
Bilde, das im vorigen Jahre ins Kaiser-Friedrich-Mu-
seum gelangte, aber es behauptet in seiner eigentümlich
modernen Stimmung, dem hell durchleuchteten Interieur,
den lichtroten Wänden und dem gelben Kleide der
Dame durchaus seinen Platz neben dem fertigen Stück.
Kehrt man nach diesem Ausfluge zurück zu den Haupt-
meistern der holländischen Schule, so ist zuerst des
Pieter de Hoogh zu gedenken, den Werner Weisbach
ausstellt. Wundervoll ist der Klang der reichen Farbe
mit dem funkelnden Goldgelb des Kinderkleides zur
Linken und den rotgoldenen Tönen, die zur Rechten
hinüberleiten. Ein ungewöhnliches Stück ist Jan van
der Heydens Blick auf Leyden aus Berthold Richters
Besitz mit der fernen Häuserreihe, die in tiefem Schatten
unter hohem, wolkenschwerem Himmel lagert. Von
Pieter Codde sieht man neben den üblichen Gesell-
schaftsszenen ein Interieur mit einem geschlachteten
Ochsen. Man mag die hohe braune Wand ein wenig
kahl nennen, aber prachtvoll steht zur Linken der
Junge mit dem Pferde im Bilde, ein reiches und volles
Stück Malerei ist der geschlachtete Ochse zur Rechten.
Und ebenso darf man den braunen Ochsen im Stalle,
der unter dem Namen Aelbert Cuyp ausgestellt ist,
als ein nicht alltägliches Werk von hoher Qualität be-
sonders rühmen. In einem frühen kleinen Wouverman
mit zierlich vor den Himmel gestellten Figuren bewährt
sich Wilhelm Gumprechts Sammlergeschmack. Ein
Frühwerk des Adriaen van de Velde mit einem Gruppen-
porträt in der Landschaft bleibt noch allzu befangen
in der Zeichnung, unorganisch in der Farbe. Jan Sibe-
rechts und Aert van der Neer sind mit je zwei Bildern
ihres üblichen Motivs gut und charakteristisch ver-
treten. Von Jan Steen verdient das theatralisch auf-
geputzte Gastmahl des Ahasver eine Erwähnung. Von
dem späten Stil des Nicolaes Maes gibt ein Knaben-
bildnis mit dem prächtig leuchtenden Rot eine gute
Anschauung. Jakob Ochtervelt schließt sich in einer
großen Genreszene zu nahe an sein Vorbild Terborch
an, ohne ihn doch mit seiner kühleren Farbe und
flacheren Modellierung ganz zu erreichen. Eine Über-
raschung ist das Mädchenporträt des Paulus Moreelse,
das in emailartig feiner Modellierung aus einem grün-
lichen Grundton entwickelt ist, der in Inkarnat, Kopf-
putz und Kleiderschmuck mit dem gleichen Rot kon-
trastiert wird. Mit einem saftigen Stück Malerei des
Jakob Jordaens sei endlich von der niederländischen
Kunst des 17. Jahrhunderts Abschied genommen, von
deren breiter Entfaltung innerhalb der Ausstellung dieser
Bericht, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben will, eine Anschauung geben mag.
Erstaunlich ist, daß es gelang, daneben auch von
den sogenannten Primitiven, den niederländischen wie
den deutschen, eine stattliche Reihe interessanter und
schöner Stücke zusammenzubringen. Die Sammlung
Kaufmann gab hier den Hauptanteil her mit der schönen
Verspottung Christi des Hieronymus Bosch, der
sehr charakteristischen kleinen Madonna des Lucas
van Leyden, der Marienlünette, die Bernhard Strigels
Kunst von ihrer besten Seite zeigt, dem prunkvollen
heiligen Wernher des Meisters von Meßkirch, dem
großen repräsentativen Frauenporträt des Bartholomäus
Bruyn. Die Madonna, die unter dem Namen Hol-
beins des Älteren ausgestellt ist, dürfte kaum ein
eigenhändiges Werk des Meisters sein. Auch der
Name Hans Schüchlin, unter dem die Kreuztragung
geht, sollte Zweifeln begegnen. Mit der zuge-
hörigen Darstellung des Christus vor Pilatus, die Dr.
Alexander Frey gehört, scheint sie sich eher dem baye-
rischen Kunstkreise einzuordnen, als ungewöhnlich
qualitätreiche Arbeit. Eine Madonna der Sammlung.
Kaufmann vertritt den Stil des Jörg Breu vom Anfang
der zwanziger Jahre in sehr charakteristischer Weise,
es ist der typische Augsburger Renaissancegeschmack,
die mantegnesken Aspirationen werden deutlich in dem
übermodellierten Körper des Kindes. Auch der 1514
datierte Auszug der Apostel (ehemals Slg. Röhre in
München) kann von keinem anderen herrühren als von
Jörg Breu. Die unverkennbar augsburgische Farbenge-
bung wie die Typenbildung, die etwas kurze Proportio-
nierung und derbe, aber charaktervolle Zeichnung der
Gestalten weisen auf den Meister. Eine Uber-