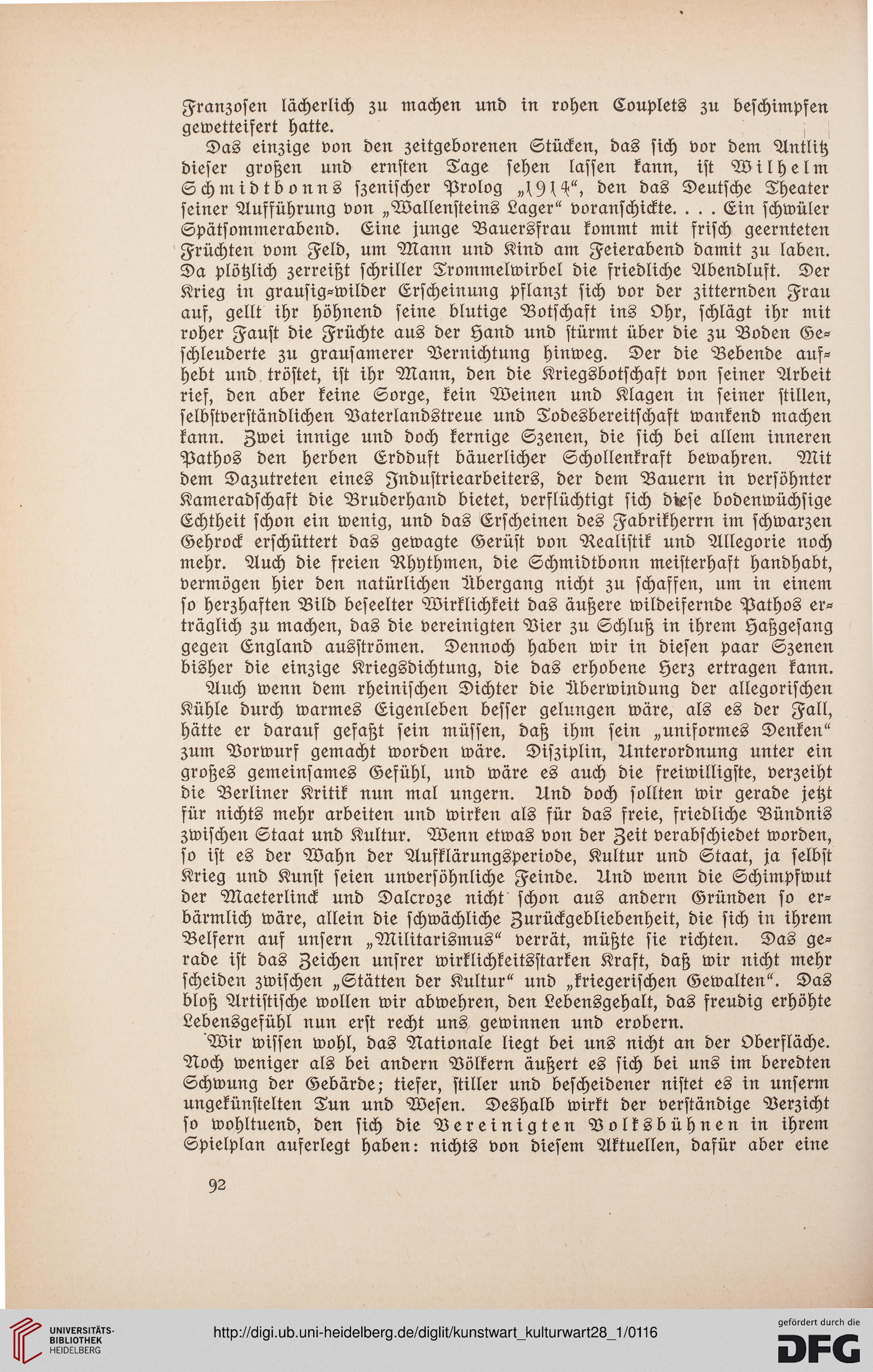*
Franzosen lächerlich zu rnachen und in rohen Couplets zu beschimpfen
gewetteifert hatte. j ;
Das einzige von den zeitgeborenen Stücken, das sich vor dem Antlitz
dieser großen und ernsten Tage sehen lassen kann, ist Wilhelm
Schmidtbonns szenischer Prolog den das Deutsche Theater
seiner Aufführung von „Wallensteins Lager" voranschickte. . . . Lin schwüler
Spätsommerabend. Eine junge Bauersfrau kommt mit frisch geernteten
Früchten vom Feld, um Mann und Kind am Feierabend damit zu laben.
Da plötzlich zerreißt schriller Lrommelwirbel die friedliche Abendluft. Der
Krieg in grausig-wilder Lrscheinung pflanzt sich vor der zitternden Frau
auf, gellt ihr höhnend seine blutige Botschaft ins Ohr, schlägt ihr mit
roher Faust die Früchte aus der Hand und stürmt über die zu Boden Ge-
schleuderte zu grausamerer Vernichtung hinweg. Der die Bebende auf-
hebt und tröstet, ist ihr Mann, den die Kriegsbotschaft von seiner Arbeit
rief, den aber keine Sorge, kein Weinen und Klagen in seiner stillen,
selbstverständlichen Vaterlandstreue und Todesbereitschaft wankend machen
kann. Zwei innige und doch kernige Szenen, die sich bei allem inneren
Pathos den herben Lrdduft bäuerlicher Schollenkraft bewahren. Mit
dem Dazutreten eines Industriearbeiters, der dem Bauern in versöhnter
Kameradschaft die Bruderhand bietet, verflüchtigt sich diese bodenwüchsige
Lchtheit schon ein wenig, und das Lrscheinen des Fabrikherrn im schwarzen
Gehrock erschüttert das gewagte Gerüst von Realistik und Allegorie noch
mehr. Auch die freien Rhythmen, die Schmidtbonn meisterhaft handhabt,
vermögen hier den natürlichen Äbergang nicht zu schaffen, um in einem
so herzhaften Bild beseelter Wirklichkeit das äußere wildeifernde Pathos er-
träglich zu machen, das die vereinigten Vier zu Schluß in ihrem Haßgesang
gegen Lngland ausströmen. Dennoch haben wir in diesen paar Szenen
bisher die einzige Kriegsdichtung, die das erhobene tzerz ertragen kann.
Auch wenn dem rheinischen Dichter die Aberwindung der allegorischen
Kühle durch warmes Ligenleben besser gelungen wäre, als es der Fall,
hätte er darauf gefaßt sein müssen, daß ihm sein „uniformes Denken"
zum Vorwurf gemacht worden wäre. Disziplin, Unterordnung unter ein
großes gemeinsames Gefühl, und wäre es auch die freiwilligste, verzeiht
die Berliner Kritik nun mal ungern. Und doch sollten wir gerade jetzt
für nichts mehr arbeiten und wirken als für das freie, friedliche Bündnis
zwischen Staat und Kultur. Wenn etwas von der Zeit verabschiedet worden,
so ist es der Wahn der Aufklärungsperiode, Kultur und Staat, ja selbst
Krieg und Kunst seien unversöhnliche Feinde. Und wenn die Schimpfwut
der Maeterlinck und Dalcroze nicht schon aus andern Gründen so er-
bärmlich wäre, allein die schwächliche Zurückgebliebenheit, die sich in ihrem
Belfern auf unsern „Militarismus" verrät, müßte sie richten. Das ge-
rade ist das Zeichen unsrer wirklichkeitsstarken Kraft, daß wir nicht mehr
scheiden zwischen „Stätten der Kultur" und „kriegerischen Gewalten". Das
bloß Artistische wollen wir abwehren, den Lebensgehalt, das freudig erhöhte
Lebensgefühl nun erst recht uns gewinnen und erobern.
Wir wissen wohl, das Nationale liegt bei uns nicht an der Oberfläche.
Noch weniger als bei andern Völkern äußert es sich bei uns im beredten
Schwung der Gebärde; tiefer, stiller und bescheidener nistet es in unserm
ungekünstelten Tun und Wesen. Deshalb wirkt der verständige Verzicht
so wohltuend, den sich die Vereinigten Volksbühnen in ihrem
Spielplan auferlegt haben: nichts von diesem Aktuellen, dafür aber eine
92
Franzosen lächerlich zu rnachen und in rohen Couplets zu beschimpfen
gewetteifert hatte. j ;
Das einzige von den zeitgeborenen Stücken, das sich vor dem Antlitz
dieser großen und ernsten Tage sehen lassen kann, ist Wilhelm
Schmidtbonns szenischer Prolog den das Deutsche Theater
seiner Aufführung von „Wallensteins Lager" voranschickte. . . . Lin schwüler
Spätsommerabend. Eine junge Bauersfrau kommt mit frisch geernteten
Früchten vom Feld, um Mann und Kind am Feierabend damit zu laben.
Da plötzlich zerreißt schriller Lrommelwirbel die friedliche Abendluft. Der
Krieg in grausig-wilder Lrscheinung pflanzt sich vor der zitternden Frau
auf, gellt ihr höhnend seine blutige Botschaft ins Ohr, schlägt ihr mit
roher Faust die Früchte aus der Hand und stürmt über die zu Boden Ge-
schleuderte zu grausamerer Vernichtung hinweg. Der die Bebende auf-
hebt und tröstet, ist ihr Mann, den die Kriegsbotschaft von seiner Arbeit
rief, den aber keine Sorge, kein Weinen und Klagen in seiner stillen,
selbstverständlichen Vaterlandstreue und Todesbereitschaft wankend machen
kann. Zwei innige und doch kernige Szenen, die sich bei allem inneren
Pathos den herben Lrdduft bäuerlicher Schollenkraft bewahren. Mit
dem Dazutreten eines Industriearbeiters, der dem Bauern in versöhnter
Kameradschaft die Bruderhand bietet, verflüchtigt sich diese bodenwüchsige
Lchtheit schon ein wenig, und das Lrscheinen des Fabrikherrn im schwarzen
Gehrock erschüttert das gewagte Gerüst von Realistik und Allegorie noch
mehr. Auch die freien Rhythmen, die Schmidtbonn meisterhaft handhabt,
vermögen hier den natürlichen Äbergang nicht zu schaffen, um in einem
so herzhaften Bild beseelter Wirklichkeit das äußere wildeifernde Pathos er-
träglich zu machen, das die vereinigten Vier zu Schluß in ihrem Haßgesang
gegen Lngland ausströmen. Dennoch haben wir in diesen paar Szenen
bisher die einzige Kriegsdichtung, die das erhobene tzerz ertragen kann.
Auch wenn dem rheinischen Dichter die Aberwindung der allegorischen
Kühle durch warmes Ligenleben besser gelungen wäre, als es der Fall,
hätte er darauf gefaßt sein müssen, daß ihm sein „uniformes Denken"
zum Vorwurf gemacht worden wäre. Disziplin, Unterordnung unter ein
großes gemeinsames Gefühl, und wäre es auch die freiwilligste, verzeiht
die Berliner Kritik nun mal ungern. Und doch sollten wir gerade jetzt
für nichts mehr arbeiten und wirken als für das freie, friedliche Bündnis
zwischen Staat und Kultur. Wenn etwas von der Zeit verabschiedet worden,
so ist es der Wahn der Aufklärungsperiode, Kultur und Staat, ja selbst
Krieg und Kunst seien unversöhnliche Feinde. Und wenn die Schimpfwut
der Maeterlinck und Dalcroze nicht schon aus andern Gründen so er-
bärmlich wäre, allein die schwächliche Zurückgebliebenheit, die sich in ihrem
Belfern auf unsern „Militarismus" verrät, müßte sie richten. Das ge-
rade ist das Zeichen unsrer wirklichkeitsstarken Kraft, daß wir nicht mehr
scheiden zwischen „Stätten der Kultur" und „kriegerischen Gewalten". Das
bloß Artistische wollen wir abwehren, den Lebensgehalt, das freudig erhöhte
Lebensgefühl nun erst recht uns gewinnen und erobern.
Wir wissen wohl, das Nationale liegt bei uns nicht an der Oberfläche.
Noch weniger als bei andern Völkern äußert es sich bei uns im beredten
Schwung der Gebärde; tiefer, stiller und bescheidener nistet es in unserm
ungekünstelten Tun und Wesen. Deshalb wirkt der verständige Verzicht
so wohltuend, den sich die Vereinigten Volksbühnen in ihrem
Spielplan auferlegt haben: nichts von diesem Aktuellen, dafür aber eine
92