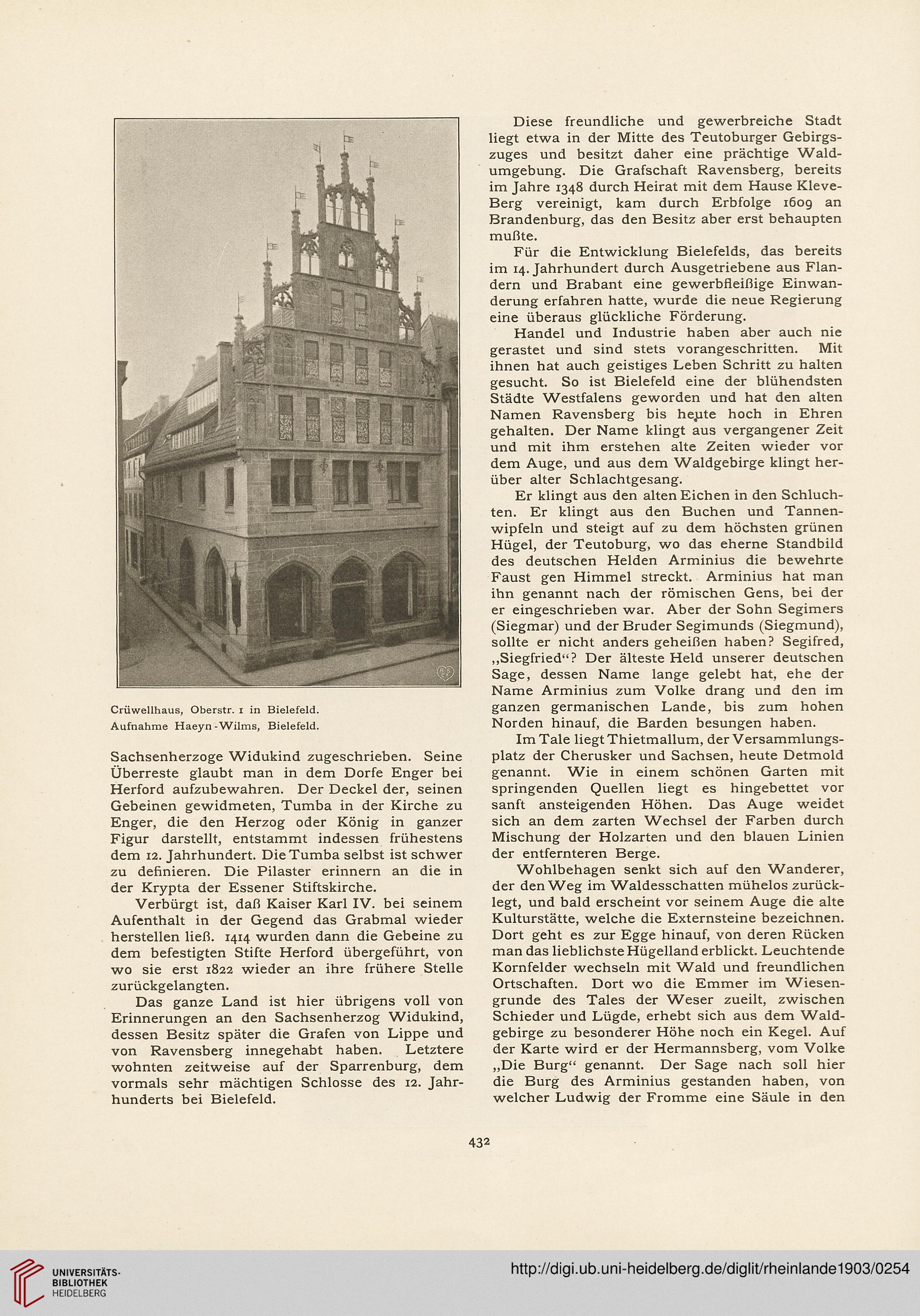Crüwellhaus, Oberstr. i in Bielefeld.
Ausnahme Haeyn-Wilms, Bielefeld.
Sachsenherzoge Widukind zugeschrieben. Seine
Überreste glaubt man in dem Dorfe Enger bei
Herford aufzubewahren. Der Deckel der, seinen
Gebeinen gewidmeten, Tumba in der Kirche zu
Enger, die den Herzog oder König in ganzer
Figur darstellt, entstammt indessen frühestens
dem 12. Jahrhundert. Die Tumba selbst ist schwer
zu definieren. Die Pilaster erinnern an die in
der Krypta der Essener Stiftskirche.
Verbürgt ist, daß Kaiser Karl IV. bei seinem
Aufenthalt in der Gegend das Grabmal wieder
herstellen ließ. 1414 wurden dann die Gebeine zu
dem befestigten Stiste Herford übergeführt, von
wo sie erst 1822 wieder an ihre frühere Stelle
zurückgelangten.
Das ganze Land ist hier übrigens voll von
Erinnerungen an den Sachsenherzog Widukind,
dessen Besitz später die Grafen von Lippe und
von Ravensberg innegehabt haben. Letztere
wohnten zeitweise auf der Sparrenburg, dem
vormals sehr mächtigen Schlosse des 12. Jahr-
hunderts bei Bielefeld.
Diese freundliche und gewerbreiche Stadt
liegt etwa in der Mitte des Teutoburger Gebirgs-
zuges und besitzt daher eine prächtige Wald-
umgebung. Die Grafschaft Ravensberg, bereits
im Jahre 1348 durch Heirat mit dem Hause Kleve-
Berg vereinigt, kam durch Erbfolge 160g an
Brandenburg, das den Besitz aber erst behaupten
mußte.
Für die Entwicklung Bielefelds, das bereits
im 14. Jahrhundert durch Ausgetriebene aus Flan-
dern und Brabant eine gewerbsseißige Einwan-
derung ersahren hatte, wurde die neue Regierung
eine überaus glückliche Förderung.
Handel und Industrie haben aber auch nie
gerastet und sind stets vorangeschritten. Mit
ihnen hat auch geistiges Leben Schritt zu halten
gesucht. So ist Bielefeld eine der blühendsten
Städte Westfalens geworden und hat den alten
Namen Ravensberg bis hepte hoch in Ehren
gehalten. Der Name klingt aus vergangener Zeit
und mit ihm erstehen alte Zeiten wieder vor
dem Auge, und aus dem Waldgebirge klingt her-
über alter Schlachtgesang.
Er klingt aus den alten Eichen in den Schluch-
ten. Er klingt aus den Buchen und Tannen-
wipfeln und steigt auf zu dem höchsten grünen
Hügel, der Teutoburg, wo das eherne Standbild
des deutschen Helden Arminius die bewehrte
Faust gen Himmel streckt. Arminius hat man
ihn genannt nach der römischen Gens, bei der
er eingeschrieben war. Aber der Sohn Segimers
(Siegmar) und der Bruder Segimunds (Siegmund),
sollte er nicht anders geheißen haben? Segifred,
„Siegsried“? Der älteste Held unserer deutschen
Sage, dessen Name lange gelebt hat, ehe der
Name Arminius zum Volke drang und den im
ganzen germanischen Lande, bis zum hohen
Norden hinauf, die Barden besungen haben.
ImTale liegt Thietmallum, der Versammlungs-
platz der Cherusker und Sachsen, heute Detmold
genannt. Wie in einem schönen Garten mit
springenden Quellen liegt es hingebettet vor
sanft ansteigenden Höhen. Das Auge weidet
sich an dem zarten Wechsel der Farben durch
Mischung der Holzarten und den blauen Linien
der entfernteren Berge.
Wohlbehagen senkt sich auf den Wanderer,
der den Weg im Waldesschatten mühelos zurück-
legt, und bald erscheint vor seinem Auge die alte
Kulturstätte, welche die Externsteine bezeichnen.
Dort geht es zur Egge hinauf, von deren Rücken
man das lieblichste Hügelland erblickt. Leuchtende
Kornfelder wechseln mit Wald und freundlichen
Ortschasten. Dort wo die Emmer im Wiesen-
grunde des Tales der Weser zueilt, zwischen
Schieder und Lügde, erhebt sich aus dem Wald-
gebirge zu besonderer Höhe noch ein Kegel. Auf
der Karte wird er der Hermannsberg, vom Volke
„Die Burg“ genannt. Der Sage nach soll hier
die Burg des Arminius gestanden haben, von
welcher Ludwig der Fromme eine Säule in den
432