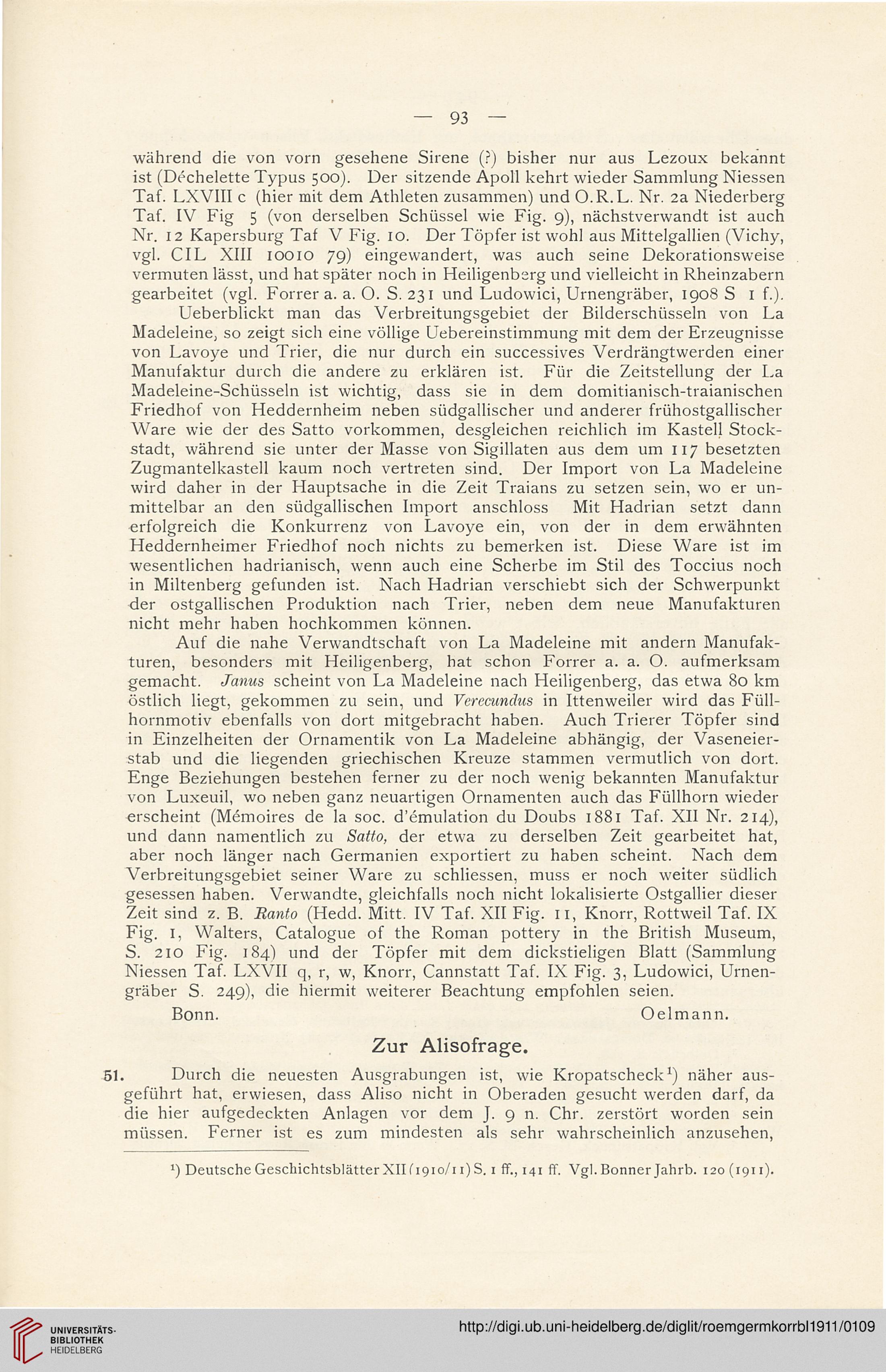93
während die von vorn gesehene Sirene (?) bisher nur aus Lezoux bekannt
ist (Dechelette Typus 500). Der sitzende Äpoll kehrt wieder Sammlung Niessen
Taf. LXVIII c (hier mit dem Athleten zusammen) und O.R. L. Nr. 2a Niederberg
Taf. IV Fig 5 (von derselben Schüssel wie Fig. 9), nächstverwandt ist auch
Nr. 12 Kapersburg Taf V Fig. 10. Der Töpfer ist wohl aus Mittelgallien (Vichy,
vgl. CIL XIII 10010 79) eingewandert, was auch seine Dekorationsweise
vermuten lässt, und hat später noch in Heiligenberg und vielleicht in Rheinzabern
gearbeitet (vgl. Forrera. a. O. S. 231 und Ludowici, Urnengräber, 1908 S I f.).
Ueberblickt man das Verbreitungsgebiet der Bilderschüsseln von La
Madeleine, so zeigt sich eine völlige Uebereinstimmung mit dem der Erzeugnisse
von Lavoye und Trier, die nur durch ein successives Verdrängtwerden einer
Manufaktur durch die andere zu erklären ist. Für die Zeitstellung der La
Madeleine-Schüsseln ist wichtig, dass sie in dem domitianisch-traianischen
Friedhof von Heddernheim neben südgallischer und anderer frühostgallischer
Ware wie der des Satto vorkommen, desgleichen reichlich im Kastell Stock-
stadt, während sie unter der Masse von Sigillaten aus dem um 117 besetzten
Zugmantelkastell kaum noch vertreten sind. Der Import von La Madeleine
wird daher in der Hauptsache in die Zeit Traians zu setzen sein, wo er un-
mittelbar an den südgallischen Import anschloss Mit Hadrian setzt dann
erfolgreich die Konkurrenz von Lavoye ein, von der in dem erwähnten
Heddernheimer Friedhof noch nichts zu bemerken ist. Diese Ware ist im
wesentlichen hadrianisch, wenn auch eine Scherbe im Stil des Toccius noch
in Miltenberg gefunden ist. Nach Hadrian verschiebt sich der Schwerpunkt
der ostgallischen Produktion nach Trier, neben dem neue Manufakturen
nicht mehr haben hochkommen können.
Auf die nahe Verwandtschaft von La Madeleine mit andern Manufak-
turen, besonders mit Heiligenberg, hat schon Forrer a. a. O. aufmerksam
gemacht. Janus scheint von La Madeleine nach Heiligenberg, das etwa 80 km
östlich liegt, gekommen zu sein, und Verecunclus in Ittenweiler wird das Füll-
hornmotiv ebenfalls von dort mitgebracht haben. Auch Trierer Töpfer sind
in Einzelheiten der Ornamentik von La Madeleine abhängig, der Vaseneier-
stab und die liegenden griechischen Kreuze stammen vermutlich von dort.
Enge Beziehungen bestehen ferner zu der noch wenig bekannten Manufaktur
von Luxeuil, wo neben ganz neuartigen Ornamenten auch das Füllhorn wieder
erscheint (Memoires de la soc. d’emulation du Doubs 1881 Taf. XII Nr. 214),
und dann namentlich zu Satto, der etwa zu derselben Zeit gearbeitet hat,
aber noch länger nach Germanien exportiert zu haben scheint. Nach dem
Verbreitungsgebiet seiner Ware zu schliessen, muss er noch weiter südlich
gesessen haben. Verwandte, gleichfalls noch nicht lokalisierte Ostgallier dieser
Zeit sind z. B. Ranto (Hedd. Mitt. IV Taf. XII Fig. II, Knorr, Rottweil Taf. IX
Fig. 1, Walters, Catalogue of the Roman pottery in the British Museum,
S. 210 Fig. 184) und der Töpfer mit dem dickstieligen Blatt (Sammlung
Niessen Taf. LXVII q, r, w, Knorr, Cannstatt Taf. IX Fig. 3, Ludowici, Urnen-
gräber S. 249), die hiermit weiterer Beachtung empfohlen seien.
Bonn. Oelmann.
Zur Alisofrage.
51. Durch die neuesten Ausgrabungen ist, wie Kropatscheck 1) näher aus-
geführt hat, erwiesen, dass Aliso nicht in Oberaden gesucht werden darf, da
die hier aufgedeckten Anlagen vor dem J. 9 n. Chr. zerstört worden sein
müssen. Ferner ist es zum mindesten als sehr wahrscheinlich anzusehen,
DeutscheGeschichtsblätterXIII1910/ii)S. 1 ff., 141 ff. Vgl.Bonner Jahrb. 120 (1911).
während die von vorn gesehene Sirene (?) bisher nur aus Lezoux bekannt
ist (Dechelette Typus 500). Der sitzende Äpoll kehrt wieder Sammlung Niessen
Taf. LXVIII c (hier mit dem Athleten zusammen) und O.R. L. Nr. 2a Niederberg
Taf. IV Fig 5 (von derselben Schüssel wie Fig. 9), nächstverwandt ist auch
Nr. 12 Kapersburg Taf V Fig. 10. Der Töpfer ist wohl aus Mittelgallien (Vichy,
vgl. CIL XIII 10010 79) eingewandert, was auch seine Dekorationsweise
vermuten lässt, und hat später noch in Heiligenberg und vielleicht in Rheinzabern
gearbeitet (vgl. Forrera. a. O. S. 231 und Ludowici, Urnengräber, 1908 S I f.).
Ueberblickt man das Verbreitungsgebiet der Bilderschüsseln von La
Madeleine, so zeigt sich eine völlige Uebereinstimmung mit dem der Erzeugnisse
von Lavoye und Trier, die nur durch ein successives Verdrängtwerden einer
Manufaktur durch die andere zu erklären ist. Für die Zeitstellung der La
Madeleine-Schüsseln ist wichtig, dass sie in dem domitianisch-traianischen
Friedhof von Heddernheim neben südgallischer und anderer frühostgallischer
Ware wie der des Satto vorkommen, desgleichen reichlich im Kastell Stock-
stadt, während sie unter der Masse von Sigillaten aus dem um 117 besetzten
Zugmantelkastell kaum noch vertreten sind. Der Import von La Madeleine
wird daher in der Hauptsache in die Zeit Traians zu setzen sein, wo er un-
mittelbar an den südgallischen Import anschloss Mit Hadrian setzt dann
erfolgreich die Konkurrenz von Lavoye ein, von der in dem erwähnten
Heddernheimer Friedhof noch nichts zu bemerken ist. Diese Ware ist im
wesentlichen hadrianisch, wenn auch eine Scherbe im Stil des Toccius noch
in Miltenberg gefunden ist. Nach Hadrian verschiebt sich der Schwerpunkt
der ostgallischen Produktion nach Trier, neben dem neue Manufakturen
nicht mehr haben hochkommen können.
Auf die nahe Verwandtschaft von La Madeleine mit andern Manufak-
turen, besonders mit Heiligenberg, hat schon Forrer a. a. O. aufmerksam
gemacht. Janus scheint von La Madeleine nach Heiligenberg, das etwa 80 km
östlich liegt, gekommen zu sein, und Verecunclus in Ittenweiler wird das Füll-
hornmotiv ebenfalls von dort mitgebracht haben. Auch Trierer Töpfer sind
in Einzelheiten der Ornamentik von La Madeleine abhängig, der Vaseneier-
stab und die liegenden griechischen Kreuze stammen vermutlich von dort.
Enge Beziehungen bestehen ferner zu der noch wenig bekannten Manufaktur
von Luxeuil, wo neben ganz neuartigen Ornamenten auch das Füllhorn wieder
erscheint (Memoires de la soc. d’emulation du Doubs 1881 Taf. XII Nr. 214),
und dann namentlich zu Satto, der etwa zu derselben Zeit gearbeitet hat,
aber noch länger nach Germanien exportiert zu haben scheint. Nach dem
Verbreitungsgebiet seiner Ware zu schliessen, muss er noch weiter südlich
gesessen haben. Verwandte, gleichfalls noch nicht lokalisierte Ostgallier dieser
Zeit sind z. B. Ranto (Hedd. Mitt. IV Taf. XII Fig. II, Knorr, Rottweil Taf. IX
Fig. 1, Walters, Catalogue of the Roman pottery in the British Museum,
S. 210 Fig. 184) und der Töpfer mit dem dickstieligen Blatt (Sammlung
Niessen Taf. LXVII q, r, w, Knorr, Cannstatt Taf. IX Fig. 3, Ludowici, Urnen-
gräber S. 249), die hiermit weiterer Beachtung empfohlen seien.
Bonn. Oelmann.
Zur Alisofrage.
51. Durch die neuesten Ausgrabungen ist, wie Kropatscheck 1) näher aus-
geführt hat, erwiesen, dass Aliso nicht in Oberaden gesucht werden darf, da
die hier aufgedeckten Anlagen vor dem J. 9 n. Chr. zerstört worden sein
müssen. Ferner ist es zum mindesten als sehr wahrscheinlich anzusehen,
DeutscheGeschichtsblätterXIII1910/ii)S. 1 ff., 141 ff. Vgl.Bonner Jahrb. 120 (1911).