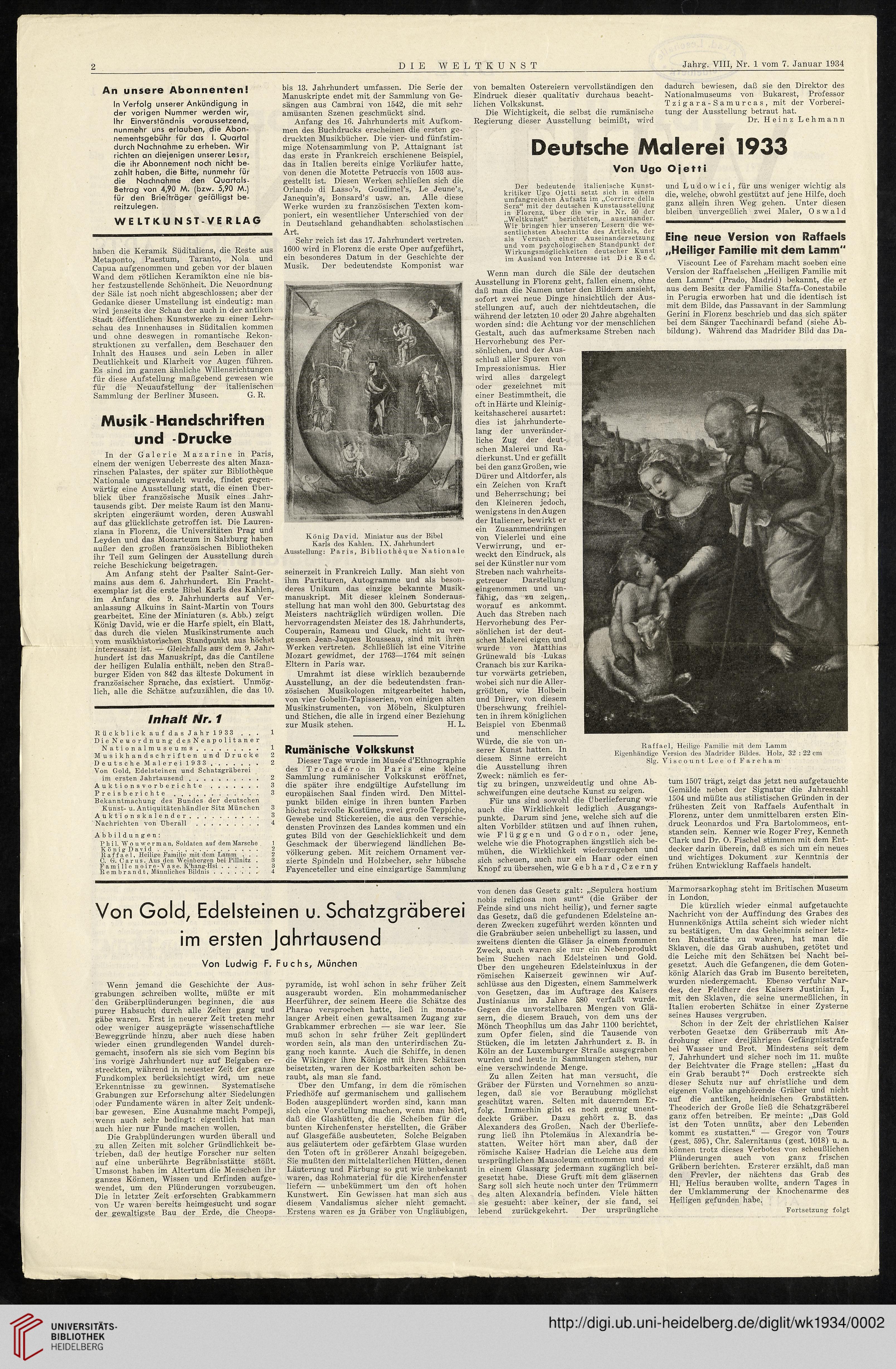2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 1 vom 7. Januar 1934
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigung in
der vorigen Nummer werden wir,
Ihr Einverständnis voraussetzend,
nunmehr uns erlauben, die Abon-
nementsgebühr für das I. Quartal
durch Nachnahme zu erheben. Wir
richten an diejenigen unserer Leser,
die ihr Abonnement noch nicht be-
zahlt haben, die Bitte, nunmehr für
die Nachnahme den Quartals-
Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)
für den Briefträger gefälligst be-
reitzulegen.
WELTKUN ST-VE RLAG
haben die Keramik Süditaliens, die Reste aus
Metaponto, Paestum, Taranto, Nola und
Capua aufgenommen und geben vor der blauen
Wand dem rötlichen Keramikton eine nie bis-
her festzustellende Schönheit. Die Neuordnung
der Säle ist noch nicht abgeschlossen; aber der
Gedanke dieser Umstellung ist eindeutig: man
wird jenseits der Schau der auch in der antiken
Stadt öffentlichen Kunstwerke zu einer Lehr-
schau des Innenhauses in Süditalien kommen
und ohne deswegen in romantische Rekon-
struktionen zu verfallen, dem Beschauer den
Inhalt des Hauses und sein Leben in aller
Deutlichkeit und Klarheit vor Augen führen.
Es sind im ganzen ähnliche Willensrichtungen
für diese Aufstellung maßgebend gewesen wie
für die Neuaufstellung der italienischen
Sammlung der Berliner Museen. G. R.
Musik-Handschriften
und -Drucke
In der Galerie Mazarine in Paris,
einem der wenigen Ueberreste des alten Maza-
rinschen Palastes, der später zur Bibliotheque
Nationale umgewandelt wurde, findet gegen-
wärtig eine Ausstellung statt, die einen Über-
blick über französische Musik eines Jahr-
tausends gibt. Der meiste Raum ist den Manu-
skripten eingeräumt worden, deren Auswahl
auf das glücklichste getroffen ist. Die Lauren-
ziana in Florenz, die Universitäten Prag und
Leyden und das Mozarteum in Salzburg haben
außer den großen französischen Bibliotheken
ihr Teil zum Gelingen der Ausstellung durch
reiche Beschickung beigetragen.
Am Anfang steht der Psalter Saint-Ger-
mains aus dem 6. Jahrhundert. Ein Pracht-
exemplar ist die erste Bibel Karls des Kahlen,
im Anfang des 9. Jahrhunderts auf Ver-
anlassung Alkuins in Saint-Martin von Tours
gearbeitet. Eine der Miniaturen (s. Abb.) zeigt
König David, wie er die Harfe spielt, ein Blatt,
das durch die vielen Musikinstrumente auch
vom musikhistorischen Standpunkt aus höchst
interessant ist. — Gleichfalls aus dem 9. Jahr-
hundert ist das Manuskript, das die Cantilene
der heiligen Eulalia enthält, neben den Straß-
burger Eiden von 842 das älteste Dokument in
französischer Sprache, das existiert. Unmög-
lich, alle die Schätze aufzuzählen, die das 10.
Inhalt Nr. 1
Rückblick auf das Jahr 1933 . . . 1
DieNeuordnung desNeapolitaner
Nationalmuseums. 1
Musikhandschriften und Drucke 2
DeutscheMalereil933 . 2
Von Gold, Edelsteinen und Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend. 2
Auktionsvorberichte . 3
Preisberichte . 3
Bekanntmachung des Bundes der deutschen
Kunst- u. Antiquitätenhändler Sitz München 3
Auktionskalender. 3
Nachrichten von Überall . 4
Abbildungen:
Phil. Wouwerman, Soldaten auf dem Marsche . 1
König David . . . . , . . .. 2
Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm ... 2
C. Gr. Carus. Aus den Weinbergen bei Pillnitz . 3
Fami 11 e n oire-Vase. K’hang-Hsi. 3
R e m b r an d t, Männliches Bildnis ....... 4
bis 13. Jahrhundert umfassen. Die Serie der
Manuskripte endet mit der Sammlung von Ge-
sängen aus Cambrai von 1542, die mit sehr
amüsanten Szenen geschmückt sind.
Anfang des 16. Jahrhunderts mit Aufkom-
men des Buchdrucks erscheinen die ersten ge-
druckten Musikbücher. Die vier- und fünfstim-
mige Notensammlung von P. Attaignant ist
das erste in Frankreich erschienene Beispiel,
das in Italien bereits einige Vorläufer hatte,
von denen die Motette Petruccis von 1503 aus-
gestellt ist. Diesen Werken schließen sich die
Orlando di Lasso’s, Goudimel’s, Le Jeune’s,
Janequin’s, Bonsard’s usw. an. Alle diese
Werke wurden zu französischen Texten kom-
poniert, ein wesentlicher Unterschied von der
in Deutschland gehandhabten scholastischen
Art.
Sehr reich ist das 17. Jahrhundert vertreten.
1600 wird in Florenz die erste Oper aufgeführt,
ein besonderes Datum in der Geschichte der
Musik. Der bedeutendste Komponist war
König David. Miniatur aus der Bibel
Karls des Kahlen. IX. Jahrhundert
Ausstellung: Paris, Bibliotheque Nationale
seinerzeit in Frankreich Lully. Man sieht von
ihm Partituren, Autogramme und als beson-
deres Unikum das einzige bekannte Musik-
manuskript. Mit dieser kleinen Sonderaus-
stellung hat man wohl den 300. Geburtstag des
Meisters nachträglich würdigen wollen. Die
hervorragendsten Meister des 18. Jahrhunderts,
Couperain, Rameau und Gluck, nicht zu ver-
gessen Jean-Jaques Rousseau, sind mit ihren
Werken vertreten. Schließlich ist eine Vitrine
Mozart gewidmet, der 1763—1764 mit seinen
Eltern in Paris war.
Umrahmt ist diese wirklich bezaubernde
Ausstellung, an der die bedeutendsten fran-
zösischen Musikologen mitgearbeitet haben,
von vier Gobelin-Tapisserien, von einigen alten
Musikinstrumenten, von Möbeln, Skulpturen
und Stichen, die alle in irgend einer Beziehung
zur Musik stehen. H. L.
Rumänische Volkskunst
Dieser Tage wurde im Musee d’Ethnographie
des Trocadero in Paris eine kleine
Sammlung rumänischer Volkskunst eröffnet,
die später ihre endgültige Aufstellung im
europäischen Saal finden wird. Den Mittel-
punkt bilden einige in ihren bunten Farben
höchst reizvolle Kostüme, zwei große Teppiche,
Gewebe und Stickereien, die aus den verschie-
densten Provinzen des Landes kommen und ein
gutes Bild von der Geschicklichkeit und dem
Geschmack der überwiegend ländlichen Be-
völkerung geben. Mit reichem Ornament ver-
zierte Spindeln und Holzbecher, sehr hübsche
Fayenceteller und eine einzigartige Sammlung
von bemalten Ostereiern vervollständigen den
Eindruck dieser qualitativ durchaus beacht-
lichen Volkskunst.
Die Wichtigkeit, die selbst die rumänische
Regierung dieser Ausstellung beimißt, wird
dadurch bewiesen, daß sie den Direktor des
Nationalmuseums von Bukarest, Professor
Tzigara-Samurcas, mit der Vorberei-
tung der Ausstellung betraut hat.
Dr. Heinz Lehmann
Deutsche Malerei 1933
Von Ugo Ojetti
Der bedeutende italienische Kunst-
kritiker Ugo Ojetti setzt sich in einem
umfangreichen Aufsatz im „Corriere della
Sera“ mit der deutschen Kunstausstellung
in Florenz, über die wir in Nr. 50 der
„Weltkunst“ berichteten, auseinander.
Wir bringen hier unseren Lesern die we-
sentlichsten Abschnitte des Artikels, der
als Versuch einer Auseinandersetzung
und vom psychologischen Standpunkt der
Wirkungsmöglichkeiten deutscher Kunst
im Ausland von Interesse ist D i e Re d.
Wenn man durch die Säle der deutschen
Ausstellung in Florenz geht, fallen einem, ohne
daß man die Namen unter den Bildern ansieht,
sofort zwei neue Dinge hinsichtlich der Aus-
stellungen auf, auch der nichtdeutschen, die
während der letzten 10 oder 20 Jahre abgehalten
worden sind: die Achtung vor der menschlichen
Gestalt, auch das aufmerksame Streben nach
Hervorhebung des Per¬
sönlichen, und der Aus-
schluß aller Spuren von
Impressionismus. Hier
wird alles dargelegt
oder gezeichnet mit
einer Bestimmtheit, die
oft in Härte und Kleinig¬
keitshascherei ausartet:
dies ist jahrhunderte¬
lang der unveränder-
liche Zug der deut-
schen Malerei und Ra¬
dierkunst. Und er gefällt
bei den ganz Großen, wie
Dürer und Altdorfer, als
ein Zeichen von Kraft
und Beherrschung; bei
den Kleineren jedoch,
wenigstens in den Augen
der Italiener, bewirkt er
ein Zusammendrängen
von Vielerlei und eine
Verwirrung, und er-
weckt den Eindruck, als
sei der Künstler nur vom
Streben nach wahrheits¬
getreuer Darstellung
eingenommen und un-
fähig, das zu zeigen,
worauf es ankommt.
Auch das Streben nach
Hervorhebung des Per¬
sönlichen ist der deut-
schen Malerei eigen und
wurde von Matthias
Grünewald bis Lukas
Cranach bis zur Karika¬
tur vorwärts getrieben,
wobei sich nur die Aller¬
größten, wie Holbein
und Dürer, von diesem
Überschwung freihiel¬
ten in ihrem königlichen
Beispiel von Ebenmaß
und menschlicher
Würde, die sie von un-
serer Kunst hatten. In
diesem Sinne erreicht
die Ausstellung ihren
Zweck: nämlich es fer-
tig zu bringen, unzweideutig und ohne Ab-
schweifungen eine deutsche Kunst zu zeigen.
Für uns sind sowohl die Überlieferung wie
auch die Wirklichkeit lediglich Ausgangs-
punkte. Darum sind jene, welche sich auf die
alten Vorbilder stützen und auf ihnen ruhen,
wie Flüggen und G o d r o n , oder jene,
welche wie die Photographen ängstlich sich be-
mühen, die Wirklichkeit wiederzugeben und
sich scheuen, auch nur ein Haar oder einen
Knopf zu übersehen, wie Gebhard,Czerny
und L u d o w i c i, für uns weniger wichtig als
die, welche, obwohl gestützt auf jene Hilfe, doch
ganz allein ihren Weg gehen. Unter diesen
bleiben unvergeßlich zwei Maler, Oswald
Eine neue Version von Raffaels
„Heiliger Familie mit dem Lamm"
Viscount Lee of Fareham macht soeben eine
Version der Raffaelschen „Heiligen Familie mit
dem Lamm“ (Prado, Madrid) bekannt, die er
aus dem Besitz der Familie Staffa-Conestabile
in Perugia erworben hat und die identisch ist
mit dem Bilde, das Passavant in der Sammlung
Gerini in Florenz beschrieb und das sich später
bei dem Sänger Tacchinardi befand (siehe Ab-
bildung). Während das Madrider Bild das Da-
tum 1507 trägt, zeigt das jetzt neu aufgetauchte
Gemälde neben der Signatur die Jahreszahl
1504 und müßte aus stilistischen Gründen in der
frühesten Zeit von Raffaels Aufenthalt in
Florenz, unter dem unmittelbaren ersten Ein-
druck Leonardos und Fra Bartolommeos, ent-
standen sein. Kenner wie Roger Frey, Kenneth
Clark und Dr. O. Fischei stimmen mit dem Ent-
decker darin überein, daß es sich um ein neues
und wichtiges Dokument zur Kenntnis der
frühen Entwicklung Raffaels handelt.
Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm
Eigenhändige Version des Madrider Bildes. Holz, 32 : 22 cm
Slg. Viscount Lee of Fareham
Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend
Von Ludwig F. Fuchs, München
Wenn jemand die Geschichte der Aus-
grabungen schreiben wollte, müßte er mit
den Gräberplünderungen beginnen, die aus
purer Habsucht durch alle Zeiten gang und
gäbe waren. Erst in neuerer Zeit treten mehr
oder weniger ausgeprägte wissenschaftliche
Beweggründe hinzu, aber auch diese haben
wieder einen grundlegenden Wandel durch-
gemacht, insofern als sie sich vom Beginn bis
ins vorige Jahrhundert nur auf Beigaben er-
streckten, während in neuester Zeit der ganze
Fundkomplex berücksichtigt wird, um neue
Erkenntnisse zu gewinnen. Systematische
Grabungen zur Erforschung alter Siedelungen
oder Fundamente wären in alter Zeit undenk-
bar gewesen. Eine Ausnahme macht Pompeji,
wenn auch sehr bedingt: eigentlich hat man
auch hier nur Funde machen wollen.
Die Grabplünderungen wurden überall und
zu allen Zeiten mit solcher Gründlichkeit be-
trieben, daß der heutige Forscher nur selten
auf eine unberührte Begräbnisstätte stößt.
Umsonst haben im Altertum die Menschen ihr
ganzes Können, Wissen und Erfinden aufge-
wendet, um den Plünderungen vorzubeugen.
Die in letzter Zeit erforschten Grabkammern
von Ur waren bereits heimgesucht und sogar
der gewaltigste Bau der Erde, die Cheops-
pyramide, ist wohl schon in sehr früher Zeit
ausgeraubt worden. Ein mohammedanischer
Heerführer, der seinem Heere die Schätze des
Pharao versprochen hatte, ließ in monate-
langer Arbeit einen gewaltsamen Zugang zur
Grabkammer erbrechen — sie war leer. Sie
muß schon in sehr früher Zeit geplündert
worden sein, als man den unterirdischen Zu-
gang noch kannte. Auch die Schiffe, in denen
die Wikinger ihre Könige mit ihren Schätzen
beisetzten, waren der Kostbarkeiten schon be-
raubt, als man sie fand.
Über den Umfang, in' dem die römischen
Friedhöfe auf germanischem und gallischem
Boden ausgeplündert worden sind, kann man
sich eine Vorstellung machen, wenn man hört,
daß die Glashütten, die die Scheiben für die
bunten Kirchenfenster herstellten, die Gräber
auf Glasgefäße ausbeuteten. Solche Beigaben
aus geläutertem oder gefärbtem Glase wurden
den Toten oft in größerer Anzahl beigegeben.
Sie mußten den mittelalterlichen Hütten, denen
Läuterung und Färbung so gut wie unbekannt
waren, das Rohmaterial für die Kirchenfenster
liefern — unbekümmert um den oft hohen
Kunstwert. Ein Gewissen hat man sich aus
diesem Vandalismus sicher nicht gemacht.
Erstens waren es ja Gräber von Ungläubigen,
von denen das Gesetz galt: „Sepulcra hostium
nobis religiosa non sunt“ (die Gräber der
Feinde sind uns nicht heilig), und ferner sagte
das Gesetz, daß die gefundenen Edelsteine an-
deren Zwecken! zugeführt werden könnten und
die Grabräuber seien unbehelligt zu lassen, und
zweitens dienten die Gläser ja einem frommen
Zweck, auch waren sie nur ein Nebenprodukt
beim Suchen nach Edelsteinen und Gold.
Über den ungeheuren Edelsteinluxus in der
römischen Kaiserzeit gewinnen wir Auf-
schlüsse aus den Digesten, einem Sammelwerk
von Gesetzen, das im Auftrage des Kaisers
Justinianus im Jahre 580 verfaßt wurde.
Gegen die unvorstellbaren Mengen von Glä-
sern, die diesem Brauch, von dem uns der
Mönch Theophilus um das Jahr 1100 berichtet,
zum Opfer fielen, sind die Tausende von
Stücken, die im letzten Jahrhundert z. B. in
Köln an der Luxemburger Straße ausgegraben
wurden und heute in1 Sammlungen stehen, nur
eine verschwindende Menge.
Zu allen Zeiten hat man versucht, die
Gräber der Fürsten und Vornehmen so anzu-
legen, daß sie vor Beraubung möglichst
geschützt waren. Selten mit dauerndem Er-
folg. Immerhin gibt es noch genug unent-
deckte Gräber. Dazu gehört z. B. das
Alexanders des Großen. Nach der Überliefe-
rung ließ ihn Ptolemäus in Alexandria be-
statten. Weiter hört man aber, daß der
römische Kaiser Hadrian die Leiche aus dem
ursprünglichen Mausoleum entnommen und sie
in einem Glassarg jedermann zugänglich bei-
gesetzt habe. Diese Gruft mit dem gläsernen
Sarg soll sich heute noch unter den Trümmern
des alten Alexandria befinden'. Viele hätten
sie gesucht: aber keiner, der sie fand, sei
lebend zurückgekehrt. Der ursprüngliche
Marmorsarkophag steht im Britischen Museum
in London.
Die kürzlich wieder einmal aufgetauchte
Nachricht von der Auffindung des Grabes des
Hunnenkönigs Attila scheint sich wieder nicht
zu bestätigen. Um das Geheimnis seiner letz-
ten Ruhestätte zu wahren, hat man die
Sklaven, die das Grab aushuben, getötet und
die Leiche mit den Schätzen bei Nacht bei-
gesetzt. Auch die Gefangenen, die dem Goten-
könig Alarich das Grab im Busento bereiteten,
wurden niedergemacht. Ebenso verfuhr Nar-
des, der Feldherr des Kaisers Justinian I.,
mit den Sklaven, die seine unermeßlichen, in
Italien eroberten Schätze in einer Zysterne
seines Hauses vergruben.
Schon in der Zeit der christlichen Kaiser
verboten Gesetze den Gräberraub mit An-
drohung einer dreijährigen Gefängnisstrafe
bei Wasser und Brot. Mindestens seit dem
7. Jahrhundert und sicher noch im 11. mußte
der Beichtvater die Frage stellen: „Hast du
ein Grab beraubt?“ Doch erstreckte sich
dieser Schutz nur auf christliche und dem
eigenen Volke angehörende Gräber und nicht
auf die antiken, heidnischen Grabstätten.
Theoderich der Große ließ die Schatzgräberei
ganz offen betreiben. Er meinte: „Das Gold
ist den Toten unnütz, aber den Lebenden
kommt es zustatten.“ — Gregor von Tours
(gest. 595), Ohr. Salernitanus (gest. 1018) u. a.
können trotz dieses Verbotes von scheußlichen
Plünderungen auch von ganz frischen
Gräbern berichten. Ersterer erzählt, daß man
den Frevler, der nächtens das Grab des
Hl. Helius berauben wollte, andern Tages in
der Umklammerung der Knochenarme des
Heiligen gefunden habe.
Fortsetzung folgt
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 1 vom 7. Januar 1934
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigung in
der vorigen Nummer werden wir,
Ihr Einverständnis voraussetzend,
nunmehr uns erlauben, die Abon-
nementsgebühr für das I. Quartal
durch Nachnahme zu erheben. Wir
richten an diejenigen unserer Leser,
die ihr Abonnement noch nicht be-
zahlt haben, die Bitte, nunmehr für
die Nachnahme den Quartals-
Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)
für den Briefträger gefälligst be-
reitzulegen.
WELTKUN ST-VE RLAG
haben die Keramik Süditaliens, die Reste aus
Metaponto, Paestum, Taranto, Nola und
Capua aufgenommen und geben vor der blauen
Wand dem rötlichen Keramikton eine nie bis-
her festzustellende Schönheit. Die Neuordnung
der Säle ist noch nicht abgeschlossen; aber der
Gedanke dieser Umstellung ist eindeutig: man
wird jenseits der Schau der auch in der antiken
Stadt öffentlichen Kunstwerke zu einer Lehr-
schau des Innenhauses in Süditalien kommen
und ohne deswegen in romantische Rekon-
struktionen zu verfallen, dem Beschauer den
Inhalt des Hauses und sein Leben in aller
Deutlichkeit und Klarheit vor Augen führen.
Es sind im ganzen ähnliche Willensrichtungen
für diese Aufstellung maßgebend gewesen wie
für die Neuaufstellung der italienischen
Sammlung der Berliner Museen. G. R.
Musik-Handschriften
und -Drucke
In der Galerie Mazarine in Paris,
einem der wenigen Ueberreste des alten Maza-
rinschen Palastes, der später zur Bibliotheque
Nationale umgewandelt wurde, findet gegen-
wärtig eine Ausstellung statt, die einen Über-
blick über französische Musik eines Jahr-
tausends gibt. Der meiste Raum ist den Manu-
skripten eingeräumt worden, deren Auswahl
auf das glücklichste getroffen ist. Die Lauren-
ziana in Florenz, die Universitäten Prag und
Leyden und das Mozarteum in Salzburg haben
außer den großen französischen Bibliotheken
ihr Teil zum Gelingen der Ausstellung durch
reiche Beschickung beigetragen.
Am Anfang steht der Psalter Saint-Ger-
mains aus dem 6. Jahrhundert. Ein Pracht-
exemplar ist die erste Bibel Karls des Kahlen,
im Anfang des 9. Jahrhunderts auf Ver-
anlassung Alkuins in Saint-Martin von Tours
gearbeitet. Eine der Miniaturen (s. Abb.) zeigt
König David, wie er die Harfe spielt, ein Blatt,
das durch die vielen Musikinstrumente auch
vom musikhistorischen Standpunkt aus höchst
interessant ist. — Gleichfalls aus dem 9. Jahr-
hundert ist das Manuskript, das die Cantilene
der heiligen Eulalia enthält, neben den Straß-
burger Eiden von 842 das älteste Dokument in
französischer Sprache, das existiert. Unmög-
lich, alle die Schätze aufzuzählen, die das 10.
Inhalt Nr. 1
Rückblick auf das Jahr 1933 . . . 1
DieNeuordnung desNeapolitaner
Nationalmuseums. 1
Musikhandschriften und Drucke 2
DeutscheMalereil933 . 2
Von Gold, Edelsteinen und Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend. 2
Auktionsvorberichte . 3
Preisberichte . 3
Bekanntmachung des Bundes der deutschen
Kunst- u. Antiquitätenhändler Sitz München 3
Auktionskalender. 3
Nachrichten von Überall . 4
Abbildungen:
Phil. Wouwerman, Soldaten auf dem Marsche . 1
König David . . . . , . . .. 2
Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm ... 2
C. Gr. Carus. Aus den Weinbergen bei Pillnitz . 3
Fami 11 e n oire-Vase. K’hang-Hsi. 3
R e m b r an d t, Männliches Bildnis ....... 4
bis 13. Jahrhundert umfassen. Die Serie der
Manuskripte endet mit der Sammlung von Ge-
sängen aus Cambrai von 1542, die mit sehr
amüsanten Szenen geschmückt sind.
Anfang des 16. Jahrhunderts mit Aufkom-
men des Buchdrucks erscheinen die ersten ge-
druckten Musikbücher. Die vier- und fünfstim-
mige Notensammlung von P. Attaignant ist
das erste in Frankreich erschienene Beispiel,
das in Italien bereits einige Vorläufer hatte,
von denen die Motette Petruccis von 1503 aus-
gestellt ist. Diesen Werken schließen sich die
Orlando di Lasso’s, Goudimel’s, Le Jeune’s,
Janequin’s, Bonsard’s usw. an. Alle diese
Werke wurden zu französischen Texten kom-
poniert, ein wesentlicher Unterschied von der
in Deutschland gehandhabten scholastischen
Art.
Sehr reich ist das 17. Jahrhundert vertreten.
1600 wird in Florenz die erste Oper aufgeführt,
ein besonderes Datum in der Geschichte der
Musik. Der bedeutendste Komponist war
König David. Miniatur aus der Bibel
Karls des Kahlen. IX. Jahrhundert
Ausstellung: Paris, Bibliotheque Nationale
seinerzeit in Frankreich Lully. Man sieht von
ihm Partituren, Autogramme und als beson-
deres Unikum das einzige bekannte Musik-
manuskript. Mit dieser kleinen Sonderaus-
stellung hat man wohl den 300. Geburtstag des
Meisters nachträglich würdigen wollen. Die
hervorragendsten Meister des 18. Jahrhunderts,
Couperain, Rameau und Gluck, nicht zu ver-
gessen Jean-Jaques Rousseau, sind mit ihren
Werken vertreten. Schließlich ist eine Vitrine
Mozart gewidmet, der 1763—1764 mit seinen
Eltern in Paris war.
Umrahmt ist diese wirklich bezaubernde
Ausstellung, an der die bedeutendsten fran-
zösischen Musikologen mitgearbeitet haben,
von vier Gobelin-Tapisserien, von einigen alten
Musikinstrumenten, von Möbeln, Skulpturen
und Stichen, die alle in irgend einer Beziehung
zur Musik stehen. H. L.
Rumänische Volkskunst
Dieser Tage wurde im Musee d’Ethnographie
des Trocadero in Paris eine kleine
Sammlung rumänischer Volkskunst eröffnet,
die später ihre endgültige Aufstellung im
europäischen Saal finden wird. Den Mittel-
punkt bilden einige in ihren bunten Farben
höchst reizvolle Kostüme, zwei große Teppiche,
Gewebe und Stickereien, die aus den verschie-
densten Provinzen des Landes kommen und ein
gutes Bild von der Geschicklichkeit und dem
Geschmack der überwiegend ländlichen Be-
völkerung geben. Mit reichem Ornament ver-
zierte Spindeln und Holzbecher, sehr hübsche
Fayenceteller und eine einzigartige Sammlung
von bemalten Ostereiern vervollständigen den
Eindruck dieser qualitativ durchaus beacht-
lichen Volkskunst.
Die Wichtigkeit, die selbst die rumänische
Regierung dieser Ausstellung beimißt, wird
dadurch bewiesen, daß sie den Direktor des
Nationalmuseums von Bukarest, Professor
Tzigara-Samurcas, mit der Vorberei-
tung der Ausstellung betraut hat.
Dr. Heinz Lehmann
Deutsche Malerei 1933
Von Ugo Ojetti
Der bedeutende italienische Kunst-
kritiker Ugo Ojetti setzt sich in einem
umfangreichen Aufsatz im „Corriere della
Sera“ mit der deutschen Kunstausstellung
in Florenz, über die wir in Nr. 50 der
„Weltkunst“ berichteten, auseinander.
Wir bringen hier unseren Lesern die we-
sentlichsten Abschnitte des Artikels, der
als Versuch einer Auseinandersetzung
und vom psychologischen Standpunkt der
Wirkungsmöglichkeiten deutscher Kunst
im Ausland von Interesse ist D i e Re d.
Wenn man durch die Säle der deutschen
Ausstellung in Florenz geht, fallen einem, ohne
daß man die Namen unter den Bildern ansieht,
sofort zwei neue Dinge hinsichtlich der Aus-
stellungen auf, auch der nichtdeutschen, die
während der letzten 10 oder 20 Jahre abgehalten
worden sind: die Achtung vor der menschlichen
Gestalt, auch das aufmerksame Streben nach
Hervorhebung des Per¬
sönlichen, und der Aus-
schluß aller Spuren von
Impressionismus. Hier
wird alles dargelegt
oder gezeichnet mit
einer Bestimmtheit, die
oft in Härte und Kleinig¬
keitshascherei ausartet:
dies ist jahrhunderte¬
lang der unveränder-
liche Zug der deut-
schen Malerei und Ra¬
dierkunst. Und er gefällt
bei den ganz Großen, wie
Dürer und Altdorfer, als
ein Zeichen von Kraft
und Beherrschung; bei
den Kleineren jedoch,
wenigstens in den Augen
der Italiener, bewirkt er
ein Zusammendrängen
von Vielerlei und eine
Verwirrung, und er-
weckt den Eindruck, als
sei der Künstler nur vom
Streben nach wahrheits¬
getreuer Darstellung
eingenommen und un-
fähig, das zu zeigen,
worauf es ankommt.
Auch das Streben nach
Hervorhebung des Per¬
sönlichen ist der deut-
schen Malerei eigen und
wurde von Matthias
Grünewald bis Lukas
Cranach bis zur Karika¬
tur vorwärts getrieben,
wobei sich nur die Aller¬
größten, wie Holbein
und Dürer, von diesem
Überschwung freihiel¬
ten in ihrem königlichen
Beispiel von Ebenmaß
und menschlicher
Würde, die sie von un-
serer Kunst hatten. In
diesem Sinne erreicht
die Ausstellung ihren
Zweck: nämlich es fer-
tig zu bringen, unzweideutig und ohne Ab-
schweifungen eine deutsche Kunst zu zeigen.
Für uns sind sowohl die Überlieferung wie
auch die Wirklichkeit lediglich Ausgangs-
punkte. Darum sind jene, welche sich auf die
alten Vorbilder stützen und auf ihnen ruhen,
wie Flüggen und G o d r o n , oder jene,
welche wie die Photographen ängstlich sich be-
mühen, die Wirklichkeit wiederzugeben und
sich scheuen, auch nur ein Haar oder einen
Knopf zu übersehen, wie Gebhard,Czerny
und L u d o w i c i, für uns weniger wichtig als
die, welche, obwohl gestützt auf jene Hilfe, doch
ganz allein ihren Weg gehen. Unter diesen
bleiben unvergeßlich zwei Maler, Oswald
Eine neue Version von Raffaels
„Heiliger Familie mit dem Lamm"
Viscount Lee of Fareham macht soeben eine
Version der Raffaelschen „Heiligen Familie mit
dem Lamm“ (Prado, Madrid) bekannt, die er
aus dem Besitz der Familie Staffa-Conestabile
in Perugia erworben hat und die identisch ist
mit dem Bilde, das Passavant in der Sammlung
Gerini in Florenz beschrieb und das sich später
bei dem Sänger Tacchinardi befand (siehe Ab-
bildung). Während das Madrider Bild das Da-
tum 1507 trägt, zeigt das jetzt neu aufgetauchte
Gemälde neben der Signatur die Jahreszahl
1504 und müßte aus stilistischen Gründen in der
frühesten Zeit von Raffaels Aufenthalt in
Florenz, unter dem unmittelbaren ersten Ein-
druck Leonardos und Fra Bartolommeos, ent-
standen sein. Kenner wie Roger Frey, Kenneth
Clark und Dr. O. Fischei stimmen mit dem Ent-
decker darin überein, daß es sich um ein neues
und wichtiges Dokument zur Kenntnis der
frühen Entwicklung Raffaels handelt.
Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm
Eigenhändige Version des Madrider Bildes. Holz, 32 : 22 cm
Slg. Viscount Lee of Fareham
Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend
Von Ludwig F. Fuchs, München
Wenn jemand die Geschichte der Aus-
grabungen schreiben wollte, müßte er mit
den Gräberplünderungen beginnen, die aus
purer Habsucht durch alle Zeiten gang und
gäbe waren. Erst in neuerer Zeit treten mehr
oder weniger ausgeprägte wissenschaftliche
Beweggründe hinzu, aber auch diese haben
wieder einen grundlegenden Wandel durch-
gemacht, insofern als sie sich vom Beginn bis
ins vorige Jahrhundert nur auf Beigaben er-
streckten, während in neuester Zeit der ganze
Fundkomplex berücksichtigt wird, um neue
Erkenntnisse zu gewinnen. Systematische
Grabungen zur Erforschung alter Siedelungen
oder Fundamente wären in alter Zeit undenk-
bar gewesen. Eine Ausnahme macht Pompeji,
wenn auch sehr bedingt: eigentlich hat man
auch hier nur Funde machen wollen.
Die Grabplünderungen wurden überall und
zu allen Zeiten mit solcher Gründlichkeit be-
trieben, daß der heutige Forscher nur selten
auf eine unberührte Begräbnisstätte stößt.
Umsonst haben im Altertum die Menschen ihr
ganzes Können, Wissen und Erfinden aufge-
wendet, um den Plünderungen vorzubeugen.
Die in letzter Zeit erforschten Grabkammern
von Ur waren bereits heimgesucht und sogar
der gewaltigste Bau der Erde, die Cheops-
pyramide, ist wohl schon in sehr früher Zeit
ausgeraubt worden. Ein mohammedanischer
Heerführer, der seinem Heere die Schätze des
Pharao versprochen hatte, ließ in monate-
langer Arbeit einen gewaltsamen Zugang zur
Grabkammer erbrechen — sie war leer. Sie
muß schon in sehr früher Zeit geplündert
worden sein, als man den unterirdischen Zu-
gang noch kannte. Auch die Schiffe, in denen
die Wikinger ihre Könige mit ihren Schätzen
beisetzten, waren der Kostbarkeiten schon be-
raubt, als man sie fand.
Über den Umfang, in' dem die römischen
Friedhöfe auf germanischem und gallischem
Boden ausgeplündert worden sind, kann man
sich eine Vorstellung machen, wenn man hört,
daß die Glashütten, die die Scheiben für die
bunten Kirchenfenster herstellten, die Gräber
auf Glasgefäße ausbeuteten. Solche Beigaben
aus geläutertem oder gefärbtem Glase wurden
den Toten oft in größerer Anzahl beigegeben.
Sie mußten den mittelalterlichen Hütten, denen
Läuterung und Färbung so gut wie unbekannt
waren, das Rohmaterial für die Kirchenfenster
liefern — unbekümmert um den oft hohen
Kunstwert. Ein Gewissen hat man sich aus
diesem Vandalismus sicher nicht gemacht.
Erstens waren es ja Gräber von Ungläubigen,
von denen das Gesetz galt: „Sepulcra hostium
nobis religiosa non sunt“ (die Gräber der
Feinde sind uns nicht heilig), und ferner sagte
das Gesetz, daß die gefundenen Edelsteine an-
deren Zwecken! zugeführt werden könnten und
die Grabräuber seien unbehelligt zu lassen, und
zweitens dienten die Gläser ja einem frommen
Zweck, auch waren sie nur ein Nebenprodukt
beim Suchen nach Edelsteinen und Gold.
Über den ungeheuren Edelsteinluxus in der
römischen Kaiserzeit gewinnen wir Auf-
schlüsse aus den Digesten, einem Sammelwerk
von Gesetzen, das im Auftrage des Kaisers
Justinianus im Jahre 580 verfaßt wurde.
Gegen die unvorstellbaren Mengen von Glä-
sern, die diesem Brauch, von dem uns der
Mönch Theophilus um das Jahr 1100 berichtet,
zum Opfer fielen, sind die Tausende von
Stücken, die im letzten Jahrhundert z. B. in
Köln an der Luxemburger Straße ausgegraben
wurden und heute in1 Sammlungen stehen, nur
eine verschwindende Menge.
Zu allen Zeiten hat man versucht, die
Gräber der Fürsten und Vornehmen so anzu-
legen, daß sie vor Beraubung möglichst
geschützt waren. Selten mit dauerndem Er-
folg. Immerhin gibt es noch genug unent-
deckte Gräber. Dazu gehört z. B. das
Alexanders des Großen. Nach der Überliefe-
rung ließ ihn Ptolemäus in Alexandria be-
statten. Weiter hört man aber, daß der
römische Kaiser Hadrian die Leiche aus dem
ursprünglichen Mausoleum entnommen und sie
in einem Glassarg jedermann zugänglich bei-
gesetzt habe. Diese Gruft mit dem gläsernen
Sarg soll sich heute noch unter den Trümmern
des alten Alexandria befinden'. Viele hätten
sie gesucht: aber keiner, der sie fand, sei
lebend zurückgekehrt. Der ursprüngliche
Marmorsarkophag steht im Britischen Museum
in London.
Die kürzlich wieder einmal aufgetauchte
Nachricht von der Auffindung des Grabes des
Hunnenkönigs Attila scheint sich wieder nicht
zu bestätigen. Um das Geheimnis seiner letz-
ten Ruhestätte zu wahren, hat man die
Sklaven, die das Grab aushuben, getötet und
die Leiche mit den Schätzen bei Nacht bei-
gesetzt. Auch die Gefangenen, die dem Goten-
könig Alarich das Grab im Busento bereiteten,
wurden niedergemacht. Ebenso verfuhr Nar-
des, der Feldherr des Kaisers Justinian I.,
mit den Sklaven, die seine unermeßlichen, in
Italien eroberten Schätze in einer Zysterne
seines Hauses vergruben.
Schon in der Zeit der christlichen Kaiser
verboten Gesetze den Gräberraub mit An-
drohung einer dreijährigen Gefängnisstrafe
bei Wasser und Brot. Mindestens seit dem
7. Jahrhundert und sicher noch im 11. mußte
der Beichtvater die Frage stellen: „Hast du
ein Grab beraubt?“ Doch erstreckte sich
dieser Schutz nur auf christliche und dem
eigenen Volke angehörende Gräber und nicht
auf die antiken, heidnischen Grabstätten.
Theoderich der Große ließ die Schatzgräberei
ganz offen betreiben. Er meinte: „Das Gold
ist den Toten unnütz, aber den Lebenden
kommt es zustatten.“ — Gregor von Tours
(gest. 595), Ohr. Salernitanus (gest. 1018) u. a.
können trotz dieses Verbotes von scheußlichen
Plünderungen auch von ganz frischen
Gräbern berichten. Ersterer erzählt, daß man
den Frevler, der nächtens das Grab des
Hl. Helius berauben wollte, andern Tages in
der Umklammerung der Knochenarme des
Heiligen gefunden habe.
Fortsetzung folgt