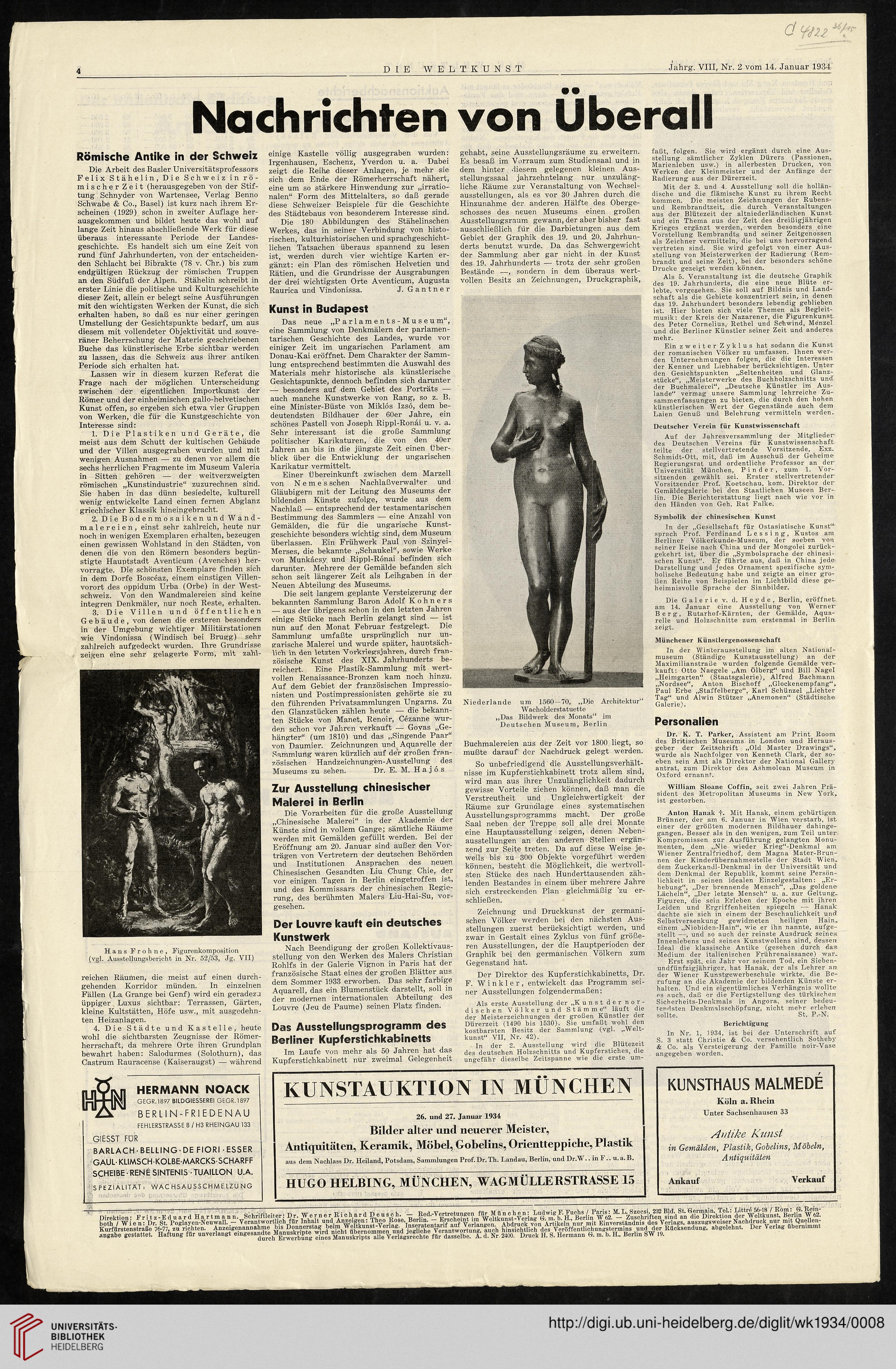4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Ni-, 2 vom 14. Januar 1934-
• •
Nachrichten von Überall
Römische Antike in der Schweiz
Die Arbeit des Basler Universitätsprofessors
Felix Stähelin, Die Schweiz in rö-
mischer Zeit (herausgegeben von der Stif-
tung Schnyder von Wartensee, Verlag Benno
Schwabe & Co., Basel) ist kurz nach ihrem Er-
scheinen (1929) schon in zweiter Auflage her-
ausgekommen und bildet heute das wohl auf
lange Zeit hinaus abschließende Werk für diese
überaus interessante Periode der Landes-
geschichte. Es handelt sich um eine Zeit von
rund fünf Jahrhunderten, von der entscheiden-
den Schlacht bei Bibrakte (78 v. Chr.) bis zum
endgültigen Rückzug der römischen Truppen
an den Südfuß der Alpen. Stähelin schreibt in
erster Linie die politische und Kulturgeschichte
dieser Zeit, allein er belegt seine Ausführungen
mit den wichtigsten Werken der Kunst, die sich
erhalten haben, so daß es nur einer geringen
Umstellung der Gesichtspunkte bedarf, um aus
diesem mit vollendeter Objektivität und souve-
räner Beherrschung der Materie geschriebenen
Buche das künstlerische Erbe sichtbar werden
zu lassen, das die Schweiz aus ihrer antiken
Periode sich erhalten hat.
Lassen wir in diesem kurzen Referat die
Frage nach der möglichen Unterscheidung
zwischen der eigentlichen Importkunst der
Römer und der einheimischen gallo-helvetischen
Kunst offen, so ergeben sich etwa vier Gruppen
von Werken, die für die Kunstgeschichte von
Interesse sind:
1. Die Plastiken und Geräte, die
meist aus dem Schutt der kultischen Gebäude
und der Villen ausgegraben wurden und mit
wenigen Ausnahmen — zu denen vor allem die
sechs herrlichen Fragmente im Museum Valeria
in Sitten gehören — der weitverzweigten
römischen „Kunstindustrie“ zuzurechnen sind.
Sie haben in das dünn besiedelte, kulturell
wenig entwickelte Land einen fernen Abglanz
griechischer Klassik hineingebracht.
2. Die Bodenmosaiken und Wand-
malereien, einst sehr zahlreich, heute nur
noch in wenigen Exemplaren erhalten, bezeugen
einen gewissen Wohlstand in den Städten, von
denen die von den Römern besonders begün-
stigte Hauptstadt Aventicum (Avenches) her-
vorragte. Die schönsten Exemplare finden sich
in dem Dorfe Bosceaz, einem einstigen Villen-
vorort des oppidum Urba (Orbe) in der West-
schweiz. Von den Wandmalereien sind keine
integren Denkmäler, nur noch Reste, erhalten.
3. Die Villen und öffentlichen
Gebäude, von denen die ersteren besonders
in der Umgebung wichtiger Militärstationen
wie Vindonissa (Windisch bei Brugg) sehr
zahlreich aufgedeckt wurden. Ihre Grundrisse
zeigen eine sehr gelagerte Form, mit zahl-
H ans Frohne, Figurenkomposition
(vgl. Ausstellungsbericht in Nr. 52/53, Jg. VII)
reichen Räumen, die meist auf einen durch-
gehenden Korridor münden. In einzelnen
Fällen (La Grange bei Genf) wird ein geradezu
üppiger Luxus sichtbar: Terrassen, Gärten,
kleine Kultstätten, Höfe usw., mit ausgedehn-
ten Heizanlagen.
4. Die Städte und Kastelle, heute
wohl die sichtbarsten Zeugnisse der Römer-
herrschaft, da mehrere Orte ihren Grundplan
bewahrt haben: Salodurmes (Solothurn), das
Castrum Rauracense (Kaiseraugst) —während
HERMANN NOACK
GEGR.1897 BILDGIESSEREI GEGR.1897
BERLIN-FRIEDENAU
FEHLERSTRASSE 8 / H3 RHEINGAU 133
GIESST FÜR
BARLACH • BELLING • DE FIORI - ESSER
GAUL-KLIMSCHKOLBEMARCKSSCHARFF
SCHEIBE • RENESINTENIS -TUAILLON U.A.
S PEZIALITÄT : WAC HS AUSSCHMELZUNG
einige Kastelle völlig ausgegraben wurden:
Irgenhausen, Eschenz, Yverdon u. a. Dabei
zeigt die Reihe dieser Anlagen, je mehr sie
sich dem Ende der Römerherrschaft nähert,
eine um so stärkere Hinwendung zur „irratio-
nalen“ Form des Mittelalters, so daß gerade
diese Schweizer Beispiele für die Geschichte
des Städtebaus von besonderem Interesse sind.
Die 180 Abbildungen des Stähelinschen
Werkes, das in seiner Verbindung von histo-
rischen, kulturhistorischen und sprachgeschicht-
lichen Tatsachen überaus spannend zu lesen
ist, werden durch vier wichtige Karten er-
gänzt: ein Plan des römischen Helvetien und
Rätien, und die Grundrisse der Ausgrabungen
der drei wichtigsten Orte Aventicum, Augusta
Raurica und Vindonissa. J. Gantner
Kunst in Budapest
Das neue „P arlam en t s - Mus eu m“,
eine Sammlung von Denkmälern der parlamen-
tarischen Geschichte des Landes, wurde vor
einiger Zeit im ungarischen Parlament am
Donau-Kai eröffnet. Dem Charakter der Samm-
lung entsprechend bestimmten die Auswahl des
Materials mehr historische als künstlerische
Gesichtspunkte, dennoch befinden sich daruntei-
— besonders auf dem Gebiet des Porträts —
auch manche Kunstwerke von Rang, so z. B.
eine Minister-Büste von Miklös Izsö, dem be-
deutendsten Bildhauer der 60er Jahre, ein
schönes Pastell von Joseph Rippl-Ronäi u. v. a.
Sehr interessant ist die große Sammlung
politischer Karikaturen, die von den 40er
Jahren an bis in die jüngste Zeit einen Über-
blick über die Entwicklung der ungarischen
Karikatur vermittelt.
Einer Übereinkunft zwischen dem Marzell
von N e m e s sehen Nachlaßverwalter und
Gläubigern mit der Leitung des Museums der
bildenden Künste zufolge, wurde aus dem
Nachlaß — entsprechend der testamentarischen
Bestimmung des Sammlers — eine Anzahl von
Gemälden, die für die ungarische Kunst-
geschichte besonders wichtig sind, dem Museum
überlassen. Ein Frühwerk Paul von Szinyei-
Merses, die bekannte „Schaukel“, sowie Werke
von Munkäcsy und Rippl-Rönai befinden sich
darunter. Mehrere der Gemälde befanden sich
schon seit längerer Zeit als Leihgaben in der
Neuen Abteilung des Museums.
Die seit langem geplante Versteigerung der
bekannten Sammlung Baron Adolf K o h n e r s
— aus der übrigens schon in den letzten Jahren
einige Stücke nach Berlin gelangt sind — ist
nun auf den Monat Februar festgelegt. Die
Sammlung umfaßte ursprünglich nur un-
garische Malerei und wurde später, hauntsäch-
lich in den letzten Vorkriegsjahren, durch fran-
zösische Kunst des XIX. Jahrhunderts be-
reichert. Eine Plastik-Sammlung mit wert-
vollen Renaissance-Bronzen kam noch hinzu.
Auf dem Gebiet der französischen Impressio-
nisten und Postimpressionisten gehörte sie zu
den führenden Privatsammlungen Ungarns. Zu
den Glanzstücken zählen heute -— die bekann-
ten Stücke von Manet, Renoir, Cezanne wur-
den schon vor Jahren verkauft — Goyas „Ge-
hängter“ (um 1810) und das „Singende Paar“
von Daumier. Zeichnungen und Aquarelle der
Sammlung wären kürzlich auf der großen fran-
zösischen Handzeichnungen-Ausstellung des
Museums zu sehen. Dr. E. M. Hajos
Zur Ausstellung chinesischer
Malerei in Berlin
Die Vorarbeiten für die große Ausstellung
„Chinesische Malerei“ in der Akademie der
Künste sind in vollem Gange; sämtliche Räume
werden mit Gemälden gefüllt werden. Bei der
Eröffnung am 20. Januar sind außer den Vor-
trägen von Vertretern der deutschen Behörden
und Institutionen Ansprachen des neuen
Chinesischen Gesandten Liu Chung Chie, der
vor einigen Tagen in Berlin eingetroffen ist,
und des Kommissars der chinesischen Regie-
rung, des berühmten Malers Liu-Hai-Su, vor-
gesehen.
Der Louvre kauft ein deutsches
Kunstwerk
Nach Beendigung der großen Kollektivaus-
stellung von den Werken des Malers Christian
Rohlfs in der Galerie Vignon in Paris hat der
französische Staat eines der großen Blätter aus
dem Sommer 1933 erworben. Das sehr farbige
Aquarell, das ein Blumenstück darstellt, soll in
der modernen internationalen Abteilung des
Louvre (Jeu de Paume) seinen Platz finden.
Das Ausstellungsprogramm des
Berliner Kupferstichkabinetts
Im Laufe von mehr als 50 Jahren hat das
Kupferstichkabinett nur zweimal Gelegenheit
gehabt, seine Ausstellungsräume zu erweitern.
Es besaß im Vorraum zum Studiensaal und in
dem hinter diesem gelegenen kleinen Aus-
stellungssaal jahrzehntelang nur unzuläng-
liche Räume zur Veranstaltung von Wechsel-
ausstellungen, als es vor 30 Jahren durch die
Hinzunahme der anderen Hälfte des Oberge-
schosses des neuen Museums einen großen
Ausstellungsraum gewann, der aber bisher fast
ausschließlich für die Darbietungen aus dem
Gebiet der Graphik des 19. und 20. Jahrhun-
derts benutzt wurde. Da das Schwergewicht
der Sammlung aber gar nicht in der Kunst
des 19. Jahrhunderts — trotz der sehr großen
Bestände •—, sondern in dem überaus wert-
vollen Besitz an Zeichnungen, Druckgraphik,
Niederlande uni 1560—70, „Die Architektur“
Wacholderstatuette
„Das Bildwerk des Monats“ im
Deutschen Museum, Berlin
Buchmalereien aus der Zeit vor 1800 liegt, so
mußte darauf der Nachdruck gelegt werden.
So unbefriedigend die Ausstellungsverhält-
nisse im Kupferstichkabinett trotz allem sind,
wird man aus ihrer Unzulänglichkeit dadurch
gewisse Vorteile ziehen können, daß man die
Verstreutheit und Ungleichwertigkeit der
Räume zur Grundlage eines systematischen
Ausstellungsprogramms macht. Der große
Saal neben der Treppe soll alle drei Monate
eine Hauptausstellung zeigen, denen Neben-
ausstellungen an den anderen Stellen ergän-
zend zur Seite treten. Da auf diese Weise je-
weils bis zu 300 Objekte vorgeführt werden
können, besteht die Möglichkeit, die wertvoll-
sten Stücke des nach Hunderttausenden zäh-
lenden Bestandes in einem über mehrere Jahre
sich erstreckenden Plan gleichmäßig ‘zu er-
schließen.
Zeichnung und Druckkunst der germani-
schen Völker werden bei den nächsten Aus-
stellungen zuerst berücksichtigt werden, und
zwar in Gestalt eines Zyklus von fünf größe-
ren Ausstellungen, der die Hauptperioden der
Graphik bei den germanischen Völkern zum
Gegenstand hat.
Der Direktor des Kupferstichkabinetts, Dr.
F. Winkler, entwickelt das Programm sei-
ner Ausstellungen folgendermaßen:
Als erste Ausstellung der ,,K unst der nor-
dischen Völker und Stämme“ läuft die
der Meisterzeichnungen der großen Künstler der
Dürerzeit (1490 bis 1530). Sie umfaßt wohl den
kostbarsten Besitz der Sammlung (vgl. „Welt-
kunst“ VII, Nr. 42).
In der 2. Ausstellung wird die Blütezeit
des deutschen Holzschnitts und Kupferstiches, die
ungefähr dieselbe Zeitspanne wie die erste um-
faßt, folgen. Sie wird ergänzt durch eine Aus-
stellung sämtlicher Zyklen Dürers (Passionen,
Marienleben usw.) in allerbesten Drucken, von
Werken der Kleinmeister und der Anfänge der
Radierung aus der Dürerzeit.
Mit der 3. und 4. Ausstellung soll die hollän-
dische und die flämische Kunst zu ihrem Recht
kommen. Die meisten Zeichnungen der Rubens-
und Rembrandtzeit, die durch Veranstaltungen
aus der Blütezeit der altniederländischen Kunst
und ein Thema aus der Zeit des dreißigjährigen
Krieges ergänzt werden, werden besonders eine
Vorstellung Rembrandts und seiner Zeitgenossen
als Zeichner vermitteln, die bei uns hervorragend
vertreten sind. Sie wird gefolgt von einer Aus-
stellung von Meisterwerken der Radierung (Rem-
brandt und seine Zeit), bei der besonders schöne
Drucke gezeigt werden können.
Als 5. Veranstaltung ist die deutsche Graphik
des 19. Jahrhunderts, die eine neue Blüte er-
lebte, vorgesehen. Sie soll auf Bildnis und Land-
schaft als die Gebiete konzentriert sein, in denen
das 19. Jahrhundert besonders lebendig geblieben
ist. Hier bieten sich viele Themen als Begleit-
musik: der Kreis der Nazarener, die Figurenkunst,
des Peter Cornelius, Rethel und Schwind, Menzel
und die Berliner Künstler seiner Zeit und anderes
mehr.
Ein zweiter Zyklus hat sodann die Kunst
der romanischen Völker zu umfassen. Ihnen wer-
den Unternehmungen folgen, die die Interessen
der Kenner und Liebhaber berücksichtigen. Unter
den Gesichtspunkten „Seltenheiten und Glanz-
stücke“, „Meisterwerke des Buchholzschnitts und
der Buchmalerei“, „Deutsche Künstler im Aus-
lande“ vermag unsere Sammlung lehrreiche Zu-
sammenfassungen zu bieten, die durch den hohen
künstlerischen Wert der Gegenstände auch dem
Laien Genuß und Belehrung vermitteln werden..
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft
Auf der Jahresversammlung der Mitglieder
des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft
teilte der stellvertretende Vorsitzende, Exz.
Schmidt-Ott, mit, daß im Ausschuß der Geheime
Regierungsrat und ordentliche Professor an der
Universität München, Pinder, zum 1. Vor-
sitzenden gewählt sei. Erster stellvertretender
Vorsitzender Prof. Koetschau, kom. Direktor der-
Gemäldegalerie bei den Staatlichen Museen Ber-
lin. Die Berichterstattung liegt nach wie vor in
den Händen von Geh. Rat Falke.
Symbolik der chinesischen Kunst
In der „Gesellschaft für Ostasiatische Kunst“
sprach Prof. Ferdinand Lessing, Kustos am
Berliner Völkerkunde-Museum, der soeben von
seiner Reise nach China und der Mongolei zurück-
gekehrt ist, über die „Symbolsprache der chinesi-
schen Kunst“. Er führte aus, daß in China jede-
Darstellung und jedes Ornament spezifische sym-
bolische Bedeutung habe und zeigte an einer gro-
ßen Reihe von Beispielen im Lichtbild diese ge-
heimnisvolle Sprache der Sinnbilder.
Die Galerie v. d. Heyde, Berlin, eröffnet
am 14. Januar eine Ausstellung von Werner-
Berg, Rutarhof-Kärnten, der Gemälde, Aqua-
relle und Holzschnitte zum erstenmal in Berlin,
zeigt.
Münchener Künstlergenossenschaft
In der Win'terausstellung im alten National-
museum (Ständige Kunstausstellung) an der
Maximilianstraße wurden folgende Gemälde ver-
kauft: Otto Naegele „Am Ölberg“ und Bill Nagel
„Heimgarten“ (Staatsgalerie), Alfred Bachmann
„Nordsee“, Anton Bischoff „Glockenempfang“,
Paul Erbe „Staffelberge“, Karl Schünzel „Lichter
Tag“ und Alwin Stützer „Anemonen“ (Städtische
Galerie).
Personalien
Dr. K. T. Parker, Assistent am Print Room.
des Britischen Museums in London und Heraus-
geber der Zeitschrift „Old Master Drawings“,
wurde als Nachfolger von Kenneth Clark, der so-
eben sein Amt als Direktor der National Gallery
antrat, zum Direktor des Ashmolean Museum in
Oxford ernannt.
William Sloane Coffin, seit zwei Jahren Prä-
sident des Metropolitan Museums in New York,
ist gestorben.
Anton Hanak f. Mit Hanak, einem gebürtigen
Brünner, der am 6. Januar in Wien verstarb, ist
einer der größten modernen Bildhauer dahinge-
gangen. Besser als in den wenigen, zum Teil unter
Kompromissen zur Ausführung gelangten Monu-
menten, dem „Nie wieder Krieg“-Denkmal am
Wiener Zentralfriedhof, dem Magna Mater-Brun-
nen der Kinderübernahmestelle der Stadt Wien,
dem Zuckerkandl-Denkmal in der Universität und
dem Denkmal der Republik, kommt seine Persön-
lichkeit in seinen idealen Einzelgestalten: „Er-
hebung“, ,,Der brennende Mensch“, „Das goldene
Lächeln“, „Der letzte Mensch“ u. a. zur Geltung-
Figuren, die sein Erleben der Epoche mit ihren
Leiden und Ergriffenheiten spiegeln — Hanak
dachte sie sich in einem der Beschaulichkeit und.
Selbstversenkung gewidmeten heiligen Hain,
einem „Niobiden-Hain“, wie er ihn nannte, aufge-
stellt —, und so auch der reinste Ausdruck seines
Innenlebens und seines Kunstwollens sind, dessen.
Ideal die klassische Antike (gesehen durch das
Medium der italienischen Frührenaissance) war.
Erst spät, ein Jahr vor seinem Tod, ein Sieben-
undfünfzigjähriger, hat Hanak, der als Lehrer am
der Wiener Kunstgewerbeschule wirkte, die Be-
rufung an die Akademie der bildenden Künste er-
halten. Und ein eigentümliches Verhängnis wollte
es auch, daß er die Fertigstellung des türkischen
Sicherheits-Denkmals in Angora, seiner bedeu-
tendsten Denkmalsschöpfung, nicht mehr erleben
sollte. St. P.-N.
Berichtilgung
In Nr. 1, 1934, ist bei der Unterschrift auf
S. 3 statt Christie & Co. versehentlich Sotheby
& Co. als Versteigerung der Familie noir-Vase
angegeben worden.
KUNSTAUKTION IN MÜNCHEN
26. und 27. Januar 1934
Bilder alter und neuerer Meister,
Antiquitäten, Keramik, Möbel, Gobelins, Orientteppiche, Plastik
aus dem Nachlass Dr. Heiland, Potsdam, Sammlungen Prof. Dr.Th. Landau, Berlin, und Dr.W.. in F.. u. a.B.
HUGO HELBING, MÜNCHEN, WAGMÜLLERSTRASSE 15
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kttnst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s c h. — Red.-Vertretungen fiir München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom. fcr. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Em/erständnis.d®s V?.rJaf8’aH8zags^8?jSch^® VAX^flhS-ntmmt
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
b durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. A. d. Nr. 2400. Druck H. S. Hermann G. m. b. H.. Berlin SW 19.
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Ni-, 2 vom 14. Januar 1934-
• •
Nachrichten von Überall
Römische Antike in der Schweiz
Die Arbeit des Basler Universitätsprofessors
Felix Stähelin, Die Schweiz in rö-
mischer Zeit (herausgegeben von der Stif-
tung Schnyder von Wartensee, Verlag Benno
Schwabe & Co., Basel) ist kurz nach ihrem Er-
scheinen (1929) schon in zweiter Auflage her-
ausgekommen und bildet heute das wohl auf
lange Zeit hinaus abschließende Werk für diese
überaus interessante Periode der Landes-
geschichte. Es handelt sich um eine Zeit von
rund fünf Jahrhunderten, von der entscheiden-
den Schlacht bei Bibrakte (78 v. Chr.) bis zum
endgültigen Rückzug der römischen Truppen
an den Südfuß der Alpen. Stähelin schreibt in
erster Linie die politische und Kulturgeschichte
dieser Zeit, allein er belegt seine Ausführungen
mit den wichtigsten Werken der Kunst, die sich
erhalten haben, so daß es nur einer geringen
Umstellung der Gesichtspunkte bedarf, um aus
diesem mit vollendeter Objektivität und souve-
räner Beherrschung der Materie geschriebenen
Buche das künstlerische Erbe sichtbar werden
zu lassen, das die Schweiz aus ihrer antiken
Periode sich erhalten hat.
Lassen wir in diesem kurzen Referat die
Frage nach der möglichen Unterscheidung
zwischen der eigentlichen Importkunst der
Römer und der einheimischen gallo-helvetischen
Kunst offen, so ergeben sich etwa vier Gruppen
von Werken, die für die Kunstgeschichte von
Interesse sind:
1. Die Plastiken und Geräte, die
meist aus dem Schutt der kultischen Gebäude
und der Villen ausgegraben wurden und mit
wenigen Ausnahmen — zu denen vor allem die
sechs herrlichen Fragmente im Museum Valeria
in Sitten gehören — der weitverzweigten
römischen „Kunstindustrie“ zuzurechnen sind.
Sie haben in das dünn besiedelte, kulturell
wenig entwickelte Land einen fernen Abglanz
griechischer Klassik hineingebracht.
2. Die Bodenmosaiken und Wand-
malereien, einst sehr zahlreich, heute nur
noch in wenigen Exemplaren erhalten, bezeugen
einen gewissen Wohlstand in den Städten, von
denen die von den Römern besonders begün-
stigte Hauptstadt Aventicum (Avenches) her-
vorragte. Die schönsten Exemplare finden sich
in dem Dorfe Bosceaz, einem einstigen Villen-
vorort des oppidum Urba (Orbe) in der West-
schweiz. Von den Wandmalereien sind keine
integren Denkmäler, nur noch Reste, erhalten.
3. Die Villen und öffentlichen
Gebäude, von denen die ersteren besonders
in der Umgebung wichtiger Militärstationen
wie Vindonissa (Windisch bei Brugg) sehr
zahlreich aufgedeckt wurden. Ihre Grundrisse
zeigen eine sehr gelagerte Form, mit zahl-
H ans Frohne, Figurenkomposition
(vgl. Ausstellungsbericht in Nr. 52/53, Jg. VII)
reichen Räumen, die meist auf einen durch-
gehenden Korridor münden. In einzelnen
Fällen (La Grange bei Genf) wird ein geradezu
üppiger Luxus sichtbar: Terrassen, Gärten,
kleine Kultstätten, Höfe usw., mit ausgedehn-
ten Heizanlagen.
4. Die Städte und Kastelle, heute
wohl die sichtbarsten Zeugnisse der Römer-
herrschaft, da mehrere Orte ihren Grundplan
bewahrt haben: Salodurmes (Solothurn), das
Castrum Rauracense (Kaiseraugst) —während
HERMANN NOACK
GEGR.1897 BILDGIESSEREI GEGR.1897
BERLIN-FRIEDENAU
FEHLERSTRASSE 8 / H3 RHEINGAU 133
GIESST FÜR
BARLACH • BELLING • DE FIORI - ESSER
GAUL-KLIMSCHKOLBEMARCKSSCHARFF
SCHEIBE • RENESINTENIS -TUAILLON U.A.
S PEZIALITÄT : WAC HS AUSSCHMELZUNG
einige Kastelle völlig ausgegraben wurden:
Irgenhausen, Eschenz, Yverdon u. a. Dabei
zeigt die Reihe dieser Anlagen, je mehr sie
sich dem Ende der Römerherrschaft nähert,
eine um so stärkere Hinwendung zur „irratio-
nalen“ Form des Mittelalters, so daß gerade
diese Schweizer Beispiele für die Geschichte
des Städtebaus von besonderem Interesse sind.
Die 180 Abbildungen des Stähelinschen
Werkes, das in seiner Verbindung von histo-
rischen, kulturhistorischen und sprachgeschicht-
lichen Tatsachen überaus spannend zu lesen
ist, werden durch vier wichtige Karten er-
gänzt: ein Plan des römischen Helvetien und
Rätien, und die Grundrisse der Ausgrabungen
der drei wichtigsten Orte Aventicum, Augusta
Raurica und Vindonissa. J. Gantner
Kunst in Budapest
Das neue „P arlam en t s - Mus eu m“,
eine Sammlung von Denkmälern der parlamen-
tarischen Geschichte des Landes, wurde vor
einiger Zeit im ungarischen Parlament am
Donau-Kai eröffnet. Dem Charakter der Samm-
lung entsprechend bestimmten die Auswahl des
Materials mehr historische als künstlerische
Gesichtspunkte, dennoch befinden sich daruntei-
— besonders auf dem Gebiet des Porträts —
auch manche Kunstwerke von Rang, so z. B.
eine Minister-Büste von Miklös Izsö, dem be-
deutendsten Bildhauer der 60er Jahre, ein
schönes Pastell von Joseph Rippl-Ronäi u. v. a.
Sehr interessant ist die große Sammlung
politischer Karikaturen, die von den 40er
Jahren an bis in die jüngste Zeit einen Über-
blick über die Entwicklung der ungarischen
Karikatur vermittelt.
Einer Übereinkunft zwischen dem Marzell
von N e m e s sehen Nachlaßverwalter und
Gläubigern mit der Leitung des Museums der
bildenden Künste zufolge, wurde aus dem
Nachlaß — entsprechend der testamentarischen
Bestimmung des Sammlers — eine Anzahl von
Gemälden, die für die ungarische Kunst-
geschichte besonders wichtig sind, dem Museum
überlassen. Ein Frühwerk Paul von Szinyei-
Merses, die bekannte „Schaukel“, sowie Werke
von Munkäcsy und Rippl-Rönai befinden sich
darunter. Mehrere der Gemälde befanden sich
schon seit längerer Zeit als Leihgaben in der
Neuen Abteilung des Museums.
Die seit langem geplante Versteigerung der
bekannten Sammlung Baron Adolf K o h n e r s
— aus der übrigens schon in den letzten Jahren
einige Stücke nach Berlin gelangt sind — ist
nun auf den Monat Februar festgelegt. Die
Sammlung umfaßte ursprünglich nur un-
garische Malerei und wurde später, hauntsäch-
lich in den letzten Vorkriegsjahren, durch fran-
zösische Kunst des XIX. Jahrhunderts be-
reichert. Eine Plastik-Sammlung mit wert-
vollen Renaissance-Bronzen kam noch hinzu.
Auf dem Gebiet der französischen Impressio-
nisten und Postimpressionisten gehörte sie zu
den führenden Privatsammlungen Ungarns. Zu
den Glanzstücken zählen heute -— die bekann-
ten Stücke von Manet, Renoir, Cezanne wur-
den schon vor Jahren verkauft — Goyas „Ge-
hängter“ (um 1810) und das „Singende Paar“
von Daumier. Zeichnungen und Aquarelle der
Sammlung wären kürzlich auf der großen fran-
zösischen Handzeichnungen-Ausstellung des
Museums zu sehen. Dr. E. M. Hajos
Zur Ausstellung chinesischer
Malerei in Berlin
Die Vorarbeiten für die große Ausstellung
„Chinesische Malerei“ in der Akademie der
Künste sind in vollem Gange; sämtliche Räume
werden mit Gemälden gefüllt werden. Bei der
Eröffnung am 20. Januar sind außer den Vor-
trägen von Vertretern der deutschen Behörden
und Institutionen Ansprachen des neuen
Chinesischen Gesandten Liu Chung Chie, der
vor einigen Tagen in Berlin eingetroffen ist,
und des Kommissars der chinesischen Regie-
rung, des berühmten Malers Liu-Hai-Su, vor-
gesehen.
Der Louvre kauft ein deutsches
Kunstwerk
Nach Beendigung der großen Kollektivaus-
stellung von den Werken des Malers Christian
Rohlfs in der Galerie Vignon in Paris hat der
französische Staat eines der großen Blätter aus
dem Sommer 1933 erworben. Das sehr farbige
Aquarell, das ein Blumenstück darstellt, soll in
der modernen internationalen Abteilung des
Louvre (Jeu de Paume) seinen Platz finden.
Das Ausstellungsprogramm des
Berliner Kupferstichkabinetts
Im Laufe von mehr als 50 Jahren hat das
Kupferstichkabinett nur zweimal Gelegenheit
gehabt, seine Ausstellungsräume zu erweitern.
Es besaß im Vorraum zum Studiensaal und in
dem hinter diesem gelegenen kleinen Aus-
stellungssaal jahrzehntelang nur unzuläng-
liche Räume zur Veranstaltung von Wechsel-
ausstellungen, als es vor 30 Jahren durch die
Hinzunahme der anderen Hälfte des Oberge-
schosses des neuen Museums einen großen
Ausstellungsraum gewann, der aber bisher fast
ausschließlich für die Darbietungen aus dem
Gebiet der Graphik des 19. und 20. Jahrhun-
derts benutzt wurde. Da das Schwergewicht
der Sammlung aber gar nicht in der Kunst
des 19. Jahrhunderts — trotz der sehr großen
Bestände •—, sondern in dem überaus wert-
vollen Besitz an Zeichnungen, Druckgraphik,
Niederlande uni 1560—70, „Die Architektur“
Wacholderstatuette
„Das Bildwerk des Monats“ im
Deutschen Museum, Berlin
Buchmalereien aus der Zeit vor 1800 liegt, so
mußte darauf der Nachdruck gelegt werden.
So unbefriedigend die Ausstellungsverhält-
nisse im Kupferstichkabinett trotz allem sind,
wird man aus ihrer Unzulänglichkeit dadurch
gewisse Vorteile ziehen können, daß man die
Verstreutheit und Ungleichwertigkeit der
Räume zur Grundlage eines systematischen
Ausstellungsprogramms macht. Der große
Saal neben der Treppe soll alle drei Monate
eine Hauptausstellung zeigen, denen Neben-
ausstellungen an den anderen Stellen ergän-
zend zur Seite treten. Da auf diese Weise je-
weils bis zu 300 Objekte vorgeführt werden
können, besteht die Möglichkeit, die wertvoll-
sten Stücke des nach Hunderttausenden zäh-
lenden Bestandes in einem über mehrere Jahre
sich erstreckenden Plan gleichmäßig ‘zu er-
schließen.
Zeichnung und Druckkunst der germani-
schen Völker werden bei den nächsten Aus-
stellungen zuerst berücksichtigt werden, und
zwar in Gestalt eines Zyklus von fünf größe-
ren Ausstellungen, der die Hauptperioden der
Graphik bei den germanischen Völkern zum
Gegenstand hat.
Der Direktor des Kupferstichkabinetts, Dr.
F. Winkler, entwickelt das Programm sei-
ner Ausstellungen folgendermaßen:
Als erste Ausstellung der ,,K unst der nor-
dischen Völker und Stämme“ läuft die
der Meisterzeichnungen der großen Künstler der
Dürerzeit (1490 bis 1530). Sie umfaßt wohl den
kostbarsten Besitz der Sammlung (vgl. „Welt-
kunst“ VII, Nr. 42).
In der 2. Ausstellung wird die Blütezeit
des deutschen Holzschnitts und Kupferstiches, die
ungefähr dieselbe Zeitspanne wie die erste um-
faßt, folgen. Sie wird ergänzt durch eine Aus-
stellung sämtlicher Zyklen Dürers (Passionen,
Marienleben usw.) in allerbesten Drucken, von
Werken der Kleinmeister und der Anfänge der
Radierung aus der Dürerzeit.
Mit der 3. und 4. Ausstellung soll die hollän-
dische und die flämische Kunst zu ihrem Recht
kommen. Die meisten Zeichnungen der Rubens-
und Rembrandtzeit, die durch Veranstaltungen
aus der Blütezeit der altniederländischen Kunst
und ein Thema aus der Zeit des dreißigjährigen
Krieges ergänzt werden, werden besonders eine
Vorstellung Rembrandts und seiner Zeitgenossen
als Zeichner vermitteln, die bei uns hervorragend
vertreten sind. Sie wird gefolgt von einer Aus-
stellung von Meisterwerken der Radierung (Rem-
brandt und seine Zeit), bei der besonders schöne
Drucke gezeigt werden können.
Als 5. Veranstaltung ist die deutsche Graphik
des 19. Jahrhunderts, die eine neue Blüte er-
lebte, vorgesehen. Sie soll auf Bildnis und Land-
schaft als die Gebiete konzentriert sein, in denen
das 19. Jahrhundert besonders lebendig geblieben
ist. Hier bieten sich viele Themen als Begleit-
musik: der Kreis der Nazarener, die Figurenkunst,
des Peter Cornelius, Rethel und Schwind, Menzel
und die Berliner Künstler seiner Zeit und anderes
mehr.
Ein zweiter Zyklus hat sodann die Kunst
der romanischen Völker zu umfassen. Ihnen wer-
den Unternehmungen folgen, die die Interessen
der Kenner und Liebhaber berücksichtigen. Unter
den Gesichtspunkten „Seltenheiten und Glanz-
stücke“, „Meisterwerke des Buchholzschnitts und
der Buchmalerei“, „Deutsche Künstler im Aus-
lande“ vermag unsere Sammlung lehrreiche Zu-
sammenfassungen zu bieten, die durch den hohen
künstlerischen Wert der Gegenstände auch dem
Laien Genuß und Belehrung vermitteln werden..
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft
Auf der Jahresversammlung der Mitglieder
des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft
teilte der stellvertretende Vorsitzende, Exz.
Schmidt-Ott, mit, daß im Ausschuß der Geheime
Regierungsrat und ordentliche Professor an der
Universität München, Pinder, zum 1. Vor-
sitzenden gewählt sei. Erster stellvertretender
Vorsitzender Prof. Koetschau, kom. Direktor der-
Gemäldegalerie bei den Staatlichen Museen Ber-
lin. Die Berichterstattung liegt nach wie vor in
den Händen von Geh. Rat Falke.
Symbolik der chinesischen Kunst
In der „Gesellschaft für Ostasiatische Kunst“
sprach Prof. Ferdinand Lessing, Kustos am
Berliner Völkerkunde-Museum, der soeben von
seiner Reise nach China und der Mongolei zurück-
gekehrt ist, über die „Symbolsprache der chinesi-
schen Kunst“. Er führte aus, daß in China jede-
Darstellung und jedes Ornament spezifische sym-
bolische Bedeutung habe und zeigte an einer gro-
ßen Reihe von Beispielen im Lichtbild diese ge-
heimnisvolle Sprache der Sinnbilder.
Die Galerie v. d. Heyde, Berlin, eröffnet
am 14. Januar eine Ausstellung von Werner-
Berg, Rutarhof-Kärnten, der Gemälde, Aqua-
relle und Holzschnitte zum erstenmal in Berlin,
zeigt.
Münchener Künstlergenossenschaft
In der Win'terausstellung im alten National-
museum (Ständige Kunstausstellung) an der
Maximilianstraße wurden folgende Gemälde ver-
kauft: Otto Naegele „Am Ölberg“ und Bill Nagel
„Heimgarten“ (Staatsgalerie), Alfred Bachmann
„Nordsee“, Anton Bischoff „Glockenempfang“,
Paul Erbe „Staffelberge“, Karl Schünzel „Lichter
Tag“ und Alwin Stützer „Anemonen“ (Städtische
Galerie).
Personalien
Dr. K. T. Parker, Assistent am Print Room.
des Britischen Museums in London und Heraus-
geber der Zeitschrift „Old Master Drawings“,
wurde als Nachfolger von Kenneth Clark, der so-
eben sein Amt als Direktor der National Gallery
antrat, zum Direktor des Ashmolean Museum in
Oxford ernannt.
William Sloane Coffin, seit zwei Jahren Prä-
sident des Metropolitan Museums in New York,
ist gestorben.
Anton Hanak f. Mit Hanak, einem gebürtigen
Brünner, der am 6. Januar in Wien verstarb, ist
einer der größten modernen Bildhauer dahinge-
gangen. Besser als in den wenigen, zum Teil unter
Kompromissen zur Ausführung gelangten Monu-
menten, dem „Nie wieder Krieg“-Denkmal am
Wiener Zentralfriedhof, dem Magna Mater-Brun-
nen der Kinderübernahmestelle der Stadt Wien,
dem Zuckerkandl-Denkmal in der Universität und
dem Denkmal der Republik, kommt seine Persön-
lichkeit in seinen idealen Einzelgestalten: „Er-
hebung“, ,,Der brennende Mensch“, „Das goldene
Lächeln“, „Der letzte Mensch“ u. a. zur Geltung-
Figuren, die sein Erleben der Epoche mit ihren
Leiden und Ergriffenheiten spiegeln — Hanak
dachte sie sich in einem der Beschaulichkeit und.
Selbstversenkung gewidmeten heiligen Hain,
einem „Niobiden-Hain“, wie er ihn nannte, aufge-
stellt —, und so auch der reinste Ausdruck seines
Innenlebens und seines Kunstwollens sind, dessen.
Ideal die klassische Antike (gesehen durch das
Medium der italienischen Frührenaissance) war.
Erst spät, ein Jahr vor seinem Tod, ein Sieben-
undfünfzigjähriger, hat Hanak, der als Lehrer am
der Wiener Kunstgewerbeschule wirkte, die Be-
rufung an die Akademie der bildenden Künste er-
halten. Und ein eigentümliches Verhängnis wollte
es auch, daß er die Fertigstellung des türkischen
Sicherheits-Denkmals in Angora, seiner bedeu-
tendsten Denkmalsschöpfung, nicht mehr erleben
sollte. St. P.-N.
Berichtilgung
In Nr. 1, 1934, ist bei der Unterschrift auf
S. 3 statt Christie & Co. versehentlich Sotheby
& Co. als Versteigerung der Familie noir-Vase
angegeben worden.
KUNSTAUKTION IN MÜNCHEN
26. und 27. Januar 1934
Bilder alter und neuerer Meister,
Antiquitäten, Keramik, Möbel, Gobelins, Orientteppiche, Plastik
aus dem Nachlass Dr. Heiland, Potsdam, Sammlungen Prof. Dr.Th. Landau, Berlin, und Dr.W.. in F.. u. a.B.
HUGO HELBING, MÜNCHEN, WAGMÜLLERSTRASSE 15
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kttnst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s c h. — Red.-Vertretungen fiir München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom. fcr. Rein-
both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Em/erständnis.d®s V?.rJaf8’aH8zags^8?jSch^® VAX^flhS-ntmmt
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
b durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. A. d. Nr. 2400. Druck H. S. Hermann G. m. b. H.. Berlin SW 19.