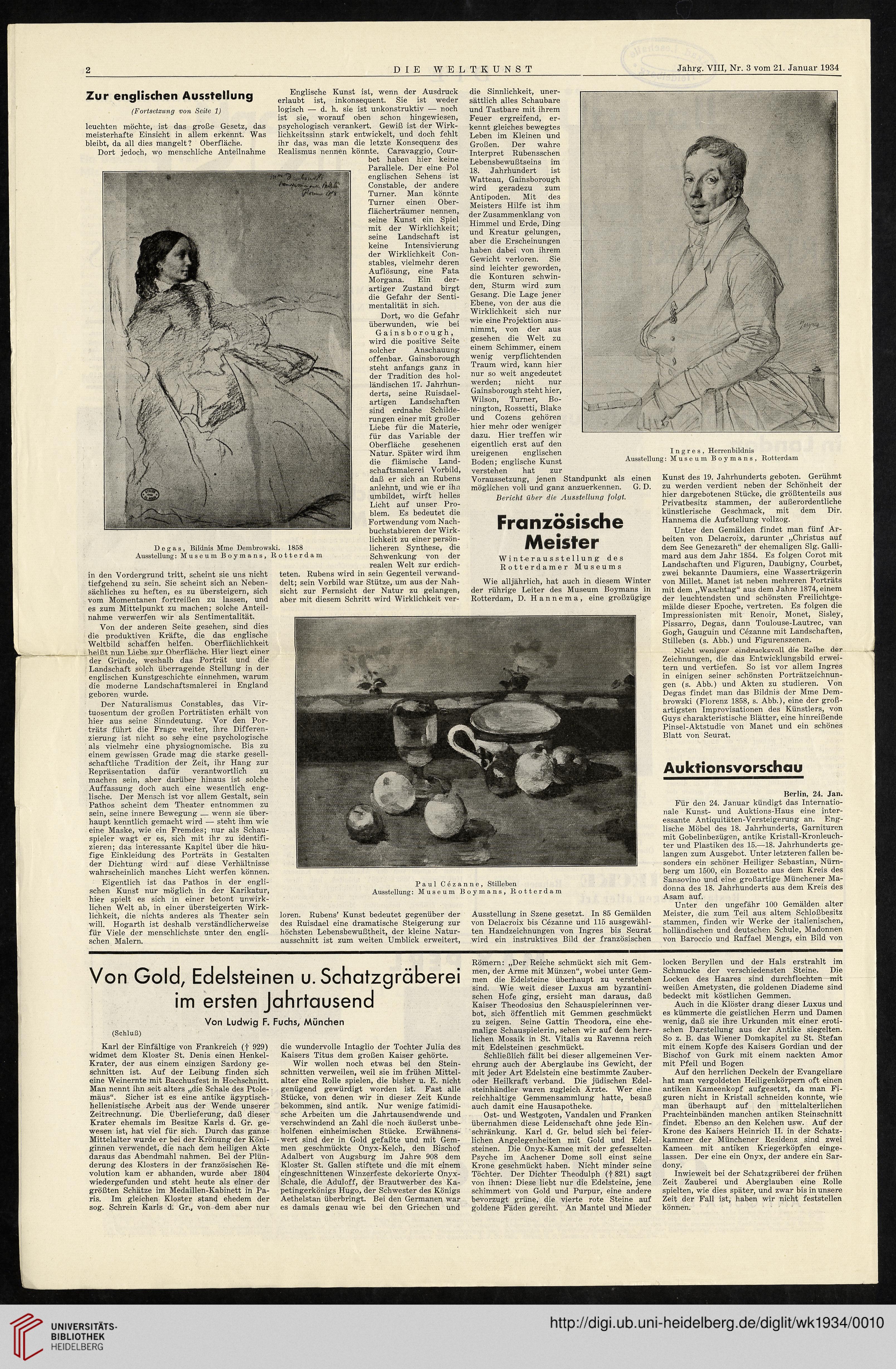2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 3 vom 21. Januar 1934
Zur englischen Ausstellung
(Fortsetzung von Seite 1)
leuchten möchte, ist das große Gesetz, das
meisterhafte Einsicht in allem erkennt. Was
bleibt, da all dies mangelt? Oberfläche.
Dort jedoch, wo menschliche Anteilnahme
Englische Kunst ist, wenn der Ausdruck
erlaubt ist, inkonsequent. Sie ist weder
logisch — d. h. sie ist unkonstruktiv — noch
ist sie, worauf oben schon hingewiesen,
psychologisch verankert. Gewiß ist der Wirk-
lichkeitssinn stark entwickelt, und doch fehlt
ihr das, was man die letzte Konsequenz des
Realismus nennen könnte. Caravaggio, Cour-
bet haben hier keine
Parallele. Der eine Pol
deren
Fata
der-
birgt
Senti-
andere
könnte
Ober-
nennen,
in den Vordergrund tritt, scheint sie uns nicht
tiefgehend zu sein. Sie scheint sich an Neben-
sächliches zu heften, es zu übersteigern, sich
vom Momentanen fortreißen zu lassen, und
es zum Mittelpunkt zu machen; solche Anteil-
nahme verwerfen wir als Sentimentalität.
Von der anderen Seite gesehen, sind dies
die produktiven Kräfte, die das englische
Weltbild schaffen helfen. Oberflächlichkeit
heißt nun Liebe zpr Oberfläche. Hier liegt einer
der Gründe, weshalb das Porträt und die
Landschaft solch überragende Stellung in der
englischen Kunstgeschichte einnehmen, warum
die moderne Landschaftsmalerei in England
geboren wurde.
Der Naturalismus Constables, das Vir-
tuosentum der großen Porträtisten erhält von
hier aus seine Sinndeutung. Vor den Por-
träts führt die Frage weiter, ihre Differen-
zierung ist nicht so sehr eine psychologische
als vielmehr eine physiognomische. Bis zu
einem gewissen Grade mag die starke gesell-
schaftliche Tradition der Zeit, ihr Hang zur
Repräsentation dafür verantwortlich zu
machen sein, aber darüber hinaus ist solche
Auffassung doch auch eine wesentlich eng-
lische. Der Mensch ist vor allem Gestalt, sein
Pathos scheint dem Theater entnommen zu
sein, seine innere Bewegung — wenn sie über-
haupt kenntlich gemacht wird — steht ihm wie
eine Maske, wie ein Fremdes; nur als Schau-
spieler wagt er es, sich mit ihr zu identifi-
zieren; das interessante Kapitel über die häu-
fige Einkleidung des Porträts in Gestalten
der Dichtung wird auf diese Verhältnisse
wahrscheinlich manches Licht werfen können.
Degas, Bildnis Mme Dembrowski. 1858
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
englischen Sehens ist
Constable, der
Turner. Man
Turner einen
flächerträumer
seine Kunst ein Spiel
mit der Wirklichkeit;
seine Landschaft ist
keine Intensivierung
der Wirklichkeit Con-
stables, vielmehr
Auflösung, eine
Morgana. Ein
artiger Zustand
die Gefahr der
mentalität in sich.
Dort, wo die Gefahr
überwunden, wie bei
Gainsborough,
wird die positive Seite
solcher Anschauung
offenbar. Gainsborough
steht anfangs ganz in
der Tradition des hol-
ländischen 17. Jahrhun-
derts, seine Ruisdael-
artigen Landschaften
sind erdnahe Schilde-
rungen einer mit großer
Liebe für die Materie,
für das Variable der
Oberfläche gesehenen
Natur. Später wird ihm
die flämische Land-
schaftsmalerei Vorbild,
daß er sich an Rubens
anlehnt, und wie er ihn
umbildet, wirft helles
Licht auf unser Pro-
blem. Es bedeutet die
Fortwendung vom Nach-
buchstabieren der Wirk-
lichkeit zu einer persön-
licheren Synthese, die
Schwenkung von der
realen Welt zur erdich-
teten. Rubens wird in sein Gegenteil verwand-
delt; sein Vorbild war Stütze, um aus der Nah-
sicht zur Fernsicht der Natur zu gelangen,
aber mit diesem Schritt wird Wirklichkeit ver-
Paul Cezanne, Stilleben
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
Eigentlich ist das Pathos in der engli-
schen Kunst nur möglich in der Karikatur,
hier spielt es sich in einer betont unwirk-
lichen Welt ab, in einer übersteigerten Wirk-
lichkeit, die nichts anderes als Theater sein
will. Hogarth ist deshalb verständlicherweise
für Viele der menschlichste unter den engli-
schen Malern.
loren. Rubens’ Kunst bedeutet gegenüber der
des Ruisdael eine dramatische Steigerung zur
höchsten Lebensbewußtheit, der kleine Natur-
ausschnitt ist zum weiten Umblick erweitert,
Ausstellung in Szene gesetzt. In 85 Gemälden
von Delacroix bis Cezanne und 115 ausgewähl-
ten Handzeichnungen von Ingres bis Seurat
wird ein instruktives Bild der französischen
Dir.
Ar-
auf
einen
G. D.
Wie alljährlich, hat auch in diesem Winter
der rührige Leiter des Museum Boymans in
Rotterdam, D. Hannema, eine großzügige
Ingres, Horrenbildnis
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
die Sinnlichkeit, uner¬
sättlich alles Schaubare
und Tastbare mit ihrem
Feuer ergreifend, er-
kennt gleiches bewegtes
Leben im Kleinen und
Großen. Der wahre
Interpret Rubensschen
Lebensbewußtseins im
18. Jahrhundert ist
Watteau, Gainsborough
wird geradezu zum
Antipoden. Mit des
Meisters Hilfe ist ihm
der Zusammenklang von
Himmel und Erde, Ding
und Kreatur gelungen,
aber die Erscheinungen
haben dabei von ihrem
Gewicht verloren. Sie
sind leichter geworden,
die Konturen schwin¬
den, Sturm wird zum
Gesang. Die Lage jener
Ebene, von der aus die
Wirklichkeit sich nur
wie eine Projektion aus-
nimmt, von der aus
gesehen die Welt zu
einem Schimmer, einem
wenig verpflichtenden
Traum wird, kann hier
nur so weit angedeutet
werden; nicht nur
Gainsborough steht hier,
Wilson, Turner, Bo-
nington, Rossetti, Blake
und Cozens gehören
hier mehr oder weniger
dazu. Hier treffen wir
eigentlich erst auf den
ureigenen englischen
Boden; englische Kunst J
verstehen hat zur
Voraussetzung, jenen Standpunkt als
möglichen voll und ganz anzuerkennen.
Bericht über die Ausstellung folgt.
Kunst des 19. Jahrhunderts geboten. Gerühmt
zu werden verdient neben der Schönheit der
hier dargebotenen Stücke, die größtenteils aus
Privatbesitz stammen, der außerordentliche
künstlerische Geschmack, mit dem
Hannema die Aufstellung vollzog.
Unter den Gemälden findet man fünf
beiten von Delacroix, darunter „Christus
dem See Genezareth“ der ehemaligen Slg. Galli-
mard aus dem Jahr 1854. Es folgen Corot mit
Landschaften und Figuren, Daubigny, Courbet,
zwei bekannte Daumiers, eine Wasserträgerin
von Millet. Manet ist neben mehreren Porträts
mit dem „Waschtag“ aus dem Jahre 1874, einem
der leuchtendsten und schönsten Freilichtge-
mälde dieser Epoche, vertreten. Es folgen die
Impressionisten mit Renoir, Monet, Sisley,
Pissarro, Degas, dann Toulouse-Lautrec, van
Gogh, Gauguin und Cezanne mit Landschaften,
Stilleben (s. Abb.) und Figurenszenen.
Nicht weniger eindrucksvoll die Reihe der
Zeichnungen, die das Entwicklungsbild erwei-
tern und vertiefen. So ist vor allem Ingres
in einigen seiner schönsten Porträtzeichnun-
gen (s. Abb.) und Akten zu studieren. Von
Degas findet man das Bildnis der Mme Dem-
browski (Florenz 1858, s. Abb.), eine der groß-
artigsten Improvisationen des Künstlers, von
Guys charakteristische Blätter, eine hinreißende
Pinsel-Aktstudie von Manet und ein schönes
Blatt von Seurat.
Französische
Meister
Win t.e raus stellun g des
Rotterdamer Museums
Auktionsvorschau
Berlin, 24. Jan.
Für den 24. Januar kündigt das Internatio-
nale Kunst- und Auktions-Haus eine inter-
essante Antiquitäten-Versteigerung an. Eng-
lische Möbel des 18. Jahrhunderts, Garnituren
mit Gobelinbezügen, antike Kristall-Kronleuch-
ter und Plastiken des 15.—18. Jahrhunderts ge-
langen zum Ausgebot. Unter letzteren fallen be-
sonders ein schöner Heiliger Sebastian, Nürn-
berg um 1500, ein Bozzetto aus dem Kreis des
Sansovino und eine großartige Münchener Ma-
donna des 18. Jahrhunderts aus dem Kreis des
Asam auf.
Unter den ungefähr 100' Gemälden alter
Meister, die zum Teil aus altem Schloßbesitz
stammen, finden wir Werke der italienischen,
holländischen und deutschen Schule, Madonnen
von Baroccio und Raffael Mengs, ein Bild von
Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend
Von Ludwig F. Fuchs, München
(Schluß)
Karl der Einfältige von Frankreich (f 929)
widmet dem Kloster St. Denis einen Henkel-
Krater, der aus einem einzigen Sardony ge-
schnitten ist. Auf der Leibung finden sich
eine Weinernte mit Bacchusfest in Hochschnitt.
Man nennt ihn seit alters „die Schale des Ptole-
mäus“. Sicher ist es eine antike ägyptisch-
hellenistische .Arbeit aus der Wende unserer
Zeitrechnung. Die Überlieferung, daß dieser
Krater ehemals im Besitze Karls d. Gr. ge-
wesen ist, hat viel für sich. Durch das ganze
Mittelalter wurde er bei der Krönung der Köni-
ginnen verwendet, die nach dem heiligen Akte
daraus das Abendmahl nahmen. Bei der Plün-
derung des Klosters in der französischen Re-
volution kam er abhanden, wurde aber 1804
wiedergefunden und steht heute als einer der
größten Schätze im Medaillen-Kabinett in Pa-
ris. Im gleichen Kloster stand ehedem der
sog. Schrein Karls d. Gr., von dem aber nur
die wundervolle Intaglio der Tochter Julia des
Kaisers Titus dem großen Kaiser gehörte.
Wir wollen noch etwas bei den Stein-
schnitten verweilen, weil sie im frühen Mittel-
alter eine Rolle spielen, die bisher u. E. nicht
genügend gewürdigt worden ist. Fast alle
Stücke, von denen wir in dieser Zeit Kunde
bekommen, sind antik. Nur wenige fatimidi-
sche Arbeiten um die Jahrtausendwende und
verschwindend an Zahl die noch äußerst unbe-
holfenen einheimischen Stücke. Erwähnens-
wert sind der in Gold gefaßte und mit Gem-
men geschmückte Onyx-Kelch, den Bischof
Adalbert von Augsburg im Jahre 908 dem
Kloster St. Gallen stiftete und die mit einem
eingeschnittenen Winzerfeste dekorierte Onyx-
Schale, die Aduloff, der Brautwerber des Ka-
petingerkönigs Hugo, der Schwester des Königs
Aethelstan überbringt. Bei den Germanen war
es damals genau wie bei den Griechen und
Römern: „Der Reiche schmückt sich mit Gem-
men, der Arme mit Münzen“, wobei unter Gem-
men die Edelsteine überhaupt zu verstehen
sind. Wie weit dieser Luxus am byzantini-
schen Hofe ging, ersieht man daraus, daß
Kaiser Theodosius den Schauspielerinnen ver-
bot, sich öffentlich mit Gemmen geschmückt
zu zeigen. Seine Gattin Theodora, eine ehe-
malige Schauspielerin, sehen wir auf dem herr-
lichen Mosaik in St. Vitalis zu Ravenna reich
mit Edelsteinen geschmückt.
Schließlich fällt bei dieser allgemeinen Ver-
ehrung auch der Aberglaube ins Gewicht, der
mit jeder Art Edelstein eine bestimmte Zauber-
oder Heilkraft verband. Die jüdischen Edel-
steinhändler waren zugleich Ärzte. Wer eine
reichhaltige Gemmensammlung hatte, besaß
auch damit eine Hausapotheke.
Ost- und Westgoten, Vandalen und Franken
übernahmen diese Leidenschaft ohne jede Ein-
schränkung. Karl d. Gr. belud sich bei feier-
lichen Angelegenheiten mit Gold und Edel-
steinen. Die Onyx-Kamee mit der gefesselten
Psyche im Aachener Dome soll einst seine
Krone geschmückt haben. Nicht minder seine
Töchter. Der Dichter Theodulph (f 821) sagt
von ihnen: Diese liebt nur die Edelsteine, jene
schimmert von Gold und Purpur, eine andere
bevorzugt grüne, die vierte rote Steine auf
goldene Fäden gereiht. An Mantel und Mieder
locken Beryllen und der Hals erstrahlt im
Schmucke der verschiedensten Steine. Die
Locken des Haares sind durchflochten mit
weißen Ametysten, die goldenen Diademe sind
bedeckt mit köstlichen Gemmen.
Auch in die Klöster drang dieser Luxus und
es kümmerte die geistlichen Herrn und Damen
wenig, daß sie ihre Urkunden mit einer eroti-
schen Darstellung aus der Antike siegelten.
So z. B. das Wiener Domkapitel zu St. Stefan
mit einem Kopfe des Kaisers Gordian und der
Bischof von Gurk mit einem nackten Amor
mit Pfeil und Bogen
Auf den herrlichen Deckeln der Evangeliare
hat man vergoldeten Heiligenkörpern oft einen
antiken Kameenkopf aufgesetzt, da man Fi-
guren nicht in Kristall schneiden konnte, wie
man überhaupt auf den mittelalterlichen
Prachteinbänden manchen antiken Steinschnitt
findet. Ebenso an den Kelchen usw. Auf der
Krone des Kaisers Heinrich II. in der Schatz-
kammer der Münchener Residenz sind zwei
Kameen mit antiken Kriegerköpfen einge-
lassen. Der eine ein Onyx, der andere ein Sar-
dony.
Inwieweit bei der Schatzgräberei der frühen
Zeit Zauberei und Aberglauben eine Rolle
spielten, wie dies später, und zwar bis in unsere
Zeit der Fall ist, haben wir nicht feststellen
können.
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 3 vom 21. Januar 1934
Zur englischen Ausstellung
(Fortsetzung von Seite 1)
leuchten möchte, ist das große Gesetz, das
meisterhafte Einsicht in allem erkennt. Was
bleibt, da all dies mangelt? Oberfläche.
Dort jedoch, wo menschliche Anteilnahme
Englische Kunst ist, wenn der Ausdruck
erlaubt ist, inkonsequent. Sie ist weder
logisch — d. h. sie ist unkonstruktiv — noch
ist sie, worauf oben schon hingewiesen,
psychologisch verankert. Gewiß ist der Wirk-
lichkeitssinn stark entwickelt, und doch fehlt
ihr das, was man die letzte Konsequenz des
Realismus nennen könnte. Caravaggio, Cour-
bet haben hier keine
Parallele. Der eine Pol
deren
Fata
der-
birgt
Senti-
andere
könnte
Ober-
nennen,
in den Vordergrund tritt, scheint sie uns nicht
tiefgehend zu sein. Sie scheint sich an Neben-
sächliches zu heften, es zu übersteigern, sich
vom Momentanen fortreißen zu lassen, und
es zum Mittelpunkt zu machen; solche Anteil-
nahme verwerfen wir als Sentimentalität.
Von der anderen Seite gesehen, sind dies
die produktiven Kräfte, die das englische
Weltbild schaffen helfen. Oberflächlichkeit
heißt nun Liebe zpr Oberfläche. Hier liegt einer
der Gründe, weshalb das Porträt und die
Landschaft solch überragende Stellung in der
englischen Kunstgeschichte einnehmen, warum
die moderne Landschaftsmalerei in England
geboren wurde.
Der Naturalismus Constables, das Vir-
tuosentum der großen Porträtisten erhält von
hier aus seine Sinndeutung. Vor den Por-
träts führt die Frage weiter, ihre Differen-
zierung ist nicht so sehr eine psychologische
als vielmehr eine physiognomische. Bis zu
einem gewissen Grade mag die starke gesell-
schaftliche Tradition der Zeit, ihr Hang zur
Repräsentation dafür verantwortlich zu
machen sein, aber darüber hinaus ist solche
Auffassung doch auch eine wesentlich eng-
lische. Der Mensch ist vor allem Gestalt, sein
Pathos scheint dem Theater entnommen zu
sein, seine innere Bewegung — wenn sie über-
haupt kenntlich gemacht wird — steht ihm wie
eine Maske, wie ein Fremdes; nur als Schau-
spieler wagt er es, sich mit ihr zu identifi-
zieren; das interessante Kapitel über die häu-
fige Einkleidung des Porträts in Gestalten
der Dichtung wird auf diese Verhältnisse
wahrscheinlich manches Licht werfen können.
Degas, Bildnis Mme Dembrowski. 1858
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
englischen Sehens ist
Constable, der
Turner. Man
Turner einen
flächerträumer
seine Kunst ein Spiel
mit der Wirklichkeit;
seine Landschaft ist
keine Intensivierung
der Wirklichkeit Con-
stables, vielmehr
Auflösung, eine
Morgana. Ein
artiger Zustand
die Gefahr der
mentalität in sich.
Dort, wo die Gefahr
überwunden, wie bei
Gainsborough,
wird die positive Seite
solcher Anschauung
offenbar. Gainsborough
steht anfangs ganz in
der Tradition des hol-
ländischen 17. Jahrhun-
derts, seine Ruisdael-
artigen Landschaften
sind erdnahe Schilde-
rungen einer mit großer
Liebe für die Materie,
für das Variable der
Oberfläche gesehenen
Natur. Später wird ihm
die flämische Land-
schaftsmalerei Vorbild,
daß er sich an Rubens
anlehnt, und wie er ihn
umbildet, wirft helles
Licht auf unser Pro-
blem. Es bedeutet die
Fortwendung vom Nach-
buchstabieren der Wirk-
lichkeit zu einer persön-
licheren Synthese, die
Schwenkung von der
realen Welt zur erdich-
teten. Rubens wird in sein Gegenteil verwand-
delt; sein Vorbild war Stütze, um aus der Nah-
sicht zur Fernsicht der Natur zu gelangen,
aber mit diesem Schritt wird Wirklichkeit ver-
Paul Cezanne, Stilleben
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
Eigentlich ist das Pathos in der engli-
schen Kunst nur möglich in der Karikatur,
hier spielt es sich in einer betont unwirk-
lichen Welt ab, in einer übersteigerten Wirk-
lichkeit, die nichts anderes als Theater sein
will. Hogarth ist deshalb verständlicherweise
für Viele der menschlichste unter den engli-
schen Malern.
loren. Rubens’ Kunst bedeutet gegenüber der
des Ruisdael eine dramatische Steigerung zur
höchsten Lebensbewußtheit, der kleine Natur-
ausschnitt ist zum weiten Umblick erweitert,
Ausstellung in Szene gesetzt. In 85 Gemälden
von Delacroix bis Cezanne und 115 ausgewähl-
ten Handzeichnungen von Ingres bis Seurat
wird ein instruktives Bild der französischen
Dir.
Ar-
auf
einen
G. D.
Wie alljährlich, hat auch in diesem Winter
der rührige Leiter des Museum Boymans in
Rotterdam, D. Hannema, eine großzügige
Ingres, Horrenbildnis
Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam
die Sinnlichkeit, uner¬
sättlich alles Schaubare
und Tastbare mit ihrem
Feuer ergreifend, er-
kennt gleiches bewegtes
Leben im Kleinen und
Großen. Der wahre
Interpret Rubensschen
Lebensbewußtseins im
18. Jahrhundert ist
Watteau, Gainsborough
wird geradezu zum
Antipoden. Mit des
Meisters Hilfe ist ihm
der Zusammenklang von
Himmel und Erde, Ding
und Kreatur gelungen,
aber die Erscheinungen
haben dabei von ihrem
Gewicht verloren. Sie
sind leichter geworden,
die Konturen schwin¬
den, Sturm wird zum
Gesang. Die Lage jener
Ebene, von der aus die
Wirklichkeit sich nur
wie eine Projektion aus-
nimmt, von der aus
gesehen die Welt zu
einem Schimmer, einem
wenig verpflichtenden
Traum wird, kann hier
nur so weit angedeutet
werden; nicht nur
Gainsborough steht hier,
Wilson, Turner, Bo-
nington, Rossetti, Blake
und Cozens gehören
hier mehr oder weniger
dazu. Hier treffen wir
eigentlich erst auf den
ureigenen englischen
Boden; englische Kunst J
verstehen hat zur
Voraussetzung, jenen Standpunkt als
möglichen voll und ganz anzuerkennen.
Bericht über die Ausstellung folgt.
Kunst des 19. Jahrhunderts geboten. Gerühmt
zu werden verdient neben der Schönheit der
hier dargebotenen Stücke, die größtenteils aus
Privatbesitz stammen, der außerordentliche
künstlerische Geschmack, mit dem
Hannema die Aufstellung vollzog.
Unter den Gemälden findet man fünf
beiten von Delacroix, darunter „Christus
dem See Genezareth“ der ehemaligen Slg. Galli-
mard aus dem Jahr 1854. Es folgen Corot mit
Landschaften und Figuren, Daubigny, Courbet,
zwei bekannte Daumiers, eine Wasserträgerin
von Millet. Manet ist neben mehreren Porträts
mit dem „Waschtag“ aus dem Jahre 1874, einem
der leuchtendsten und schönsten Freilichtge-
mälde dieser Epoche, vertreten. Es folgen die
Impressionisten mit Renoir, Monet, Sisley,
Pissarro, Degas, dann Toulouse-Lautrec, van
Gogh, Gauguin und Cezanne mit Landschaften,
Stilleben (s. Abb.) und Figurenszenen.
Nicht weniger eindrucksvoll die Reihe der
Zeichnungen, die das Entwicklungsbild erwei-
tern und vertiefen. So ist vor allem Ingres
in einigen seiner schönsten Porträtzeichnun-
gen (s. Abb.) und Akten zu studieren. Von
Degas findet man das Bildnis der Mme Dem-
browski (Florenz 1858, s. Abb.), eine der groß-
artigsten Improvisationen des Künstlers, von
Guys charakteristische Blätter, eine hinreißende
Pinsel-Aktstudie von Manet und ein schönes
Blatt von Seurat.
Französische
Meister
Win t.e raus stellun g des
Rotterdamer Museums
Auktionsvorschau
Berlin, 24. Jan.
Für den 24. Januar kündigt das Internatio-
nale Kunst- und Auktions-Haus eine inter-
essante Antiquitäten-Versteigerung an. Eng-
lische Möbel des 18. Jahrhunderts, Garnituren
mit Gobelinbezügen, antike Kristall-Kronleuch-
ter und Plastiken des 15.—18. Jahrhunderts ge-
langen zum Ausgebot. Unter letzteren fallen be-
sonders ein schöner Heiliger Sebastian, Nürn-
berg um 1500, ein Bozzetto aus dem Kreis des
Sansovino und eine großartige Münchener Ma-
donna des 18. Jahrhunderts aus dem Kreis des
Asam auf.
Unter den ungefähr 100' Gemälden alter
Meister, die zum Teil aus altem Schloßbesitz
stammen, finden wir Werke der italienischen,
holländischen und deutschen Schule, Madonnen
von Baroccio und Raffael Mengs, ein Bild von
Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei
im ersten Jahrtausend
Von Ludwig F. Fuchs, München
(Schluß)
Karl der Einfältige von Frankreich (f 929)
widmet dem Kloster St. Denis einen Henkel-
Krater, der aus einem einzigen Sardony ge-
schnitten ist. Auf der Leibung finden sich
eine Weinernte mit Bacchusfest in Hochschnitt.
Man nennt ihn seit alters „die Schale des Ptole-
mäus“. Sicher ist es eine antike ägyptisch-
hellenistische .Arbeit aus der Wende unserer
Zeitrechnung. Die Überlieferung, daß dieser
Krater ehemals im Besitze Karls d. Gr. ge-
wesen ist, hat viel für sich. Durch das ganze
Mittelalter wurde er bei der Krönung der Köni-
ginnen verwendet, die nach dem heiligen Akte
daraus das Abendmahl nahmen. Bei der Plün-
derung des Klosters in der französischen Re-
volution kam er abhanden, wurde aber 1804
wiedergefunden und steht heute als einer der
größten Schätze im Medaillen-Kabinett in Pa-
ris. Im gleichen Kloster stand ehedem der
sog. Schrein Karls d. Gr., von dem aber nur
die wundervolle Intaglio der Tochter Julia des
Kaisers Titus dem großen Kaiser gehörte.
Wir wollen noch etwas bei den Stein-
schnitten verweilen, weil sie im frühen Mittel-
alter eine Rolle spielen, die bisher u. E. nicht
genügend gewürdigt worden ist. Fast alle
Stücke, von denen wir in dieser Zeit Kunde
bekommen, sind antik. Nur wenige fatimidi-
sche Arbeiten um die Jahrtausendwende und
verschwindend an Zahl die noch äußerst unbe-
holfenen einheimischen Stücke. Erwähnens-
wert sind der in Gold gefaßte und mit Gem-
men geschmückte Onyx-Kelch, den Bischof
Adalbert von Augsburg im Jahre 908 dem
Kloster St. Gallen stiftete und die mit einem
eingeschnittenen Winzerfeste dekorierte Onyx-
Schale, die Aduloff, der Brautwerber des Ka-
petingerkönigs Hugo, der Schwester des Königs
Aethelstan überbringt. Bei den Germanen war
es damals genau wie bei den Griechen und
Römern: „Der Reiche schmückt sich mit Gem-
men, der Arme mit Münzen“, wobei unter Gem-
men die Edelsteine überhaupt zu verstehen
sind. Wie weit dieser Luxus am byzantini-
schen Hofe ging, ersieht man daraus, daß
Kaiser Theodosius den Schauspielerinnen ver-
bot, sich öffentlich mit Gemmen geschmückt
zu zeigen. Seine Gattin Theodora, eine ehe-
malige Schauspielerin, sehen wir auf dem herr-
lichen Mosaik in St. Vitalis zu Ravenna reich
mit Edelsteinen geschmückt.
Schließlich fällt bei dieser allgemeinen Ver-
ehrung auch der Aberglaube ins Gewicht, der
mit jeder Art Edelstein eine bestimmte Zauber-
oder Heilkraft verband. Die jüdischen Edel-
steinhändler waren zugleich Ärzte. Wer eine
reichhaltige Gemmensammlung hatte, besaß
auch damit eine Hausapotheke.
Ost- und Westgoten, Vandalen und Franken
übernahmen diese Leidenschaft ohne jede Ein-
schränkung. Karl d. Gr. belud sich bei feier-
lichen Angelegenheiten mit Gold und Edel-
steinen. Die Onyx-Kamee mit der gefesselten
Psyche im Aachener Dome soll einst seine
Krone geschmückt haben. Nicht minder seine
Töchter. Der Dichter Theodulph (f 821) sagt
von ihnen: Diese liebt nur die Edelsteine, jene
schimmert von Gold und Purpur, eine andere
bevorzugt grüne, die vierte rote Steine auf
goldene Fäden gereiht. An Mantel und Mieder
locken Beryllen und der Hals erstrahlt im
Schmucke der verschiedensten Steine. Die
Locken des Haares sind durchflochten mit
weißen Ametysten, die goldenen Diademe sind
bedeckt mit köstlichen Gemmen.
Auch in die Klöster drang dieser Luxus und
es kümmerte die geistlichen Herrn und Damen
wenig, daß sie ihre Urkunden mit einer eroti-
schen Darstellung aus der Antike siegelten.
So z. B. das Wiener Domkapitel zu St. Stefan
mit einem Kopfe des Kaisers Gordian und der
Bischof von Gurk mit einem nackten Amor
mit Pfeil und Bogen
Auf den herrlichen Deckeln der Evangeliare
hat man vergoldeten Heiligenkörpern oft einen
antiken Kameenkopf aufgesetzt, da man Fi-
guren nicht in Kristall schneiden konnte, wie
man überhaupt auf den mittelalterlichen
Prachteinbänden manchen antiken Steinschnitt
findet. Ebenso an den Kelchen usw. Auf der
Krone des Kaisers Heinrich II. in der Schatz-
kammer der Münchener Residenz sind zwei
Kameen mit antiken Kriegerköpfen einge-
lassen. Der eine ein Onyx, der andere ein Sar-
dony.
Inwieweit bei der Schatzgräberei der frühen
Zeit Zauberei und Aberglauben eine Rolle
spielten, wie dies später, und zwar bis in unsere
Zeit der Fall ist, haben wir nicht feststellen
können.