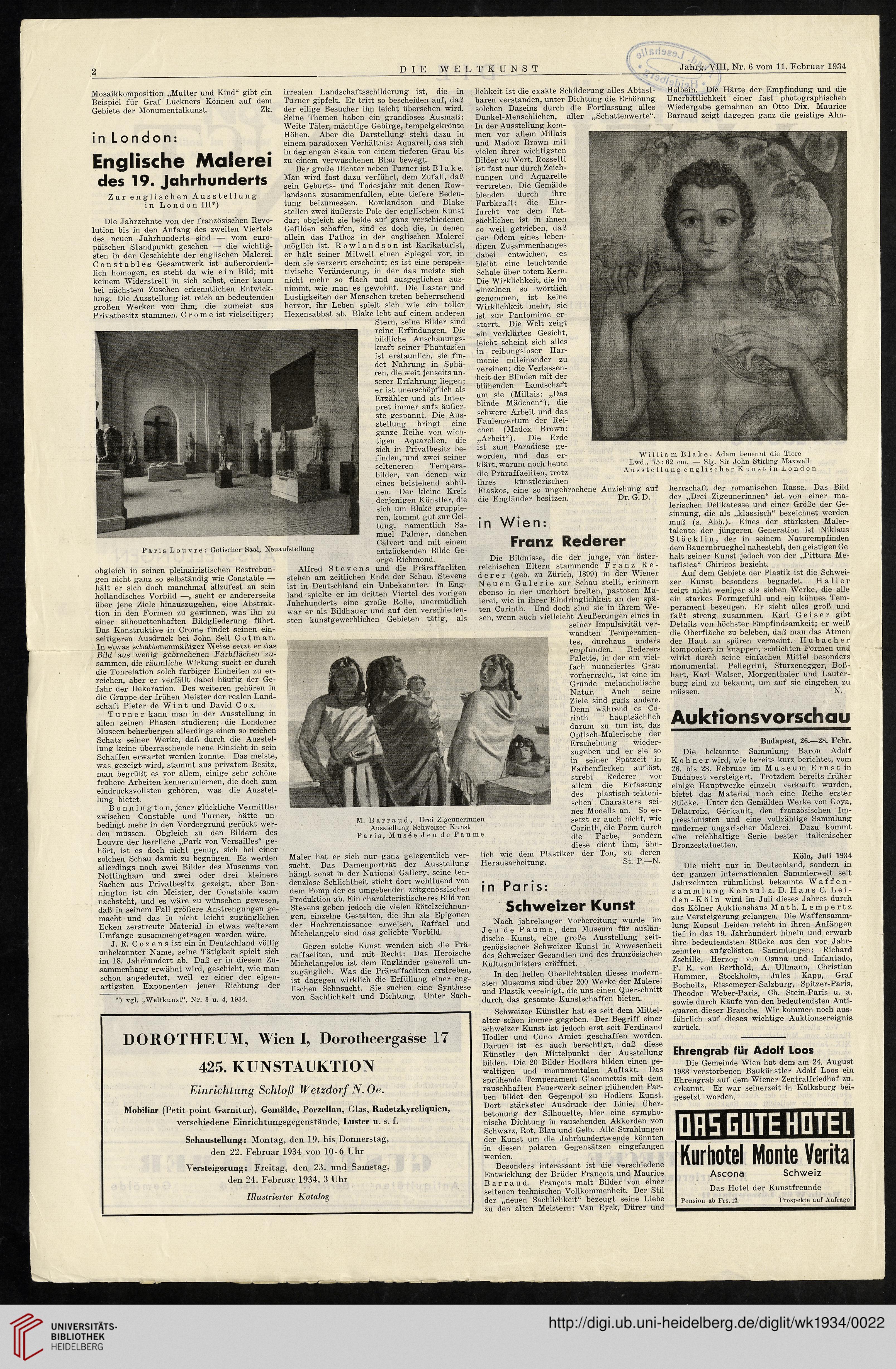2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 6 vom 11. Februar 1934
Mosaikkomposition „Mutter und Kind“ gibt ein
Beispiel für Graf Luckners Können auf dem
Gebiete der Monumentalkunst. Zk.
in London:
Englische Malerei
des 19. Jahrhunderts
Zur englischen Ausstellung
in London III*)
Die Jahrzehnte von der französischen Revo-
lution bis in den Anfang des zweiten Viertels
des neuen Jahrhunderts sind — vom euro-
päischen Standpunkt gesehen — die wichtig-
sten in der Geschichte der englischen Malerei.
Constables Gesamtwerk ist außerordent-
lich homogen, es steht da wie ein Bild, mit
keinem Widerstreit in sich selbst, einer kaum
bei nächstem Zusehen erkenntlichen Entwick-
lung. Die Ausstellung ist reich an bedeutenden
großen Werken von ihm, die zumeist aus
Privatbesitz stammen. C r o m e ist vielseitiger;
obgleich in seinen pleinairistischen Bestrebun-
gen nicht ganz so selbständig wie Constable —
hält er sich doch manchmal allzufest an sein
holländisches Vorbild —, sucht er andererseits
über jene Ziele hinauszugehen, eine Abstrak-
tion in den Formen zu gewinnen, was ihn zu
einer Silhouettenhaften Bildgliederung führt.
Das Konstruktive in Crome findet seinen ein-
seitigeren Ausdruck bei John Sell Cotman.
In etwas schablonenmäßiger W eise setzt er das
Bild aus wenig- gebrochenen Farbflächen zu-
sammen, die räumliche Wirkung sucht er durch
die Tonrelation solch farbiger Einheiten zu er-
reichen, aber er verfällt dabei häufig der Ge-
fahr der Dekoration. Des weiteren gehören in
die Gruppe der frühen Meister der realen Land-
schaft Pieter de W i n t und David Cox.
Turner kann man in der Ausstellung in
allen seinen Phasen studieren; die Londoner
Museen beherbergen allerdings einen so reichen
Schatz seiner Werke, daß durch die Ausstel-
lung keine überraschende neue Einsicht in sein
Schaffen erwartet werden konnte. Das meiste,
was gezeigt wird, stammt aus privatem Besitz,
man begrüßt es vor allem, einige sehr schöne
frühere Arbeiten kennenzulernen, die doch zum
eindrucksvollsten gehören, was die Ausstel-
lung bietet.
Bonnington, jener glückliche Vermittler
zwischen Constable und Turner, hätte un-
bedingt mehr in den Vordergrund gerückt wer-
den müssen. Obgleich zu den Bildern des
Louvre der herrliche „Park von Versailles“ ge-
hört, ist es doch nicht genug, sich bei einer
solchen Schau damit zu begnügen. Es werden
allerdings noch zwei Bilder des Museums von
Nottingham und zwei oder drei kleinere
Sachen aus Privatbesitz gezeigt, aber Bon-
nington ist ein Meister, der Constable kaum
nachsteht, und es wäre zu wünschen gewesen,
daß in seinem Fall größere Anstrengungen ge-
macht und das in nicht leicht zugänglichen
Ecken zerstreute Material in etwas weiterem
Umfange zusammengetragen worden wäre.
J. R. C o z e n s ist ein in Deutschland völlig
unbekannter Name, seine Tätigkeit spielt sich
im 18. Jahrhundert ab. Daß er in diesem Zu-
sammenhang erwähnt wird, geschieht, wie man
schon angedeutet, weil er einer der eigen-
artigsten Exponenten jener Richtung der
*) vgl. „Weltkunst“, Nr. 3 u. 4, 1934.
irrealen Landschaftsschilderung ist, die in
Turner gipfelt. Er tritt so bescheiden auf, daß
der eilige Besucher ihn leicht übersehen wird.
Seine Themen haben ein grandioses Ausmaß:
Weite Täler, mächtige Gebirge, tempelgekrönte
Höhen. Aber die Darstellung steht dazu in
einem paradoxen Verhältnis: Aquarell, das sich
in der engen Skala von einem tieferen Grau bis
zu einem verwaschenen Blau bewegt.
Der große Dichter neben Turner ist B 1 a k e.
Man wird fast dazu verführt, dem Zufall, daß
sein Geburts- und Todesjahr mit denen Row-
landsons zusammenfallen, eine tiefere Bedeu-
tung beizumessen. Rowlandson und Blake
stellen zwei äußerste Pole der englischen Kunst
dar; obgleich sie beide auf ganz verschiedenen
Gefilden schaffen, sind es doch die, in denen
allein das Pathos in der englischen Malerei
möglich ist. Rowlandson ist Karikaturist,
er hält seiner Mitwelt einen Spiegel vor, in
dem sie verzerrt erscheint; es ist eine perspek-
tivische Veränderung, in der das meiste sich
nicht mehr so flach und ausgeglichen aus-
nimmt, wie man es gewohnt. Die Laster und
Lustigkeiten der Menschen treten beherrschend
hervor, ihr Leben spielt sich wie ein toller
Hexensabbat ab. Blake lebt auf einem anderen
Stern, seine Bilder sind
reine Erfindungen. Die
bildliche Anschauungs-
kraft seiner Phantasien
ist erstaunlich, sie fin-
det Nahrung in Sphä-
ren, die weit jenseits un-
serer Erfahrung liegen;
er ist unerschöpflich als
Erzähler und als Inter-
pret immer aufs äußer-
ste gespannt. Die Aus-
stellung bringt eine
ganze Reihe von wich-
tigen Aquarellen, die
sich in Privatbesitz be-
finden, und zwei seiner
selteneren Tempera-
bilder, von denen wir
eines beistehend abbil-
den. Der kleine Kreis
derjenigen Künstler, die
sich um Blake gruppie-
ren, kommt gut zur Gel-
tung, namentlich Sa-
muel Palmer, daneben
Calvert und mit einem
entzückenden Bilde Ge-
orge Richmond.
Alfred Stevens und die Präraffaeliten
stehen am zeitlichen Ende der Schau. Stevens
ist in Deutschland ein Unbekannter. In Eng-
land spielte er im dritten Viertel des vorigen
Jahrhunderts eine große Rolle, unermüdlich
war er als Bildhauer und auf den verschieden-
sten kunstgewerblichen Gebieten tätig, als
Maler hat er sich nur ganz gelegentlich ver-
sucht. Das Damenporträt der Ausstellung
hängt sonst in der National Gallery, seine ten-
denziöse Schlichtheit sticht dort wohltuend von
dem Pomp der es umgebenden zeitgenössischen
Produktion ab. Ein charakteristischeres Bild von
Stevens geben jedoch die vielen Rötelzeichnun-
gen, einzelne Gestalten, die ihn als Epigonen
der Hochrenaissance erweisen, Raffael und
Michelangelo sind das geliebte Vorbild.
Gegen solche Kunst wenden sich die Prä-
raffaeliten, und mit Recht: Das Heroische
Michelangelos ist dem Engländer generell un-
zugänglich. Was die Präraffaeliten erstreben,
ist dagegen wirklich die Erfüllung einer eng-
lischen Sehnsucht. Sie suchen eine Synthese
von Sachlichkeit und Dichtung. Unter Sach-
lichkeit ist die exakte Schilderung alles Abtast-
baren verstanden, unter Dichtung die Erhöhung
solchen Daseins durch die Fortlassung alles
Dunkel-Menschlichen, aller „Schattenwerte“.
In der Ausstellung kom¬
men vor allem Millais
und Madox Brown mit
vielen ihrer wichtigsten
Bilder zu Wort, Rossetti
ist fast nur durch Zeich¬
nungen und Aquarelle
vertreten. Die Gemälde
blenden durch ihre
Farbkraft: die Ehr¬
furcht vor dem Tat-
sächlichen ist in ihnen
so weit getrieben, daß
der Odem eines leben¬
digen Zusammenhanges
dabei entwichen, es
bleibt eine leuchtende
Schale über totem Kern.
Die Wirklichkeit, die im
einzelnen so wörtlich
genommen, ist keine
Wirklichkeit mehr, sie
ist zur Pantomime er¬
starrt. Die Welt zeigt
ein verklärtes Gesicht,
leicht scheint sich alles
in reibungsloser Har¬
monie miteinander zu
vereinen; die Verlassen¬
heit der Blinden mit der
blühenden Landschaft
um sie (Millais: „Das
blinde Mädchen“), die
schwere Arbeit und das
Faulenzertum der Rei¬
chen (Madox Brown:
„Arbeit“). Die Erde
ist zum Paradiese ge¬
worden, und das er¬
klärt, warum noch heute
die Präraffaeliten, trotz
ihres künstlerischen
Fiaskos, eine so ungebrochene Anziehung auf
die Engländer besitzen. Dr. G. D.
in Wien:
Franz Rederer
Die Bildnisse, die der junge, von öster-
reichischen Eltern stammende Franz Re-
derer (geb. zu Zürich, 1899) in der Wiener
Neuen Galerie zur Schau stellt, erinnern
ebenso in der unerhört breiten, pastosen Ma-
lerei, wie in ihrer Eindringlichkeit an den spä-
ten Corinth. Und doch sind sie in ihrem We-
sen, wenn auch vielleicht Aeußerungen eines in
seiner Impulsivität ver-
wandten Temperamen-
tes, durchaus anders
empfunden. Rederers
Palette, in der ein viel-
fach nuanciertes Grau
vorherrscht, ist eine im
Grunde melancholische
Natur. Auch seine
Ziele sind ganz andere.
Denn während es Co-
rinth hauptsächlich
darum zu tun ist, das
Optisch-Malerische der
Erscheinung wieder-
zugeben und er sie so
in seiner Spätzeit in
Farbenflecken auflöst,
strebt Rederer vor
allem die Erfassung
des plastisch-tektoni-
schen Charakters sei-
nes Modells an. So er-
setzt er auch nicht, wie
Corinth, die Form durch
die Farbe, sondern
diese dient ihm, ähn¬
lich wie dem Plastiker der Ton, zu deren
Herausarbeitung. St. P.—N.
in Paris:
Schweizer Kunst
Nach jahrelanger Vorbereitung wurde im
Jeu de Paume, dem Museum für auslän-
dische Kunst, eine große Ausstellung zeit-
genössischer Schweizer Kunst in Anwesenheit
des Schweizer Gesandten und des französischen
Kultusministers eröffnet.
In den hellen Oberlichtsälen dieses modern-
sten Museums sind über 200 Werke der Malerei
und Plastik vereinigt, die uns einen Querschnitt
durch das gesamte Kunstschaffen bieten.
Schweizer Künstler hat es seit dem Mittel-
alter schon immer gegeben. Der Begriff einer
schweizer Kunst ist jedoch erst seit Ferdinand
Hodler und Cuno Amiet geschaffen worden.
Darum ist es auch berechtigt, daß diese
Künstler den Mittelpunkt der Ausstellung
bilden. Die 20 Bilder Hodlers bilden einen ge-
waltigen und monumentalen Auftakt. Das
sprühende Temperament Giacomettis mit dem
rauschhaften Feuerwerk seiner glühenden Far-
ben bildet den Gegenpol zu Hodlers Kunst.
Dort stärkster Ausdruck der Linie, Über-
betonung der Silhouette, hier eine sympho-
nische Dichtung in rauschenden Akkorden von
Schwarz, Rot, Blau und Gelb. Alle Strahlungen
der Kunst um die Jahrhundertwende könnten
in diesen polaren Gegensätzen eingefangen
werden.
Besonders interessant ist die verschiedene
Entwicklung der Brüder Franqois und Maurice
B a r r a u d. Francois malt Bilder von einer
seltenen technischen Vollkommenheit. Der Stil
der „neuen Sachlichkeit“ bezeugt seine Liebe
zu den alten Meistern: Van Eyck, Dürer und
Holbein. Die Härte der Empfindung und die
Unerbittlichkeit einer fast photographischen
Wiedergabe gemahnen an Otto Dix. Maurice
Barraud zeigt dagegen ganz die geistige Ahn-
herrschaft der romanischen Rasse. Das Bild
der „Drei Zigeunerinnen“ ist von einer ma-
lerischen Delikatesse und einer Größe der Ge-
sinnung, die als „klassisch“ bezeichnet werden
muß (s. Abb.). Eines der stärksten Maler-
talente der jüngeren Generation ist Niklaus
S t ö c k 1 i n , der in seinem Naturempfinden
demBauernbrueghel nahesteht, den geistigenGe
halt seiner Kunst jedoch von der „Pittura Me-
tafisica“ Chiricos bezieht.
Auf dem Gebiete der Plastik ist die Schwei-
zer Kunst besonders begnadet. Haller
zeigt nicht weniger als sieben Werke, die alle
ein starkes Formgefühl und ein kühnes Tem-
perament bezeugen. Er sieht alles groß und
faßt streng zusammen. Karl Geiser gibt
Details von höchster Empfindsamkeit; er weiß
die Oberfläche zu beleben, daß man das Atmen
der Haut zu spüren vermeint. Hubacher
komponiert in knappen, schlichten Formen und
wirkt durch seine einfachen Mittel besonders
monumental. Pellegrini, Sturzenegger, Boß-
hart, Karl Walser, Morgenthaler und Lauter-
burg sind zu bekannt, um auf sie eingehen zu
müssen. N.
Auktionsvorschau
Budapest, 26.—28. Febr.
Die bekannte Sammlung Baron Adolf
K o h n e r wird, wie bereits kurz berichtet, vom
26. bis 28. Februar im Museum Ernst in
Budapest versteigert. Trotzdem bereits früher
einige Hauptwerke einzeln verkauft wurden,
bietet das Material noch eine Reihe erster
Stücke. Unter den Gemälden Werke von Goya,
Delacroix, Gericault, den französischen Im-
pressionisten und eine vollzählige Sammlung
moderner ungarischer Malerei. Dazu kommt
eine reichhaltige Serie bester italienischer
Bronzestatuetten.
Köln, Juli 1934
Die nicht nur in Deutschland, sondern in
der ganzen internationalen Sammlerwelt seit
Jahrzehnten rühmlichst bekannte Waffen-
sammlung Konsul a. D. Hans C. Lei-
den-Köln wird im Juli dieses Jahres durch
das Kölner Auktionshaus Math. Lempertz
zur Versteigerung gelangen. Die Waffensamm-
lung Konsul Leiden reicht in ihren Anfängen
tief in das 19. Jahrhundert hinein und erwarb
ihre bedeutendsten Stücke aus den vor Jahr-
zehnten aufgelösten Sammlungen: Richard
Zschille, Herzog von Osuna und Infantado,
F. R. von Berthold, A. Ullmann, Christian
Hammer, Stockholm, Jules Kapp, Graf
Bocholtz, Rissemeyer-Salzburg, Spitzer-Paris,
Theodor Weber-Paris, Ch. Stein-Paris u. a.
sowie durch Käufe von den bedeutendsten Anti-
quaren dieser Branche. Wir kommen noch aus-
führlich auf dieses wichtige Auktionsereignis
zurück.
Ehrengrab für Adolf Loos
Die Gemeinde Wien hat dem am 24. August
1933 verstorbenen Baukünstler Adolf Loos ein
Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof zu-
erkannt. Er war seinerzeit in Kalksburg bei-
gesetzt worden.
DA5GUTE HOTEL
Kurhotel Monte Verita
Ascona Schweiz
Das Hotel der Kunstfreunde
Pension ab Frs. 12. Prospekte auf Anfrage
DOROTHEUM, Wien I, Dorotheergasse 17
425. KUNSTAUKTION
Einrichtung Schloß JEetzdorf N. Oe.
Mobiliar (Petit point Garnitur), Gemälde, Porzellan, Glas, Radetzkyreliquien,
verschiedene Einrichtungsgegenstände, Luster u. s. f.
Schaustellung: Montag, den 19. bis Donnerstag,
den 22. Februar 1934 von 10-6 Uhr
Versteigerung: Freitag, den 23. und Samstag,
den 24. Februar 1934, 3 Uhr
Illustrierter Katalog
Paris Louvre: Gotischer Saal, Neuaufstellung
M. Barraud, Drei Zigeunerinnen
Ausstellung Schweizer Kunst
Paris, Müsse Jeu de Paume
William Blake, Adam benennt die Tiere
Lwd., 75 : 62 cm. — Slg. Sir John Stirling Maxwell
Ausstellung englischer Kunst in London
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 6 vom 11. Februar 1934
Mosaikkomposition „Mutter und Kind“ gibt ein
Beispiel für Graf Luckners Können auf dem
Gebiete der Monumentalkunst. Zk.
in London:
Englische Malerei
des 19. Jahrhunderts
Zur englischen Ausstellung
in London III*)
Die Jahrzehnte von der französischen Revo-
lution bis in den Anfang des zweiten Viertels
des neuen Jahrhunderts sind — vom euro-
päischen Standpunkt gesehen — die wichtig-
sten in der Geschichte der englischen Malerei.
Constables Gesamtwerk ist außerordent-
lich homogen, es steht da wie ein Bild, mit
keinem Widerstreit in sich selbst, einer kaum
bei nächstem Zusehen erkenntlichen Entwick-
lung. Die Ausstellung ist reich an bedeutenden
großen Werken von ihm, die zumeist aus
Privatbesitz stammen. C r o m e ist vielseitiger;
obgleich in seinen pleinairistischen Bestrebun-
gen nicht ganz so selbständig wie Constable —
hält er sich doch manchmal allzufest an sein
holländisches Vorbild —, sucht er andererseits
über jene Ziele hinauszugehen, eine Abstrak-
tion in den Formen zu gewinnen, was ihn zu
einer Silhouettenhaften Bildgliederung führt.
Das Konstruktive in Crome findet seinen ein-
seitigeren Ausdruck bei John Sell Cotman.
In etwas schablonenmäßiger W eise setzt er das
Bild aus wenig- gebrochenen Farbflächen zu-
sammen, die räumliche Wirkung sucht er durch
die Tonrelation solch farbiger Einheiten zu er-
reichen, aber er verfällt dabei häufig der Ge-
fahr der Dekoration. Des weiteren gehören in
die Gruppe der frühen Meister der realen Land-
schaft Pieter de W i n t und David Cox.
Turner kann man in der Ausstellung in
allen seinen Phasen studieren; die Londoner
Museen beherbergen allerdings einen so reichen
Schatz seiner Werke, daß durch die Ausstel-
lung keine überraschende neue Einsicht in sein
Schaffen erwartet werden konnte. Das meiste,
was gezeigt wird, stammt aus privatem Besitz,
man begrüßt es vor allem, einige sehr schöne
frühere Arbeiten kennenzulernen, die doch zum
eindrucksvollsten gehören, was die Ausstel-
lung bietet.
Bonnington, jener glückliche Vermittler
zwischen Constable und Turner, hätte un-
bedingt mehr in den Vordergrund gerückt wer-
den müssen. Obgleich zu den Bildern des
Louvre der herrliche „Park von Versailles“ ge-
hört, ist es doch nicht genug, sich bei einer
solchen Schau damit zu begnügen. Es werden
allerdings noch zwei Bilder des Museums von
Nottingham und zwei oder drei kleinere
Sachen aus Privatbesitz gezeigt, aber Bon-
nington ist ein Meister, der Constable kaum
nachsteht, und es wäre zu wünschen gewesen,
daß in seinem Fall größere Anstrengungen ge-
macht und das in nicht leicht zugänglichen
Ecken zerstreute Material in etwas weiterem
Umfange zusammengetragen worden wäre.
J. R. C o z e n s ist ein in Deutschland völlig
unbekannter Name, seine Tätigkeit spielt sich
im 18. Jahrhundert ab. Daß er in diesem Zu-
sammenhang erwähnt wird, geschieht, wie man
schon angedeutet, weil er einer der eigen-
artigsten Exponenten jener Richtung der
*) vgl. „Weltkunst“, Nr. 3 u. 4, 1934.
irrealen Landschaftsschilderung ist, die in
Turner gipfelt. Er tritt so bescheiden auf, daß
der eilige Besucher ihn leicht übersehen wird.
Seine Themen haben ein grandioses Ausmaß:
Weite Täler, mächtige Gebirge, tempelgekrönte
Höhen. Aber die Darstellung steht dazu in
einem paradoxen Verhältnis: Aquarell, das sich
in der engen Skala von einem tieferen Grau bis
zu einem verwaschenen Blau bewegt.
Der große Dichter neben Turner ist B 1 a k e.
Man wird fast dazu verführt, dem Zufall, daß
sein Geburts- und Todesjahr mit denen Row-
landsons zusammenfallen, eine tiefere Bedeu-
tung beizumessen. Rowlandson und Blake
stellen zwei äußerste Pole der englischen Kunst
dar; obgleich sie beide auf ganz verschiedenen
Gefilden schaffen, sind es doch die, in denen
allein das Pathos in der englischen Malerei
möglich ist. Rowlandson ist Karikaturist,
er hält seiner Mitwelt einen Spiegel vor, in
dem sie verzerrt erscheint; es ist eine perspek-
tivische Veränderung, in der das meiste sich
nicht mehr so flach und ausgeglichen aus-
nimmt, wie man es gewohnt. Die Laster und
Lustigkeiten der Menschen treten beherrschend
hervor, ihr Leben spielt sich wie ein toller
Hexensabbat ab. Blake lebt auf einem anderen
Stern, seine Bilder sind
reine Erfindungen. Die
bildliche Anschauungs-
kraft seiner Phantasien
ist erstaunlich, sie fin-
det Nahrung in Sphä-
ren, die weit jenseits un-
serer Erfahrung liegen;
er ist unerschöpflich als
Erzähler und als Inter-
pret immer aufs äußer-
ste gespannt. Die Aus-
stellung bringt eine
ganze Reihe von wich-
tigen Aquarellen, die
sich in Privatbesitz be-
finden, und zwei seiner
selteneren Tempera-
bilder, von denen wir
eines beistehend abbil-
den. Der kleine Kreis
derjenigen Künstler, die
sich um Blake gruppie-
ren, kommt gut zur Gel-
tung, namentlich Sa-
muel Palmer, daneben
Calvert und mit einem
entzückenden Bilde Ge-
orge Richmond.
Alfred Stevens und die Präraffaeliten
stehen am zeitlichen Ende der Schau. Stevens
ist in Deutschland ein Unbekannter. In Eng-
land spielte er im dritten Viertel des vorigen
Jahrhunderts eine große Rolle, unermüdlich
war er als Bildhauer und auf den verschieden-
sten kunstgewerblichen Gebieten tätig, als
Maler hat er sich nur ganz gelegentlich ver-
sucht. Das Damenporträt der Ausstellung
hängt sonst in der National Gallery, seine ten-
denziöse Schlichtheit sticht dort wohltuend von
dem Pomp der es umgebenden zeitgenössischen
Produktion ab. Ein charakteristischeres Bild von
Stevens geben jedoch die vielen Rötelzeichnun-
gen, einzelne Gestalten, die ihn als Epigonen
der Hochrenaissance erweisen, Raffael und
Michelangelo sind das geliebte Vorbild.
Gegen solche Kunst wenden sich die Prä-
raffaeliten, und mit Recht: Das Heroische
Michelangelos ist dem Engländer generell un-
zugänglich. Was die Präraffaeliten erstreben,
ist dagegen wirklich die Erfüllung einer eng-
lischen Sehnsucht. Sie suchen eine Synthese
von Sachlichkeit und Dichtung. Unter Sach-
lichkeit ist die exakte Schilderung alles Abtast-
baren verstanden, unter Dichtung die Erhöhung
solchen Daseins durch die Fortlassung alles
Dunkel-Menschlichen, aller „Schattenwerte“.
In der Ausstellung kom¬
men vor allem Millais
und Madox Brown mit
vielen ihrer wichtigsten
Bilder zu Wort, Rossetti
ist fast nur durch Zeich¬
nungen und Aquarelle
vertreten. Die Gemälde
blenden durch ihre
Farbkraft: die Ehr¬
furcht vor dem Tat-
sächlichen ist in ihnen
so weit getrieben, daß
der Odem eines leben¬
digen Zusammenhanges
dabei entwichen, es
bleibt eine leuchtende
Schale über totem Kern.
Die Wirklichkeit, die im
einzelnen so wörtlich
genommen, ist keine
Wirklichkeit mehr, sie
ist zur Pantomime er¬
starrt. Die Welt zeigt
ein verklärtes Gesicht,
leicht scheint sich alles
in reibungsloser Har¬
monie miteinander zu
vereinen; die Verlassen¬
heit der Blinden mit der
blühenden Landschaft
um sie (Millais: „Das
blinde Mädchen“), die
schwere Arbeit und das
Faulenzertum der Rei¬
chen (Madox Brown:
„Arbeit“). Die Erde
ist zum Paradiese ge¬
worden, und das er¬
klärt, warum noch heute
die Präraffaeliten, trotz
ihres künstlerischen
Fiaskos, eine so ungebrochene Anziehung auf
die Engländer besitzen. Dr. G. D.
in Wien:
Franz Rederer
Die Bildnisse, die der junge, von öster-
reichischen Eltern stammende Franz Re-
derer (geb. zu Zürich, 1899) in der Wiener
Neuen Galerie zur Schau stellt, erinnern
ebenso in der unerhört breiten, pastosen Ma-
lerei, wie in ihrer Eindringlichkeit an den spä-
ten Corinth. Und doch sind sie in ihrem We-
sen, wenn auch vielleicht Aeußerungen eines in
seiner Impulsivität ver-
wandten Temperamen-
tes, durchaus anders
empfunden. Rederers
Palette, in der ein viel-
fach nuanciertes Grau
vorherrscht, ist eine im
Grunde melancholische
Natur. Auch seine
Ziele sind ganz andere.
Denn während es Co-
rinth hauptsächlich
darum zu tun ist, das
Optisch-Malerische der
Erscheinung wieder-
zugeben und er sie so
in seiner Spätzeit in
Farbenflecken auflöst,
strebt Rederer vor
allem die Erfassung
des plastisch-tektoni-
schen Charakters sei-
nes Modells an. So er-
setzt er auch nicht, wie
Corinth, die Form durch
die Farbe, sondern
diese dient ihm, ähn¬
lich wie dem Plastiker der Ton, zu deren
Herausarbeitung. St. P.—N.
in Paris:
Schweizer Kunst
Nach jahrelanger Vorbereitung wurde im
Jeu de Paume, dem Museum für auslän-
dische Kunst, eine große Ausstellung zeit-
genössischer Schweizer Kunst in Anwesenheit
des Schweizer Gesandten und des französischen
Kultusministers eröffnet.
In den hellen Oberlichtsälen dieses modern-
sten Museums sind über 200 Werke der Malerei
und Plastik vereinigt, die uns einen Querschnitt
durch das gesamte Kunstschaffen bieten.
Schweizer Künstler hat es seit dem Mittel-
alter schon immer gegeben. Der Begriff einer
schweizer Kunst ist jedoch erst seit Ferdinand
Hodler und Cuno Amiet geschaffen worden.
Darum ist es auch berechtigt, daß diese
Künstler den Mittelpunkt der Ausstellung
bilden. Die 20 Bilder Hodlers bilden einen ge-
waltigen und monumentalen Auftakt. Das
sprühende Temperament Giacomettis mit dem
rauschhaften Feuerwerk seiner glühenden Far-
ben bildet den Gegenpol zu Hodlers Kunst.
Dort stärkster Ausdruck der Linie, Über-
betonung der Silhouette, hier eine sympho-
nische Dichtung in rauschenden Akkorden von
Schwarz, Rot, Blau und Gelb. Alle Strahlungen
der Kunst um die Jahrhundertwende könnten
in diesen polaren Gegensätzen eingefangen
werden.
Besonders interessant ist die verschiedene
Entwicklung der Brüder Franqois und Maurice
B a r r a u d. Francois malt Bilder von einer
seltenen technischen Vollkommenheit. Der Stil
der „neuen Sachlichkeit“ bezeugt seine Liebe
zu den alten Meistern: Van Eyck, Dürer und
Holbein. Die Härte der Empfindung und die
Unerbittlichkeit einer fast photographischen
Wiedergabe gemahnen an Otto Dix. Maurice
Barraud zeigt dagegen ganz die geistige Ahn-
herrschaft der romanischen Rasse. Das Bild
der „Drei Zigeunerinnen“ ist von einer ma-
lerischen Delikatesse und einer Größe der Ge-
sinnung, die als „klassisch“ bezeichnet werden
muß (s. Abb.). Eines der stärksten Maler-
talente der jüngeren Generation ist Niklaus
S t ö c k 1 i n , der in seinem Naturempfinden
demBauernbrueghel nahesteht, den geistigenGe
halt seiner Kunst jedoch von der „Pittura Me-
tafisica“ Chiricos bezieht.
Auf dem Gebiete der Plastik ist die Schwei-
zer Kunst besonders begnadet. Haller
zeigt nicht weniger als sieben Werke, die alle
ein starkes Formgefühl und ein kühnes Tem-
perament bezeugen. Er sieht alles groß und
faßt streng zusammen. Karl Geiser gibt
Details von höchster Empfindsamkeit; er weiß
die Oberfläche zu beleben, daß man das Atmen
der Haut zu spüren vermeint. Hubacher
komponiert in knappen, schlichten Formen und
wirkt durch seine einfachen Mittel besonders
monumental. Pellegrini, Sturzenegger, Boß-
hart, Karl Walser, Morgenthaler und Lauter-
burg sind zu bekannt, um auf sie eingehen zu
müssen. N.
Auktionsvorschau
Budapest, 26.—28. Febr.
Die bekannte Sammlung Baron Adolf
K o h n e r wird, wie bereits kurz berichtet, vom
26. bis 28. Februar im Museum Ernst in
Budapest versteigert. Trotzdem bereits früher
einige Hauptwerke einzeln verkauft wurden,
bietet das Material noch eine Reihe erster
Stücke. Unter den Gemälden Werke von Goya,
Delacroix, Gericault, den französischen Im-
pressionisten und eine vollzählige Sammlung
moderner ungarischer Malerei. Dazu kommt
eine reichhaltige Serie bester italienischer
Bronzestatuetten.
Köln, Juli 1934
Die nicht nur in Deutschland, sondern in
der ganzen internationalen Sammlerwelt seit
Jahrzehnten rühmlichst bekannte Waffen-
sammlung Konsul a. D. Hans C. Lei-
den-Köln wird im Juli dieses Jahres durch
das Kölner Auktionshaus Math. Lempertz
zur Versteigerung gelangen. Die Waffensamm-
lung Konsul Leiden reicht in ihren Anfängen
tief in das 19. Jahrhundert hinein und erwarb
ihre bedeutendsten Stücke aus den vor Jahr-
zehnten aufgelösten Sammlungen: Richard
Zschille, Herzog von Osuna und Infantado,
F. R. von Berthold, A. Ullmann, Christian
Hammer, Stockholm, Jules Kapp, Graf
Bocholtz, Rissemeyer-Salzburg, Spitzer-Paris,
Theodor Weber-Paris, Ch. Stein-Paris u. a.
sowie durch Käufe von den bedeutendsten Anti-
quaren dieser Branche. Wir kommen noch aus-
führlich auf dieses wichtige Auktionsereignis
zurück.
Ehrengrab für Adolf Loos
Die Gemeinde Wien hat dem am 24. August
1933 verstorbenen Baukünstler Adolf Loos ein
Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof zu-
erkannt. Er war seinerzeit in Kalksburg bei-
gesetzt worden.
DA5GUTE HOTEL
Kurhotel Monte Verita
Ascona Schweiz
Das Hotel der Kunstfreunde
Pension ab Frs. 12. Prospekte auf Anfrage
DOROTHEUM, Wien I, Dorotheergasse 17
425. KUNSTAUKTION
Einrichtung Schloß JEetzdorf N. Oe.
Mobiliar (Petit point Garnitur), Gemälde, Porzellan, Glas, Radetzkyreliquien,
verschiedene Einrichtungsgegenstände, Luster u. s. f.
Schaustellung: Montag, den 19. bis Donnerstag,
den 22. Februar 1934 von 10-6 Uhr
Versteigerung: Freitag, den 23. und Samstag,
den 24. Februar 1934, 3 Uhr
Illustrierter Katalog
Paris Louvre: Gotischer Saal, Neuaufstellung
M. Barraud, Drei Zigeunerinnen
Ausstellung Schweizer Kunst
Paris, Müsse Jeu de Paume
William Blake, Adam benennt die Tiere
Lwd., 75 : 62 cm. — Slg. Sir John Stirling Maxwell
Ausstellung englischer Kunst in London