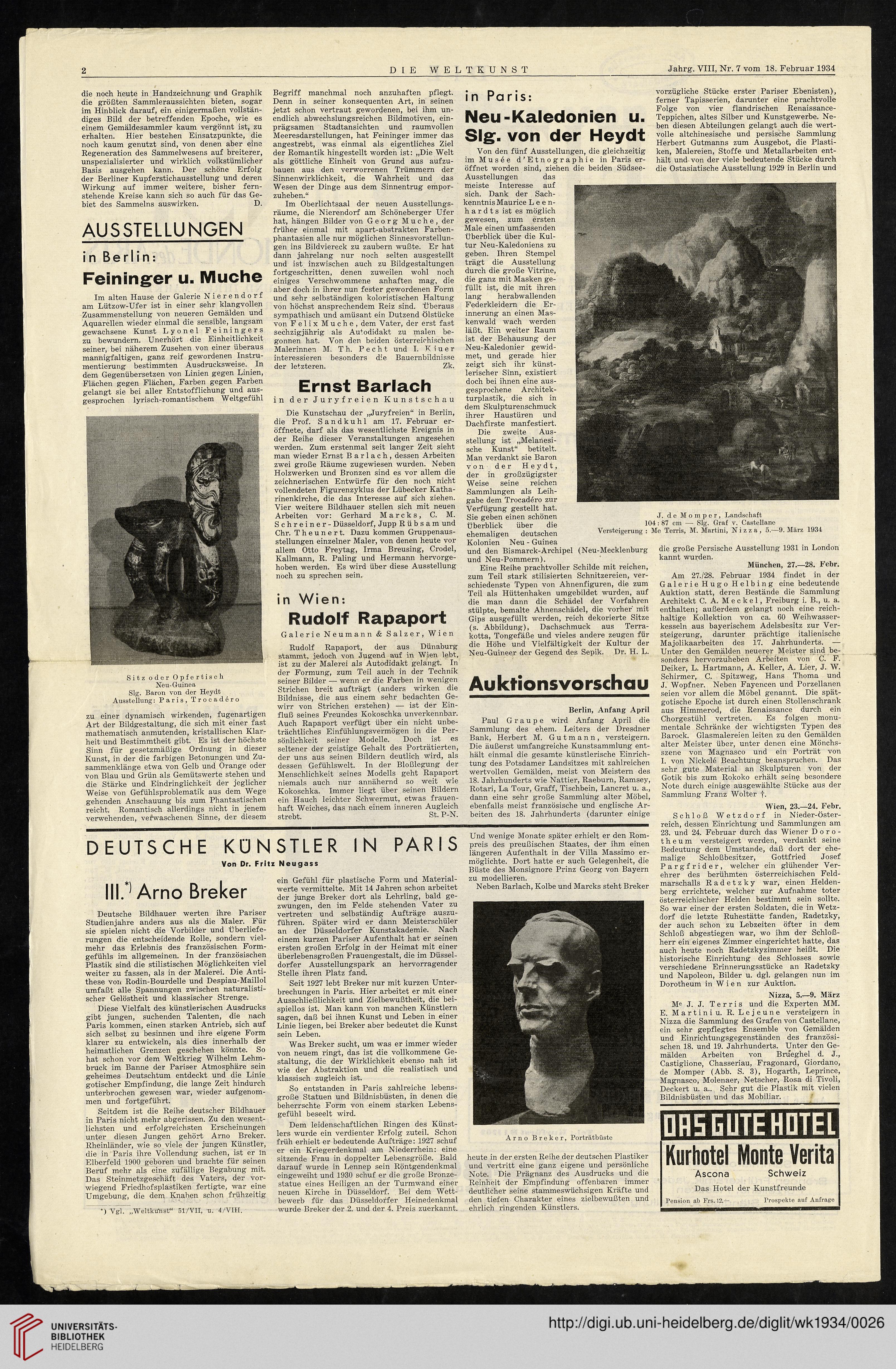2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 7 vom 18. Februar 1934
die noch heute in Handzeichnung und Graphik
die größten Sammleraussichten bieten, sogar
im Hinblick darauf, ein einigermaßen vollstän-
diges Bild der betreffenden Epoche, wie es
einem Gemäldesammler kaum vergönnt ist, zu
erhalten. Hier bestehen Einsatzpunkte, die
noch kaum genutzt sind, von denen aber eine
Regeneration des Sammelwesens auf breiterer,
unspezialisierter und wirklich volkstümlicher
Basis ausgehen kann. Der schöne Erfolg
der Berliner Kupferstichausstellung und deren
Wirkung auf immer weitere, bisher fern-
stehende Kreise kann sich so auch für das Ge-
biet des Sammelns auswirken. D.
AUSSTELLUNGEN
in Berlin:
Feininger u. Muche
Im alten Hause der Galerie Nierendorf
am Lützow-Ufer ist in einer sehr klangvollen
Zusammenstellung von neueren Gemälden und
Aquarellen wieder einmal die sensible, langsam
gewachsene Kunst Lyonei Feiningers
zu bewundern. Unerhört die Einheitlichkeit
seiner, bei näherem Zusehen von einer überaus
mannigfaltigen, ganz reif gewordenen Instru-
mentierung bestimmten Ausdrucksweise. In
dem Gegenübersetzen von Linien gegen Linien,
Flächen gegen Flächen, Farben gegen Farben
gelangt sie bei aller Entstofflichung und aus-
gesprochen lyrisch-romantischem Weltgefühl
Sitz oder Opfertisch
Neu-Guinea
Slg. Baron von der Heydt
Ausstellung: Paris, Trocadero
zu einer dynamisch wirkenden, fugenartigen
Art der Bildgestaltung, die sich mit einer fast
mathematisch anmutenden, kristallischen Klar-
heit und Bestimmtheit gibt. Es ist der höchste
Sinn für gesetzmäßige Ordnung in dieser
Kunst, in der die farbigen Betonungen und Zu-
sammenklänge etwa von Gelb und Orange oder
von Blau und Grün als Gemütswerte stehen und
die Stärke und Eindringlichkeit der jeglicher
Weise von Gefühlsproblematik aus dem Wege
gehenden Anschauung bis zum Phantastischen
reicht. Romantisch allerdings nicht in jenem
verwehenden, verwaschenen Sinne, der diesem
Begriff manchmal noch anzuhaften pflegt.
Denn in seiner konsequenten Art, in seinen
jetzt schon vertraut gewordenen, bei ihm un-
endlich abwechslungsreichen Bildmotiven, ein-
prägsamen Stadtansichten und raumvollen
Meeresdarstellungen, hat Feininger immer das
angestrebt, was einmal als eigentliches Ziel
der Romantik hingestellt worden ist: „Die Welt
als göttliche Einheit von Grund aus aufzu-
bauen aus den verworrenen Trümmern der
Sinnenwirklichkeit, die Wahrheit und das
Wesen der Dinge aus dem Sinnentrug empor-
zuheben.“
Im Oberlichtsaal der neuen Ausstellungs-
räume, die Nierendorf am Schöneberger Ufer
hat, hängen Bilder von Georg Muche, der
früher einmal mit apart-abstrakten Farben-
phantasien alle nur möglichen Sinnesvorstellun-
gen ins Bildviereck zu zaubern wußte. Er hat
dann jahrelang nur noch selten ausgestellt
und ist inzwischen auch zu Bildgestaltungen
fortgeschritten, denen zuweilen wohl noch
einiges Verschwommene anhaften mag, die
aber doch in ihrer nun fester gewordenen Form
und sehr selbständigen koloristischen Haltung
von höchst ansprechendem Reiz sind. Überaus
sympathisch und amüsant ein Dutzend Öistücke
von Felix Muche, dem Vater, der erst fast
sechzigjährig als Autodidakt zu malen be-
gonnen hat. Von den beiden österreichischen
Malerinnen M. Th. P e c h t und I. K i u e r
interessieren besonders die Bauernbildnisse
der letzteren. Zk.
Ernst Barlach
in der Juryfreien Kunstschau
Die Kunstschau der „Juryfreien“ in Berlin,
die Prof. Sandkuhl am 17. Februar er-
öffnete, darf als das wesentlichste Ereignis in
der Reihe dieser Veranstaltungen angesehen
werden. Zum erstenmal seit langer Zeit sieht
man wieder Ernst Barlach, dessen Arbeiten
zwei große Räume zugewiesen wurden. Neben
Holzwerken und Bronzen sind es vor allem die
zeichnerischen Entwürfe für den noch nicht
vollendeten Figurenzyklus der Lübecker Katha-
rinenkirche, die das Interesse auf sich ziehen.
Vier weitere Bildhauer stellen sich mit neuen
Arbeiten vor: Gerhard Mareks, C. M.
Schreiner - Düsseldorf, Jupp R ü b s a m und
Chr. Theunert. Dazu kommen Gruppenaus-
stellungen einzelner Maler, von denen heute vor
allem Otto Freytag, Irma Breusing, Crodel,
Kalimann, R. Paling und Hermann hervorge-
hoben werden. Es wird über diese Ausstellung
noch zu sprechen sein.
in Wien:
Rudolf Rapaport
Galerie Neumann & Salzer, Wien
Rudolf Rapaport, der aus Dünaburg
stammt, jedoch von Jugend auf in Wien lebt,
ist zu der Malerei als Autodidakt gelangt. In
der Formung, zum Teil auch in der Technik
seiner Bilder — wenn er die Farben in wenigen
Strichen breit aufträgt (anders wirken die
Bildnisse, die aus einem sehr bedachten Ge-
wirr von Strichen erstehen) — ist der Ein-
fluß seines Freundes Kokoschka unverkennbar.
Auch Rapaport verfügt über ein nicht unbe-
trächtliches Einfühlungsvermögen in die Per-
sönlichkeit seiner Modelle. Doch ist es
seltener der geistige Gehalt des Porträtierten,
der uns aus seinen Bildern deutlich wird, als
dessen Gefühlswelt. In der Bloßlegung der
Menschlichkeit seines Modells geht Rapaport
niemals auch nur annähernd so weit wie
Kokoschka. Immer liegt über seinen Bildern
ein Hauch leichter Schwermut, etwas frauen-
haft Weiches, das nach einem inneren Augleich
strebt. St. P-N.
DEUTSCHE KÜNSTLER IN PARIS
Von Dr. Fritz Neugass
III.’1 Arno Breker
Deutsche Bildhauer werten ihre Pariser
Studienjahre anders aus als die Maler. Für
sie spielen nicht die Vorbilder und Überliefe-
rungen die entscheidende Rolle, sondern viel-
mehr das Erlebnis des französischen Form-
gefühls im allgemeinen. In der französischen
Plastik sind die stilistischen Möglichkeiten viel
weiter zu fassen, als in der Malerei. Die Anti-
these von Rodin-Bourdelle und Despiau-Maillol
umfaßt alle Spannungen zwischen naturalisti-
scher Gelöstheit und klassischer Strenge.
Diese Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks
gibt jungen, suchenden Talenten, die nach
Paris kommen, einen starken Antrieb, sich auf
sich selbst zu besinnen und ihre eigene Form
klarer zu entwickeln, als dies innerhalb der
heimatlichen Grenzen geschehen könnte. So
hat schon vor dem Weltkrieg Wilhelm Lehm-
bruck im Banne der Pariser Atmosphäre sein
geheimes Deutschtum entdeckt und die Linie
gotischer Empfindung, die lange Zeit hindurch
unterbrochen gewesen war, wieder aufgenom-
men und fortgeführt.
Seitdem ist die Reihe deutscher Bildhauer
in Paris nicht mehr abgerissen. Zu den wesent-
lichsten und erfolgreichsten Erscheinungen
unter diesen Jungen gehört Arno Breker.
Rheinländer, wie so viele der jungen Künstler,
die in Paris ihre Vollendung suchen, ist er In
Elberfeld 1900 geboren und brachte für seinen
Beruf mehr als eine zufällige Begabung mit.
Das Steinmetzgeschäft des Vaters, der vor-
wiegend Friedhofsplastiken fertigte, war eine
Umgebung, die dem Knaben schon frühzeitig
*) Vgl. „Weltktfirst“ 51/VII, u. 4/VIII.
ein Gefühl für plastische Form und Material-
werte vermittelte. Mit 14 Jahren schon arbeitet
der junge Breker dort als Lehrling, bald ge-
zwungen, den im Felde stehenden Vater zu
vertreten und selbständig Aufträge auszu-
führen. Später wird er dann Meisterschüler
an der Düsseldorfer Kunstakademie. Nach
einem kurzen Pariser Aufenthalt hat er seinen
ersten großen Erfolg in der Heimat mit einer
überlebensgroßen Frauengestalt, die im Düssel-
dorfer Ausstellungspark an hervorragender
Stelle ihren Platz fand.
Seit 1927 lebt Breker nur mit kurzen Unter-
brechungen in Paris. Hier arbeitet er mit einer
Ausschließlichkeit und Zielbewußtheit, die bei-
spiellos ist. Man kann von manchen Künstlern
sagen, daß bei ihnen Kunst und Leben in einer
Linie liegen, bei Breker aber bedeutet die Kunst
sein Leben.
Was Breker sucht, um was er immer wieder
von neuem ringt, das ist die vollkommene Ge-
staltung, die der Wirklichkeit ebenso nah ist
wie der Abstraktion und die realistisch und
klassisch zugleich ist.
So entstanden in Paris zahlreiche lebens-
große Statuen und Bildnisbüsten, in denen die
beherrschte Form von einem starken Lebens-
gefühl beseelt wird.
Dem leidenschaftlichen Ringen des Künst-
lers wurde ein verdienter Erfolg zuteil. Schon
früh erhielt er bedeutende Aufträge: 1927 schuf
er ein Kriegerdenkmal am Niederrhein: eine
sitzende Frau in doppelter Lebensgröße. Bald
darauf wurde in Lennep sein Röntgendenkmal
eingeweiht und 1930 schuf er die große Bronze-
statue eines Heiligen an der Turmwand einer
neuen Kirche in Düsseldorf. Bei dem Wett-
bewerb für das Düsseldorfer Heinedenkmal
wurde Breker der .2. und der 4. Preis zuerkannt.
in Paris:
Neu-Kaledonien u.
Slg. von der Heydt
Von den fünf Ausstellungen, die gleichzeitig
imMusee d’Etnographie in Paris er-
öffnet worden sind, ziehen die beiden Südsee-
Ausstellungen das
meiste Interesse auf
sich. Dank der Sach¬
kenntnis Maurice Leen-
h a r d t s ist es möglich
gewesen, zum ersten
Male einen umfassenden
Überblick über die Kul¬
tur Neu-Kaledoniens zu
geben. Ihren Stempel
trägt die Ausstellung
durch die große Vitrine,
die ganz mit Masken ge¬
füllt ist, die mit ihren
lang herabwallenden
Federkleidern die Er¬
innerung an einen Mas¬
kenwald wach werden
läßt. Ein weiter Raum
ist der Behausung der
Neu-Kaledonier gewid¬
met, und gerade hier
zeigt sich ihr künst¬
lerischer Sinn, existiert
doch bei ihnen eine aus¬
gesprochene Architek¬
turplastik, die sich in
dem Skulpturenschmuck
ihrer Haustüren und
Dachfirste manfestiert.
Die zweite Aus¬
stellung ist „Melanesi¬
sche Kunst“ betitelt.
Man verdankt sie Baron
von der Heydt,
der in großzügigster
Weise seine reichen
Sammlungen als Leih¬
gabe dem Trocadero zur
Verfügung gestellt hat.
Sie geben einen schönen
Überblick über die
ehemaligen deutschen
Kolonien Neu - Guinea
und den Bismarck-Archipel (Neu-Mecklenburg
und Neu-Pommern).
Eine Reihe prachtvoller Schilde mit reichen,
zum Teil stark stilisierten Schnitzereien, ver-
schiedenste Typen von Ahnenfiguren, die zum
Teil als Hüttenhaken umgebildet wurden, auf
die man dann die Schädel der Vorfahren
stülpte, bemalte Ahnenschädel, die vorher mit
Gips ausgefüllt werden, reich dekorierte Sitze
(s. Abbildung), Dachschmuck aus Terra-
kotta, Tongefäße und vieles andere zeugen für
die Höhe und Vielfältigkeit der Kultur der
Neu-Guineer der Gegend des Sepik. Dr. H. L.
Auktionsvorschau
Berlin, Anfang April
Paul Graupe wird Anfang April die
Sammlung des ehern. Leiters der Dresdner
Bank, Herbert M. Gutmann, versteigern.
Die äußerst umfangreiche Kunstsammlung ent-
hält einmal die gesamte künstlerische Einrich-
tung des Potsdamer Landsitzes mit zahlreichen
wertvollen Gemälden, meist von Meistem des
18. Jahrhunderts wie Nattier, Raeburn, Ramsey,
Rotari, La Tour, Graff, Tischbein, Lancret u. a.,
dann eine sehr große Sammlung alter Möbel,
ebenfalls meist französische und englische Ar-
beiten des 18. Jahrhunderts (darunter einige
Und wenige Monate später erhielt er den Rom-
preis des preußischen Staates, der ihm einen
längeren Aufenthalt in der Villa Massimo er-
möglichte. Dort hatte er auch Gelegenheit, die
Büste des Monsignore Prinz Georg von Bayern
zu modellieren.
Neben Barlach, Kolbe und Mareks steht Breker
heute in der ersten Reihe der deutschen Plastiker
und vertritt eine ganz eigene und persönliche
Note. Die Prägnanz des Ausdrucks und die
Reinheit der Empfindung offenbaren immer
deutlicher seine stammeswüchsigen Kräfte und
den tiefen Charakter eines zielbewußten und
ehrlich ringenden Künstlers.
vorzügliche Stücke erster Pariser Ebenisten),
ferner Tapisserien, darunter eine prachtvolle
Folge von vier flandrischen Renaissance-
Teppichen, altes Silber und Kunstgewerbe. Ne-
ben diesen Abteilungen gelangt auch die wert-
volle altchinesische und persische Sammlung
Herbert Gutmanns zum Ausgebot, die Plasti-
ken, Malereien, Stoffe und Metallarbeiten ent-
hält und von der viele bedeutende Stücke durch
die Ostasiatische Ausstellung 1929 in Berlin und
die große Persische Ausstellung 1931 in London
kannt wurden.
München, 27.—28. Febr.
Am 27./28. Februar 1934 findet in der
Galerie Hugo Helbing eine bedeutende
Auktion statt, deren Bestände die Sammlung
Architekt C. A. Meckel, Freiburg i. B., u. a.
enthalten; außerdem gelangt noch eine reich-
haltige Kollektion von ca. 60 Weihwasser-
kesseln aus bayerischem Adelsbesitz zur Ver-
steigerung, darunter prächtige italienische
Majolikaarbeiten des 17. Jahrhunderts. —
Unter den Gemälden neuerer Meister sind be-
sonders hervorzuheben Arbeiten von C. F.
Deiker, L. Hartmann, A. Keller, A. Lier, J. W.
Schirmer, C. Spitzweg, Hans Thoma und
J. Wopfner. Neben Fayencen und Porzellanen
seien vor allem die Möbel genannt. Die spät-
gotische Epoche ist durch einen Stollenschrank
aus Himmerod, die Renaissance durch ein
Chorgestühl vertreten. Es folgen monu-
mentale Schränke der wichtigsten Typen des
Barock. Glasmalereien leiten zu den Gemälden
alter Meister über, unter denen eine Mönchs-
szene von Magnasco und ein Porträt von
I. von Nickele Beachtung beanspruchen. Das
sehr gute Material an Skulpturen von der
Gotik bis zum Rokoko erhält seine besondere
Note durch einige ausgewählte Stücke aus der
Sammlung Franz Wolter f.
Wien, 23.-24. Febr.
Schloß Wetzdorf in Nieder-Öster-
reich, dessen Einrichtung und Sammlungen am
23. und 24. Februar durch das Wiener Doro-
theum versteigert werden, verdankt seine
Bedeutung dem Umstande, daß dort der ehe-
malige Schloßbesitzer, Gottfried Josef
Pargfrider, welcher ein glühender Ver-
ehrer des berühmten österreichischen Feld-
marschalls Radetzky war, einen Helden-
berg errichtete, welcher zur Aufnahme toter
österreichischer Helden bestimmt sein sollte.
So war einer der ersten Soldaten, die in Wetz-
dorf die letzte Ruhestätte fanden, Radetzky,
der auch schon zu Lebzeiten öfter in dem
Schloß abgestiegen war, wo ihm der Schloß-
herr ein eigenes Zimmer eingerichtet hatte, das
auch heute noch Radetzkyzimmer heißt. Die
historische Einrichtung des Schlosses sowie
verschiedene Erinnerungsstücke an Radetzky
und Napoleon, Bilder u. dgl. gelangen nun im
Dorotheum in Wien zur Auktion.
Nizza, 5.—9. März
M<- J. J. T e r r i s und die Experten MM.
E. Martini u. R. Lejeune versteigern in
Nizza die Sammlung des Grafen von Casteliane,
ein sehr gepflegtes Ensemble von Gemälden
und Einrichtungsgegenständen des französi-
schen 18. und 19. Jahrhunderts. Unter den Ge-
mälden Arbeiten von Brueghel d. J.,
Castiglione, Chasseriau, Fragonard, Giordano,
de Momper (Abb. S. 3), Hogarth, Leprince,
Magnasco, Molenaer, Netscher, Rosa di Tivoli,
Deckert u. a.. Sehr gut die Plastik mit vielen
Bildnisbüsten und das Mobiliar.
□H5GUTEHDTEL
Kurhotel Monte Verita
Ascona Schweiz
Das Hotel der Kunstfreunde
Pension ab Frs. 12.— Prospekte auf Anfrage
J. de Momper, Landschaft
104: 87 cm — Slg. Graf v. Casteliane
Versteigerung : Me Terris, M. Martini, Nizza, 5.—9. März 1934
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 7 vom 18. Februar 1934
die noch heute in Handzeichnung und Graphik
die größten Sammleraussichten bieten, sogar
im Hinblick darauf, ein einigermaßen vollstän-
diges Bild der betreffenden Epoche, wie es
einem Gemäldesammler kaum vergönnt ist, zu
erhalten. Hier bestehen Einsatzpunkte, die
noch kaum genutzt sind, von denen aber eine
Regeneration des Sammelwesens auf breiterer,
unspezialisierter und wirklich volkstümlicher
Basis ausgehen kann. Der schöne Erfolg
der Berliner Kupferstichausstellung und deren
Wirkung auf immer weitere, bisher fern-
stehende Kreise kann sich so auch für das Ge-
biet des Sammelns auswirken. D.
AUSSTELLUNGEN
in Berlin:
Feininger u. Muche
Im alten Hause der Galerie Nierendorf
am Lützow-Ufer ist in einer sehr klangvollen
Zusammenstellung von neueren Gemälden und
Aquarellen wieder einmal die sensible, langsam
gewachsene Kunst Lyonei Feiningers
zu bewundern. Unerhört die Einheitlichkeit
seiner, bei näherem Zusehen von einer überaus
mannigfaltigen, ganz reif gewordenen Instru-
mentierung bestimmten Ausdrucksweise. In
dem Gegenübersetzen von Linien gegen Linien,
Flächen gegen Flächen, Farben gegen Farben
gelangt sie bei aller Entstofflichung und aus-
gesprochen lyrisch-romantischem Weltgefühl
Sitz oder Opfertisch
Neu-Guinea
Slg. Baron von der Heydt
Ausstellung: Paris, Trocadero
zu einer dynamisch wirkenden, fugenartigen
Art der Bildgestaltung, die sich mit einer fast
mathematisch anmutenden, kristallischen Klar-
heit und Bestimmtheit gibt. Es ist der höchste
Sinn für gesetzmäßige Ordnung in dieser
Kunst, in der die farbigen Betonungen und Zu-
sammenklänge etwa von Gelb und Orange oder
von Blau und Grün als Gemütswerte stehen und
die Stärke und Eindringlichkeit der jeglicher
Weise von Gefühlsproblematik aus dem Wege
gehenden Anschauung bis zum Phantastischen
reicht. Romantisch allerdings nicht in jenem
verwehenden, verwaschenen Sinne, der diesem
Begriff manchmal noch anzuhaften pflegt.
Denn in seiner konsequenten Art, in seinen
jetzt schon vertraut gewordenen, bei ihm un-
endlich abwechslungsreichen Bildmotiven, ein-
prägsamen Stadtansichten und raumvollen
Meeresdarstellungen, hat Feininger immer das
angestrebt, was einmal als eigentliches Ziel
der Romantik hingestellt worden ist: „Die Welt
als göttliche Einheit von Grund aus aufzu-
bauen aus den verworrenen Trümmern der
Sinnenwirklichkeit, die Wahrheit und das
Wesen der Dinge aus dem Sinnentrug empor-
zuheben.“
Im Oberlichtsaal der neuen Ausstellungs-
räume, die Nierendorf am Schöneberger Ufer
hat, hängen Bilder von Georg Muche, der
früher einmal mit apart-abstrakten Farben-
phantasien alle nur möglichen Sinnesvorstellun-
gen ins Bildviereck zu zaubern wußte. Er hat
dann jahrelang nur noch selten ausgestellt
und ist inzwischen auch zu Bildgestaltungen
fortgeschritten, denen zuweilen wohl noch
einiges Verschwommene anhaften mag, die
aber doch in ihrer nun fester gewordenen Form
und sehr selbständigen koloristischen Haltung
von höchst ansprechendem Reiz sind. Überaus
sympathisch und amüsant ein Dutzend Öistücke
von Felix Muche, dem Vater, der erst fast
sechzigjährig als Autodidakt zu malen be-
gonnen hat. Von den beiden österreichischen
Malerinnen M. Th. P e c h t und I. K i u e r
interessieren besonders die Bauernbildnisse
der letzteren. Zk.
Ernst Barlach
in der Juryfreien Kunstschau
Die Kunstschau der „Juryfreien“ in Berlin,
die Prof. Sandkuhl am 17. Februar er-
öffnete, darf als das wesentlichste Ereignis in
der Reihe dieser Veranstaltungen angesehen
werden. Zum erstenmal seit langer Zeit sieht
man wieder Ernst Barlach, dessen Arbeiten
zwei große Räume zugewiesen wurden. Neben
Holzwerken und Bronzen sind es vor allem die
zeichnerischen Entwürfe für den noch nicht
vollendeten Figurenzyklus der Lübecker Katha-
rinenkirche, die das Interesse auf sich ziehen.
Vier weitere Bildhauer stellen sich mit neuen
Arbeiten vor: Gerhard Mareks, C. M.
Schreiner - Düsseldorf, Jupp R ü b s a m und
Chr. Theunert. Dazu kommen Gruppenaus-
stellungen einzelner Maler, von denen heute vor
allem Otto Freytag, Irma Breusing, Crodel,
Kalimann, R. Paling und Hermann hervorge-
hoben werden. Es wird über diese Ausstellung
noch zu sprechen sein.
in Wien:
Rudolf Rapaport
Galerie Neumann & Salzer, Wien
Rudolf Rapaport, der aus Dünaburg
stammt, jedoch von Jugend auf in Wien lebt,
ist zu der Malerei als Autodidakt gelangt. In
der Formung, zum Teil auch in der Technik
seiner Bilder — wenn er die Farben in wenigen
Strichen breit aufträgt (anders wirken die
Bildnisse, die aus einem sehr bedachten Ge-
wirr von Strichen erstehen) — ist der Ein-
fluß seines Freundes Kokoschka unverkennbar.
Auch Rapaport verfügt über ein nicht unbe-
trächtliches Einfühlungsvermögen in die Per-
sönlichkeit seiner Modelle. Doch ist es
seltener der geistige Gehalt des Porträtierten,
der uns aus seinen Bildern deutlich wird, als
dessen Gefühlswelt. In der Bloßlegung der
Menschlichkeit seines Modells geht Rapaport
niemals auch nur annähernd so weit wie
Kokoschka. Immer liegt über seinen Bildern
ein Hauch leichter Schwermut, etwas frauen-
haft Weiches, das nach einem inneren Augleich
strebt. St. P-N.
DEUTSCHE KÜNSTLER IN PARIS
Von Dr. Fritz Neugass
III.’1 Arno Breker
Deutsche Bildhauer werten ihre Pariser
Studienjahre anders aus als die Maler. Für
sie spielen nicht die Vorbilder und Überliefe-
rungen die entscheidende Rolle, sondern viel-
mehr das Erlebnis des französischen Form-
gefühls im allgemeinen. In der französischen
Plastik sind die stilistischen Möglichkeiten viel
weiter zu fassen, als in der Malerei. Die Anti-
these von Rodin-Bourdelle und Despiau-Maillol
umfaßt alle Spannungen zwischen naturalisti-
scher Gelöstheit und klassischer Strenge.
Diese Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks
gibt jungen, suchenden Talenten, die nach
Paris kommen, einen starken Antrieb, sich auf
sich selbst zu besinnen und ihre eigene Form
klarer zu entwickeln, als dies innerhalb der
heimatlichen Grenzen geschehen könnte. So
hat schon vor dem Weltkrieg Wilhelm Lehm-
bruck im Banne der Pariser Atmosphäre sein
geheimes Deutschtum entdeckt und die Linie
gotischer Empfindung, die lange Zeit hindurch
unterbrochen gewesen war, wieder aufgenom-
men und fortgeführt.
Seitdem ist die Reihe deutscher Bildhauer
in Paris nicht mehr abgerissen. Zu den wesent-
lichsten und erfolgreichsten Erscheinungen
unter diesen Jungen gehört Arno Breker.
Rheinländer, wie so viele der jungen Künstler,
die in Paris ihre Vollendung suchen, ist er In
Elberfeld 1900 geboren und brachte für seinen
Beruf mehr als eine zufällige Begabung mit.
Das Steinmetzgeschäft des Vaters, der vor-
wiegend Friedhofsplastiken fertigte, war eine
Umgebung, die dem Knaben schon frühzeitig
*) Vgl. „Weltktfirst“ 51/VII, u. 4/VIII.
ein Gefühl für plastische Form und Material-
werte vermittelte. Mit 14 Jahren schon arbeitet
der junge Breker dort als Lehrling, bald ge-
zwungen, den im Felde stehenden Vater zu
vertreten und selbständig Aufträge auszu-
führen. Später wird er dann Meisterschüler
an der Düsseldorfer Kunstakademie. Nach
einem kurzen Pariser Aufenthalt hat er seinen
ersten großen Erfolg in der Heimat mit einer
überlebensgroßen Frauengestalt, die im Düssel-
dorfer Ausstellungspark an hervorragender
Stelle ihren Platz fand.
Seit 1927 lebt Breker nur mit kurzen Unter-
brechungen in Paris. Hier arbeitet er mit einer
Ausschließlichkeit und Zielbewußtheit, die bei-
spiellos ist. Man kann von manchen Künstlern
sagen, daß bei ihnen Kunst und Leben in einer
Linie liegen, bei Breker aber bedeutet die Kunst
sein Leben.
Was Breker sucht, um was er immer wieder
von neuem ringt, das ist die vollkommene Ge-
staltung, die der Wirklichkeit ebenso nah ist
wie der Abstraktion und die realistisch und
klassisch zugleich ist.
So entstanden in Paris zahlreiche lebens-
große Statuen und Bildnisbüsten, in denen die
beherrschte Form von einem starken Lebens-
gefühl beseelt wird.
Dem leidenschaftlichen Ringen des Künst-
lers wurde ein verdienter Erfolg zuteil. Schon
früh erhielt er bedeutende Aufträge: 1927 schuf
er ein Kriegerdenkmal am Niederrhein: eine
sitzende Frau in doppelter Lebensgröße. Bald
darauf wurde in Lennep sein Röntgendenkmal
eingeweiht und 1930 schuf er die große Bronze-
statue eines Heiligen an der Turmwand einer
neuen Kirche in Düsseldorf. Bei dem Wett-
bewerb für das Düsseldorfer Heinedenkmal
wurde Breker der .2. und der 4. Preis zuerkannt.
in Paris:
Neu-Kaledonien u.
Slg. von der Heydt
Von den fünf Ausstellungen, die gleichzeitig
imMusee d’Etnographie in Paris er-
öffnet worden sind, ziehen die beiden Südsee-
Ausstellungen das
meiste Interesse auf
sich. Dank der Sach¬
kenntnis Maurice Leen-
h a r d t s ist es möglich
gewesen, zum ersten
Male einen umfassenden
Überblick über die Kul¬
tur Neu-Kaledoniens zu
geben. Ihren Stempel
trägt die Ausstellung
durch die große Vitrine,
die ganz mit Masken ge¬
füllt ist, die mit ihren
lang herabwallenden
Federkleidern die Er¬
innerung an einen Mas¬
kenwald wach werden
läßt. Ein weiter Raum
ist der Behausung der
Neu-Kaledonier gewid¬
met, und gerade hier
zeigt sich ihr künst¬
lerischer Sinn, existiert
doch bei ihnen eine aus¬
gesprochene Architek¬
turplastik, die sich in
dem Skulpturenschmuck
ihrer Haustüren und
Dachfirste manfestiert.
Die zweite Aus¬
stellung ist „Melanesi¬
sche Kunst“ betitelt.
Man verdankt sie Baron
von der Heydt,
der in großzügigster
Weise seine reichen
Sammlungen als Leih¬
gabe dem Trocadero zur
Verfügung gestellt hat.
Sie geben einen schönen
Überblick über die
ehemaligen deutschen
Kolonien Neu - Guinea
und den Bismarck-Archipel (Neu-Mecklenburg
und Neu-Pommern).
Eine Reihe prachtvoller Schilde mit reichen,
zum Teil stark stilisierten Schnitzereien, ver-
schiedenste Typen von Ahnenfiguren, die zum
Teil als Hüttenhaken umgebildet wurden, auf
die man dann die Schädel der Vorfahren
stülpte, bemalte Ahnenschädel, die vorher mit
Gips ausgefüllt werden, reich dekorierte Sitze
(s. Abbildung), Dachschmuck aus Terra-
kotta, Tongefäße und vieles andere zeugen für
die Höhe und Vielfältigkeit der Kultur der
Neu-Guineer der Gegend des Sepik. Dr. H. L.
Auktionsvorschau
Berlin, Anfang April
Paul Graupe wird Anfang April die
Sammlung des ehern. Leiters der Dresdner
Bank, Herbert M. Gutmann, versteigern.
Die äußerst umfangreiche Kunstsammlung ent-
hält einmal die gesamte künstlerische Einrich-
tung des Potsdamer Landsitzes mit zahlreichen
wertvollen Gemälden, meist von Meistem des
18. Jahrhunderts wie Nattier, Raeburn, Ramsey,
Rotari, La Tour, Graff, Tischbein, Lancret u. a.,
dann eine sehr große Sammlung alter Möbel,
ebenfalls meist französische und englische Ar-
beiten des 18. Jahrhunderts (darunter einige
Und wenige Monate später erhielt er den Rom-
preis des preußischen Staates, der ihm einen
längeren Aufenthalt in der Villa Massimo er-
möglichte. Dort hatte er auch Gelegenheit, die
Büste des Monsignore Prinz Georg von Bayern
zu modellieren.
Neben Barlach, Kolbe und Mareks steht Breker
heute in der ersten Reihe der deutschen Plastiker
und vertritt eine ganz eigene und persönliche
Note. Die Prägnanz des Ausdrucks und die
Reinheit der Empfindung offenbaren immer
deutlicher seine stammeswüchsigen Kräfte und
den tiefen Charakter eines zielbewußten und
ehrlich ringenden Künstlers.
vorzügliche Stücke erster Pariser Ebenisten),
ferner Tapisserien, darunter eine prachtvolle
Folge von vier flandrischen Renaissance-
Teppichen, altes Silber und Kunstgewerbe. Ne-
ben diesen Abteilungen gelangt auch die wert-
volle altchinesische und persische Sammlung
Herbert Gutmanns zum Ausgebot, die Plasti-
ken, Malereien, Stoffe und Metallarbeiten ent-
hält und von der viele bedeutende Stücke durch
die Ostasiatische Ausstellung 1929 in Berlin und
die große Persische Ausstellung 1931 in London
kannt wurden.
München, 27.—28. Febr.
Am 27./28. Februar 1934 findet in der
Galerie Hugo Helbing eine bedeutende
Auktion statt, deren Bestände die Sammlung
Architekt C. A. Meckel, Freiburg i. B., u. a.
enthalten; außerdem gelangt noch eine reich-
haltige Kollektion von ca. 60 Weihwasser-
kesseln aus bayerischem Adelsbesitz zur Ver-
steigerung, darunter prächtige italienische
Majolikaarbeiten des 17. Jahrhunderts. —
Unter den Gemälden neuerer Meister sind be-
sonders hervorzuheben Arbeiten von C. F.
Deiker, L. Hartmann, A. Keller, A. Lier, J. W.
Schirmer, C. Spitzweg, Hans Thoma und
J. Wopfner. Neben Fayencen und Porzellanen
seien vor allem die Möbel genannt. Die spät-
gotische Epoche ist durch einen Stollenschrank
aus Himmerod, die Renaissance durch ein
Chorgestühl vertreten. Es folgen monu-
mentale Schränke der wichtigsten Typen des
Barock. Glasmalereien leiten zu den Gemälden
alter Meister über, unter denen eine Mönchs-
szene von Magnasco und ein Porträt von
I. von Nickele Beachtung beanspruchen. Das
sehr gute Material an Skulpturen von der
Gotik bis zum Rokoko erhält seine besondere
Note durch einige ausgewählte Stücke aus der
Sammlung Franz Wolter f.
Wien, 23.-24. Febr.
Schloß Wetzdorf in Nieder-Öster-
reich, dessen Einrichtung und Sammlungen am
23. und 24. Februar durch das Wiener Doro-
theum versteigert werden, verdankt seine
Bedeutung dem Umstande, daß dort der ehe-
malige Schloßbesitzer, Gottfried Josef
Pargfrider, welcher ein glühender Ver-
ehrer des berühmten österreichischen Feld-
marschalls Radetzky war, einen Helden-
berg errichtete, welcher zur Aufnahme toter
österreichischer Helden bestimmt sein sollte.
So war einer der ersten Soldaten, die in Wetz-
dorf die letzte Ruhestätte fanden, Radetzky,
der auch schon zu Lebzeiten öfter in dem
Schloß abgestiegen war, wo ihm der Schloß-
herr ein eigenes Zimmer eingerichtet hatte, das
auch heute noch Radetzkyzimmer heißt. Die
historische Einrichtung des Schlosses sowie
verschiedene Erinnerungsstücke an Radetzky
und Napoleon, Bilder u. dgl. gelangen nun im
Dorotheum in Wien zur Auktion.
Nizza, 5.—9. März
M<- J. J. T e r r i s und die Experten MM.
E. Martini u. R. Lejeune versteigern in
Nizza die Sammlung des Grafen von Casteliane,
ein sehr gepflegtes Ensemble von Gemälden
und Einrichtungsgegenständen des französi-
schen 18. und 19. Jahrhunderts. Unter den Ge-
mälden Arbeiten von Brueghel d. J.,
Castiglione, Chasseriau, Fragonard, Giordano,
de Momper (Abb. S. 3), Hogarth, Leprince,
Magnasco, Molenaer, Netscher, Rosa di Tivoli,
Deckert u. a.. Sehr gut die Plastik mit vielen
Bildnisbüsten und das Mobiliar.
□H5GUTEHDTEL
Kurhotel Monte Verita
Ascona Schweiz
Das Hotel der Kunstfreunde
Pension ab Frs. 12.— Prospekte auf Anfrage
J. de Momper, Landschaft
104: 87 cm — Slg. Graf v. Casteliane
Versteigerung : Me Terris, M. Martini, Nizza, 5.—9. März 1934