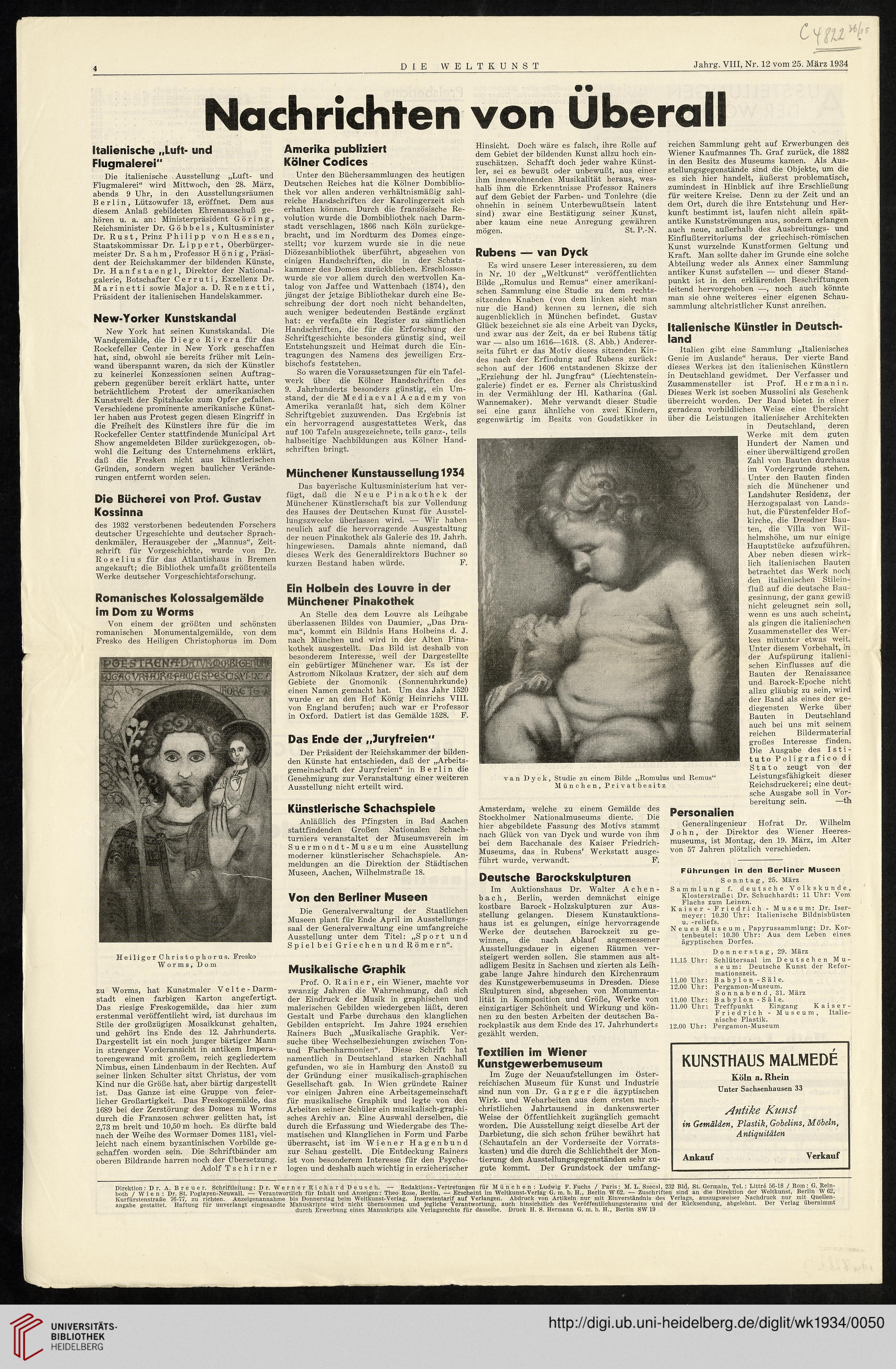4
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 12 vom 25. März 1934
• •
Nachrichten von Überall
Italienische „Luft- und
Flugmalerei"
Die italienische Ausstellung „Luft- und
Flugmalerei“ wird Mittwoch, den 28. März,
abends 9 Uhr, in den Ausstellungsräumen
Berlin, Lützowufer 13, eröffnet. Dem aus
diesem Anlaß gebildeten Ehrenausschuß ge-
hören u. a. an: Ministerpräsident Göring,
Reichsminister Dr. Göbbels, Kultusminister
Dr. Rust, Prinz Philipp von Hessen,
Staatskommissar Dr. Lippert, Oberbürger-
meister Dr. S a h m , Professor Honig, Präsi-
dent der Reichskammer der bildenden Künste,
Dr. Hanfstaengl, Direktor der National-
galerie, Botschafter Cerruti, Exzellenz Dr.
Marinetti sowie Major a. D. Renzetti,
Präsident der italienischen Handelskammer.
New-Yorker Kunstskandal
New York hat seinen Kunstskandal. Die
Wandgemälde, die Diego Rivera für das
Rockefeller Center in New York geschaffen
hat, sind, obwohl sie bereits früher mit Lein-
wand überspannt waren, da sich der Künstler
zu keinerlei Konzessionen seinen Auftrag-
gebern gegenüber bereit erklärt hatte, unter
beträchtlichem Protest der amerikanischen
Kunstwelt der Spitzhacke zum Opfer gefallen.
Verschiedene prominente amerikanische Künst-
ler haben aus Protest gegen diesen Eingriff in
die Freiheit des Künstlers ihre für die im
Rockefeiler Center stattfindende Municipal Art
Show angemeldeten Bilder zurückgezogen, ob-
wohl die Leitung des Unternehmens erklärt,
daß die Fresken nicht aus künstlerischen
Gründen, sondern wegen baulicher Verände-
rungen entfernt worden seien.
Die Bücherei von Prof. Gustav
Kossinna
des 1932 verstorbenen bedeutenden Forschers
deutscher Urgeschichte und deutscher Sprach-
denkmäler, Herausgeber der „Mannus“, Zeit-
schrift für Vorgeschichte, wurde von Dr.
R o s e 1 i u s für das Atlantishaus in Bremen
angekauft; die Bibliothek umfaßt größtenteils
Werke deutscher Vorgeschichtsforschung.
Romanisches Kolossalgemälde
im Dom zu Worms
Von einem der größten und schönsten
romanischen Monumentalgemälde, von dem
Fresko des Heiligen Christophorus im Dom
Heiliger Christophorus. Fresko
Worms, Dom
zu Worms, hat Kunstmaler Veite- Darm-
stadt einen farbigen Karton angefertigt.
Das riesige Freskogemälde, das hier zum
erstenmal veröffentlicht wird, ist durchaus im
Stile der großzügigen Mosaikkunst gehalten,
und gehört ins Ende des 12. Jahrhunderts.
Dargestellt ist ein noch junger bärtiger Mann
in strenger Vorderansicht in antikem Impera-
torengewand mit großem, reich gegliedertem
Nimbus, einen Lindenbaum in der Rechten. Auf
seiner linken Schulter sitzt Christus, der vom
Kind nur die Größe hat, aber bärtig dargestellt
ist. Das Ganze ist eine Gruppe von feier-
licher Großartigkeit. Das Freskogemälde, das
1689 bei der Zerstörung des Domes zu Worms
durch die Franzosen schwer gelitten hat, ist
2,73 m breit und 10,50 m hoch. Es dürfte bald
nach der Weihe des Wormser Domes 1181, viel-
leicht nach einem byzantinischen Vorbilde ge-
schaffen worden sein. Die Schriftbänder am
oberen Bildrande harren noch der Übersetzung.
Adolf Tschirner
Amerika publiziert
Kölner Codices
Unter den Büchersammlungen des heutigen
Deutschen Reiches hat die Kölner Dombiblio-
thek vor allen anderen verhältnismäßig zahl-
reiche Handschriften der Karolingerzeit sich
erhalten können. Durch die französische Re-
volution wurde die Dombibliothek nach Darm-
stadt verschlagen, 1866 nach Köln zurückge-
bracht, und im Nordturm des Domes einge-
stellt; vor kurzem wurde sie in die neue
Diözesanbibliothek überführt, abgesehen von
einigen Handschriften, die in der Schatz-
kammer des Domes zurückblieben. Erschlossen
wurde sie vor allem durch den wertvollen Ka-
talog von Jaffee und Wattenbach (1874), den
jüngst der jetzige Bibliothekar durch eine Be-
schreibung der dort noch nicht behandelten,
auch weniger bedeutenden Bestände ergänzt
hat: er verfaßte ein Register zu sämtlichen
Handschriften, die für die Erforschung der
Schriftgeschichte besonders günstig sind, weil
Entstehungszeit und Heimat durch die Ein-
tragungen des Namens des jeweiligen Erz-
bischofs feststehen.
So waren die Voraussetzungen für ein Tafel-
werk über die Kölner Handschriften des
9. Jahrhunderts besonders günstig, ein Um-
stand, der die Mediaeval Academy von
Amerika veranlaßt hat, sich dem Kölner
Schriftgebiet zuzuwenden. Das Ergebnis ist
ein hervorragend ausgestattetes Werk, das
auf 100 Tafeln ausgezeichnete, teils ganz-, teils
halbseitige Nachbildungen aus Kölner Hand-
schriften bringt.
Münchener Kunstaussellung1934
Das bayerische Kultusministerium hat ver-
fügt, daß die Neue Pinakothek der
Münchener Künstlerschaft bis zur Vollendung
des Hauses der Deutschen Kunst für Ausstel-
lungszwecke überlassen wird. — Wir haben
neulich auf die hervorragende Ausgestaltung
der neuen Pinakothek als Galerie des 19. Jahrh.
hingewiesen. Damals ahnte niemand, daß
dieses Werk des Generaldirektors Buchner so
kurzen Bestand haben würde. F.
Ein Holbein des Louvre in der
Münchener Pinakothek
An Stelle des dem Louvre als Leihgabe
überlassenen Bildes von Daumier, „Das Dra-
ma“, kommt ein Bildnis Hans Holbeins d. J.
nach München und wird in der Alten Pina-
kothek ausgestellt. Das Bild ist deshalb von
besonderem Interesse, weil der Dargestellte
ein gebürtiger Münchener war. Es ist der
Astronom Nikolaus Kratzer, der sich auf dem
Gebiete der Gnomonik (Sonnenuhrkunde)
einen Namen gemacht hat. Um das Jahr 1520
wurde er an den Hof König Heinrichs VIII.
von England berufen; auch war er Professor
in Oxford. Datiert ist das Gemälde 1528. F.
Das Ende der „Juryfreien"
Der Präsident der Reichskammer der bilden-
den Künste hat entschieden, daß der „Arbeits-
gemeinschaft der Juryfreien“ in Berlin die
Genehmigung zur Veranstaltung einer weiteren
Ausstellung nicht erteilt wird.
Künstlerische Schachspiele
Anläßlich des Pfingsten in Bad Aachen
stattfindenden Großen Nationalen Schach-
turniers veranstaltet der Museumsverein im
Suermondt-Museum eine Ausstellung
moderner künstlerischer Schachspiele. An-
meldungen an die Direktion der Städtischen
Museen, Aachen, Wilhelmstraße 18.
Von den Berliner Museen
Die Generalverwaltung der Staatlichen
Museen plant für Ende April im Ausstellungs-
saal der Generalverwaltung eine umfangreiche
Ausstellung unter dem Titel: „Sport und
Spiel bei Griechen und Römern“.
Musikalische Graphik
Prof. O. Rainer, ein Wiener, machte vor
zwanzig Jahren die Wahrnehmung, daß sich
der Eindruck der Musik in graphischen und
malerischen Gebilden wiedergeben läßt, deren
Gestalt und Farbe durchaus den klanglichen
Gebilden entspricht. Im Jahre 1924 erschien
Rainers Buch „Musikalische Graphik. Ver-
suche über Wechselbeziehungen zwischen Ton-
und Farbenharmonien“. Diese Schrift hat
namentlich in Deutschland starken Nachhall
gefunden, wo sie in Hamburg den Anstoß zu
der Gründung einer musikalisch-graphischen
Gesellschaft gab. In Wien gründete Rainer
vor einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft
für musikalische Graphik und legte von den
Arbeiten seiner Schüler ein musikalisch-graphi-
sches Archiv an. Eine Auswahl derselben, die
durch die Erfassung und Wiedergabe des The-
matischen und Klanglichen in Form und Farbe
überrascht, ist im Wiener H a g e n b u n d
zur Schau gestellt. Die Entdeckung Rainers
ist von besonderem Interesse für den Psycho-
logen und deshalb auch wichtig in erzieherischer
Hinsicht. Doch wäre es falsch, ihre Rolle auf
dem Gebiet der bildenden Kunst allzu hoch ein-
zuschätzen. Schafft doch jeder wahre Künst-
ler, sei es bewußt oder unbewußt, aus einer
ihm innewohnenden Musikalität heraus, wes-
halb ihm die Erkenntnisse Professor Rainers
auf dem Gebiet der Farben- und Tonlehre (die
ohnehin in seinem Unterbewußtsein latent
sind) zwar eine Bestätigung seiner Kunst,
aber kaum eine neue Anregung gewähren
mögen. St. P.-N.
Rubens — van Dyck
Es wird unsere Leser interessieren, zu dem
in Nr. 10 der „Weltkunst“ veröffentlichten
Bilde „Romulus und Remus“ einer amerikani-
schen Sammlung eine Studie zu dem rechts-
sitzenden Knaben (von dem linken sieht man
nur die Hand) kennen zu lernen, die sich
augenblicklich in München befindet. Gustav
Glück bezeichnet sie als eine Arbeit van Dycks,
und zwar aus der Zeit, da er bei Rubens tätig
war — also um 1616—1618. (S. Abb.) Anderer-
seits führt er das Motiv dieses sitzenden Kin-
des nach der Erfindung auf Rubens zurück:
schon auf der 1606 entstandenen Skizze der
„Erziehung der hl. Jungfrau“ (Liechtenstein-
galerie) findet er es. Ferner als Christuskind
in der Vermählung der Hl. Katharina (Gal.
Wannemaker). Mehr verwandt dieser Studie
sei eine ganz ähnliche von zwei Kindern,
gegenwärtig im Besitz von Goudstikker in
Amsterdam, welche zu einem Gemälde des
Stockholmer Nationalmuseums diente. Die
hier abgebildete Fassung des Motivs stammt
nach Glück von van Dyck und wurde von ihm
bei dem Bacchanale des Kaiser Friedrich-
Museums, das in Rubens’ Werkstatt ausge-
führt wurde, verwandt. F.
Deutsche Barockskulpturen
Im Auktionshaus Dr. Walter Achen-
bach, Berlin, werden demnächst einige
kostbare Barock - Holzskulpturen zur Aus-
stellung gelangen. Diesem Kunstauktions-
haus ist es gelungen, einige hervorragende
Werke der deutschen Barockzeit zu ge-
winnen, die nach Ablauf angemessener
Ausstellungsdauer in eigenen Räumen ver-
steigert werden sollen. Sie stammen aus alt-
adligem Besitz in Sachsen und zierten als Leih-
gabe lange Jahre hindurch den Kirchenraum
des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Diese
Skulpturen sind, abgesehen von Monumenta-
lität in Komposition und Größe, Werke von
einzigartiger Schönheit und Wirkung und kön-
nen zu den besten Arbeiten der deutschen Ba-
rockplastik aus dem Ende des 17. Jahrhunderts
gezählt werden.
reichen Sammlung geht auf Erwerbungen des
Wiener Kaufmannes Th. Graf zurück, die 1882
in den Besitz des Museums kamen. Als Aus-
stellungsgegenstände sind die Objekte, um die
es sich hier handelt, äußerst problematisch,
zumindest in Hinblick auf ihre Erschließung
für weitere Kreise. Denn zu der Zeit und an
dem Ort, durch die ihre Entstehung und Her-
kunft bestimmt ist, laufen nicht allein spät-
antike Kunstströmungen aus, sondern erlangen
auch neue, außerhalb des Ausbreitungs- und
Einflußterritoriums der griechisch-römischen
Kunst wurzelnde Kunstformen Geltung und
Kraft. Man sollte daher im Grunde eine solche
Abteilung weder als Annex einer Sammlung
antiker Kunst aufstellen ■— und dieser Stand-
punkt ist in den erklärenden Beschriftungen
leitend hervorgehoben —-, noch auch könnte
man sie ohne weiteres einer eigenen Schau-
sammlung altchristlicher Kunst anreihen.
Italienische Künstler in Deutsch-
land
Italien gibt eine Sammlung „Italienisches
Genie im Auslande“ heraus. Der vierte Band
dieses Werkes ist den italienischen Künstlern
in Deutschland gewidmet. Der Verfasser und
Zusammensteller ist Prof. H e r m a n i n.
Dieses Werk ist soeben Mussolini als Geschenk
überreicht worden. Der Band bietet in einer
geradezu vorbildlichen Weise eine Übersicht
über die Leistungen italienischer Architekten
in Deutschland, deren
Werke mit dem guten
Hundert der Namen und
einer überwältigend großen
Zahl von Bauten durchaus
im Vordergründe stehen.
Unter den Bauten finden
sich die Münchener und
Landshuter Residenz, der
Herzogspalast von Lands-
hut, die Fürstenfelder Hof-
kirche, die Dresdner Bau-
ten, die Villa von Wil-
helmshöhe, um nur einige
Hauptstücke aufzuführen.
Aber neben diesen wirk-
lich italienischen Bauten
betrachtet das Werk noch
den italienischen Stilein-
fluß auf die deutsche Bau-
gesinnung, der ganz gewiß
nicht geleugnet sein soll,
wenn es uns auch scheint,
als gingen die italienischen
Zusammensteller des Wer-
kes mitunter etwas weit.
Unter diesem Vorbehalt, in
der Aufspürung italieni-
schen Einflusses auf die
Bauten der Renaissance
und Barock-Epoche nicht
allzu gläubig zu sein, wird
der Band als eines der ge-
diegensten Werke über
Bauten in Deutschland
auch bei uns mit seinem,
reichen Bildermaterial
großes Interesse finden.
Die Ausgabe des I s t i -
tuto Poligrafico di
S t a t o zeugt von der
Leistungsfähigkeit dieser
Reichsdruckerei; eine deut-
sche Ausgabe soll in Vor-
bereitung sein. —th
Personalien
Generalingenieur Hof rat Dr. Wilhelm
John, der Direktor des Wiener Heeres-
museums, ist Montag, den 19. März, im Alter
von 57 Jahren plötzlich verschieden.
Führungen in den Berliner Museen
Sonntag, 25. März
Sammlung f. deutsche Volkskunde,
Klosterstraße: Dr. Schuchhardt: 11 Uhr: Vom
Flachs zum Leinen.
Kaiser - Friedrich - Museum: Dr. Iser-
meyer: 10.30 Uhr: Italienische Bildnisbüsten
u. -reliefs.
Neues Museum, Papyrussammlung: Dr. Kor-
tenbeutel: 10.30 Uhr: Aus dem Leben eines-
ägyptischen Dorfes.
Donnerstag, 29. März
11.15 Uhr: Schlütersaal im Deutschen Mu-
seum: Deutsche Kunst der Refor-
mationszeit.
11.00 Uhr: Babylon - Säle.
12.00 Uhr: Pergamon-Museum.
Sonnabend, 31. März
11.00 Uhr: Babylon - Säle..
11.00 Uhr: Treffpunkt Eingang Kaiser-
Friedrich - Museum, Italie-
nische Plastik.
12.00 Uhr: Pergamon-Museum.
van Dyck, Studie zu einem Bilde „Romulus und Remus“
München, Privatbesitz
Textilien im Wiener
Kunstgewerbemuseum
Im Zuge der Neuaufstellungen im öster-
reichischen Museum für Kunst und Industrie
sind nun von Dr. Garger die ägyptischen
Wirk- und Webarbeiten aus dem ersten nach-
christlichen Jahrtausend in dankenswerter
Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
worden. Die Ausstellung zeigt dieselbe Art der
Darbietung, die sich schon früher bewährt hat
(Schautafeln an der Vorderseite der Vorrats-
kasten) und die durch die Schlichtheit der Mon-
tierung den Ausstellungsgegenständen sehr zu-
gute kommt. Der Grundstock der umfang-
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: D r. A. Breuer. Schriftleitung: Dr. Werner Richard Deusch. — Redaktions-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom: G. Rein-
both /Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. in. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62,
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Muhuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 12 vom 25. März 1934
• •
Nachrichten von Überall
Italienische „Luft- und
Flugmalerei"
Die italienische Ausstellung „Luft- und
Flugmalerei“ wird Mittwoch, den 28. März,
abends 9 Uhr, in den Ausstellungsräumen
Berlin, Lützowufer 13, eröffnet. Dem aus
diesem Anlaß gebildeten Ehrenausschuß ge-
hören u. a. an: Ministerpräsident Göring,
Reichsminister Dr. Göbbels, Kultusminister
Dr. Rust, Prinz Philipp von Hessen,
Staatskommissar Dr. Lippert, Oberbürger-
meister Dr. S a h m , Professor Honig, Präsi-
dent der Reichskammer der bildenden Künste,
Dr. Hanfstaengl, Direktor der National-
galerie, Botschafter Cerruti, Exzellenz Dr.
Marinetti sowie Major a. D. Renzetti,
Präsident der italienischen Handelskammer.
New-Yorker Kunstskandal
New York hat seinen Kunstskandal. Die
Wandgemälde, die Diego Rivera für das
Rockefeller Center in New York geschaffen
hat, sind, obwohl sie bereits früher mit Lein-
wand überspannt waren, da sich der Künstler
zu keinerlei Konzessionen seinen Auftrag-
gebern gegenüber bereit erklärt hatte, unter
beträchtlichem Protest der amerikanischen
Kunstwelt der Spitzhacke zum Opfer gefallen.
Verschiedene prominente amerikanische Künst-
ler haben aus Protest gegen diesen Eingriff in
die Freiheit des Künstlers ihre für die im
Rockefeiler Center stattfindende Municipal Art
Show angemeldeten Bilder zurückgezogen, ob-
wohl die Leitung des Unternehmens erklärt,
daß die Fresken nicht aus künstlerischen
Gründen, sondern wegen baulicher Verände-
rungen entfernt worden seien.
Die Bücherei von Prof. Gustav
Kossinna
des 1932 verstorbenen bedeutenden Forschers
deutscher Urgeschichte und deutscher Sprach-
denkmäler, Herausgeber der „Mannus“, Zeit-
schrift für Vorgeschichte, wurde von Dr.
R o s e 1 i u s für das Atlantishaus in Bremen
angekauft; die Bibliothek umfaßt größtenteils
Werke deutscher Vorgeschichtsforschung.
Romanisches Kolossalgemälde
im Dom zu Worms
Von einem der größten und schönsten
romanischen Monumentalgemälde, von dem
Fresko des Heiligen Christophorus im Dom
Heiliger Christophorus. Fresko
Worms, Dom
zu Worms, hat Kunstmaler Veite- Darm-
stadt einen farbigen Karton angefertigt.
Das riesige Freskogemälde, das hier zum
erstenmal veröffentlicht wird, ist durchaus im
Stile der großzügigen Mosaikkunst gehalten,
und gehört ins Ende des 12. Jahrhunderts.
Dargestellt ist ein noch junger bärtiger Mann
in strenger Vorderansicht in antikem Impera-
torengewand mit großem, reich gegliedertem
Nimbus, einen Lindenbaum in der Rechten. Auf
seiner linken Schulter sitzt Christus, der vom
Kind nur die Größe hat, aber bärtig dargestellt
ist. Das Ganze ist eine Gruppe von feier-
licher Großartigkeit. Das Freskogemälde, das
1689 bei der Zerstörung des Domes zu Worms
durch die Franzosen schwer gelitten hat, ist
2,73 m breit und 10,50 m hoch. Es dürfte bald
nach der Weihe des Wormser Domes 1181, viel-
leicht nach einem byzantinischen Vorbilde ge-
schaffen worden sein. Die Schriftbänder am
oberen Bildrande harren noch der Übersetzung.
Adolf Tschirner
Amerika publiziert
Kölner Codices
Unter den Büchersammlungen des heutigen
Deutschen Reiches hat die Kölner Dombiblio-
thek vor allen anderen verhältnismäßig zahl-
reiche Handschriften der Karolingerzeit sich
erhalten können. Durch die französische Re-
volution wurde die Dombibliothek nach Darm-
stadt verschlagen, 1866 nach Köln zurückge-
bracht, und im Nordturm des Domes einge-
stellt; vor kurzem wurde sie in die neue
Diözesanbibliothek überführt, abgesehen von
einigen Handschriften, die in der Schatz-
kammer des Domes zurückblieben. Erschlossen
wurde sie vor allem durch den wertvollen Ka-
talog von Jaffee und Wattenbach (1874), den
jüngst der jetzige Bibliothekar durch eine Be-
schreibung der dort noch nicht behandelten,
auch weniger bedeutenden Bestände ergänzt
hat: er verfaßte ein Register zu sämtlichen
Handschriften, die für die Erforschung der
Schriftgeschichte besonders günstig sind, weil
Entstehungszeit und Heimat durch die Ein-
tragungen des Namens des jeweiligen Erz-
bischofs feststehen.
So waren die Voraussetzungen für ein Tafel-
werk über die Kölner Handschriften des
9. Jahrhunderts besonders günstig, ein Um-
stand, der die Mediaeval Academy von
Amerika veranlaßt hat, sich dem Kölner
Schriftgebiet zuzuwenden. Das Ergebnis ist
ein hervorragend ausgestattetes Werk, das
auf 100 Tafeln ausgezeichnete, teils ganz-, teils
halbseitige Nachbildungen aus Kölner Hand-
schriften bringt.
Münchener Kunstaussellung1934
Das bayerische Kultusministerium hat ver-
fügt, daß die Neue Pinakothek der
Münchener Künstlerschaft bis zur Vollendung
des Hauses der Deutschen Kunst für Ausstel-
lungszwecke überlassen wird. — Wir haben
neulich auf die hervorragende Ausgestaltung
der neuen Pinakothek als Galerie des 19. Jahrh.
hingewiesen. Damals ahnte niemand, daß
dieses Werk des Generaldirektors Buchner so
kurzen Bestand haben würde. F.
Ein Holbein des Louvre in der
Münchener Pinakothek
An Stelle des dem Louvre als Leihgabe
überlassenen Bildes von Daumier, „Das Dra-
ma“, kommt ein Bildnis Hans Holbeins d. J.
nach München und wird in der Alten Pina-
kothek ausgestellt. Das Bild ist deshalb von
besonderem Interesse, weil der Dargestellte
ein gebürtiger Münchener war. Es ist der
Astronom Nikolaus Kratzer, der sich auf dem
Gebiete der Gnomonik (Sonnenuhrkunde)
einen Namen gemacht hat. Um das Jahr 1520
wurde er an den Hof König Heinrichs VIII.
von England berufen; auch war er Professor
in Oxford. Datiert ist das Gemälde 1528. F.
Das Ende der „Juryfreien"
Der Präsident der Reichskammer der bilden-
den Künste hat entschieden, daß der „Arbeits-
gemeinschaft der Juryfreien“ in Berlin die
Genehmigung zur Veranstaltung einer weiteren
Ausstellung nicht erteilt wird.
Künstlerische Schachspiele
Anläßlich des Pfingsten in Bad Aachen
stattfindenden Großen Nationalen Schach-
turniers veranstaltet der Museumsverein im
Suermondt-Museum eine Ausstellung
moderner künstlerischer Schachspiele. An-
meldungen an die Direktion der Städtischen
Museen, Aachen, Wilhelmstraße 18.
Von den Berliner Museen
Die Generalverwaltung der Staatlichen
Museen plant für Ende April im Ausstellungs-
saal der Generalverwaltung eine umfangreiche
Ausstellung unter dem Titel: „Sport und
Spiel bei Griechen und Römern“.
Musikalische Graphik
Prof. O. Rainer, ein Wiener, machte vor
zwanzig Jahren die Wahrnehmung, daß sich
der Eindruck der Musik in graphischen und
malerischen Gebilden wiedergeben läßt, deren
Gestalt und Farbe durchaus den klanglichen
Gebilden entspricht. Im Jahre 1924 erschien
Rainers Buch „Musikalische Graphik. Ver-
suche über Wechselbeziehungen zwischen Ton-
und Farbenharmonien“. Diese Schrift hat
namentlich in Deutschland starken Nachhall
gefunden, wo sie in Hamburg den Anstoß zu
der Gründung einer musikalisch-graphischen
Gesellschaft gab. In Wien gründete Rainer
vor einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft
für musikalische Graphik und legte von den
Arbeiten seiner Schüler ein musikalisch-graphi-
sches Archiv an. Eine Auswahl derselben, die
durch die Erfassung und Wiedergabe des The-
matischen und Klanglichen in Form und Farbe
überrascht, ist im Wiener H a g e n b u n d
zur Schau gestellt. Die Entdeckung Rainers
ist von besonderem Interesse für den Psycho-
logen und deshalb auch wichtig in erzieherischer
Hinsicht. Doch wäre es falsch, ihre Rolle auf
dem Gebiet der bildenden Kunst allzu hoch ein-
zuschätzen. Schafft doch jeder wahre Künst-
ler, sei es bewußt oder unbewußt, aus einer
ihm innewohnenden Musikalität heraus, wes-
halb ihm die Erkenntnisse Professor Rainers
auf dem Gebiet der Farben- und Tonlehre (die
ohnehin in seinem Unterbewußtsein latent
sind) zwar eine Bestätigung seiner Kunst,
aber kaum eine neue Anregung gewähren
mögen. St. P.-N.
Rubens — van Dyck
Es wird unsere Leser interessieren, zu dem
in Nr. 10 der „Weltkunst“ veröffentlichten
Bilde „Romulus und Remus“ einer amerikani-
schen Sammlung eine Studie zu dem rechts-
sitzenden Knaben (von dem linken sieht man
nur die Hand) kennen zu lernen, die sich
augenblicklich in München befindet. Gustav
Glück bezeichnet sie als eine Arbeit van Dycks,
und zwar aus der Zeit, da er bei Rubens tätig
war — also um 1616—1618. (S. Abb.) Anderer-
seits führt er das Motiv dieses sitzenden Kin-
des nach der Erfindung auf Rubens zurück:
schon auf der 1606 entstandenen Skizze der
„Erziehung der hl. Jungfrau“ (Liechtenstein-
galerie) findet er es. Ferner als Christuskind
in der Vermählung der Hl. Katharina (Gal.
Wannemaker). Mehr verwandt dieser Studie
sei eine ganz ähnliche von zwei Kindern,
gegenwärtig im Besitz von Goudstikker in
Amsterdam, welche zu einem Gemälde des
Stockholmer Nationalmuseums diente. Die
hier abgebildete Fassung des Motivs stammt
nach Glück von van Dyck und wurde von ihm
bei dem Bacchanale des Kaiser Friedrich-
Museums, das in Rubens’ Werkstatt ausge-
führt wurde, verwandt. F.
Deutsche Barockskulpturen
Im Auktionshaus Dr. Walter Achen-
bach, Berlin, werden demnächst einige
kostbare Barock - Holzskulpturen zur Aus-
stellung gelangen. Diesem Kunstauktions-
haus ist es gelungen, einige hervorragende
Werke der deutschen Barockzeit zu ge-
winnen, die nach Ablauf angemessener
Ausstellungsdauer in eigenen Räumen ver-
steigert werden sollen. Sie stammen aus alt-
adligem Besitz in Sachsen und zierten als Leih-
gabe lange Jahre hindurch den Kirchenraum
des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Diese
Skulpturen sind, abgesehen von Monumenta-
lität in Komposition und Größe, Werke von
einzigartiger Schönheit und Wirkung und kön-
nen zu den besten Arbeiten der deutschen Ba-
rockplastik aus dem Ende des 17. Jahrhunderts
gezählt werden.
reichen Sammlung geht auf Erwerbungen des
Wiener Kaufmannes Th. Graf zurück, die 1882
in den Besitz des Museums kamen. Als Aus-
stellungsgegenstände sind die Objekte, um die
es sich hier handelt, äußerst problematisch,
zumindest in Hinblick auf ihre Erschließung
für weitere Kreise. Denn zu der Zeit und an
dem Ort, durch die ihre Entstehung und Her-
kunft bestimmt ist, laufen nicht allein spät-
antike Kunstströmungen aus, sondern erlangen
auch neue, außerhalb des Ausbreitungs- und
Einflußterritoriums der griechisch-römischen
Kunst wurzelnde Kunstformen Geltung und
Kraft. Man sollte daher im Grunde eine solche
Abteilung weder als Annex einer Sammlung
antiker Kunst aufstellen ■— und dieser Stand-
punkt ist in den erklärenden Beschriftungen
leitend hervorgehoben —-, noch auch könnte
man sie ohne weiteres einer eigenen Schau-
sammlung altchristlicher Kunst anreihen.
Italienische Künstler in Deutsch-
land
Italien gibt eine Sammlung „Italienisches
Genie im Auslande“ heraus. Der vierte Band
dieses Werkes ist den italienischen Künstlern
in Deutschland gewidmet. Der Verfasser und
Zusammensteller ist Prof. H e r m a n i n.
Dieses Werk ist soeben Mussolini als Geschenk
überreicht worden. Der Band bietet in einer
geradezu vorbildlichen Weise eine Übersicht
über die Leistungen italienischer Architekten
in Deutschland, deren
Werke mit dem guten
Hundert der Namen und
einer überwältigend großen
Zahl von Bauten durchaus
im Vordergründe stehen.
Unter den Bauten finden
sich die Münchener und
Landshuter Residenz, der
Herzogspalast von Lands-
hut, die Fürstenfelder Hof-
kirche, die Dresdner Bau-
ten, die Villa von Wil-
helmshöhe, um nur einige
Hauptstücke aufzuführen.
Aber neben diesen wirk-
lich italienischen Bauten
betrachtet das Werk noch
den italienischen Stilein-
fluß auf die deutsche Bau-
gesinnung, der ganz gewiß
nicht geleugnet sein soll,
wenn es uns auch scheint,
als gingen die italienischen
Zusammensteller des Wer-
kes mitunter etwas weit.
Unter diesem Vorbehalt, in
der Aufspürung italieni-
schen Einflusses auf die
Bauten der Renaissance
und Barock-Epoche nicht
allzu gläubig zu sein, wird
der Band als eines der ge-
diegensten Werke über
Bauten in Deutschland
auch bei uns mit seinem,
reichen Bildermaterial
großes Interesse finden.
Die Ausgabe des I s t i -
tuto Poligrafico di
S t a t o zeugt von der
Leistungsfähigkeit dieser
Reichsdruckerei; eine deut-
sche Ausgabe soll in Vor-
bereitung sein. —th
Personalien
Generalingenieur Hof rat Dr. Wilhelm
John, der Direktor des Wiener Heeres-
museums, ist Montag, den 19. März, im Alter
von 57 Jahren plötzlich verschieden.
Führungen in den Berliner Museen
Sonntag, 25. März
Sammlung f. deutsche Volkskunde,
Klosterstraße: Dr. Schuchhardt: 11 Uhr: Vom
Flachs zum Leinen.
Kaiser - Friedrich - Museum: Dr. Iser-
meyer: 10.30 Uhr: Italienische Bildnisbüsten
u. -reliefs.
Neues Museum, Papyrussammlung: Dr. Kor-
tenbeutel: 10.30 Uhr: Aus dem Leben eines-
ägyptischen Dorfes.
Donnerstag, 29. März
11.15 Uhr: Schlütersaal im Deutschen Mu-
seum: Deutsche Kunst der Refor-
mationszeit.
11.00 Uhr: Babylon - Säle.
12.00 Uhr: Pergamon-Museum.
Sonnabend, 31. März
11.00 Uhr: Babylon - Säle..
11.00 Uhr: Treffpunkt Eingang Kaiser-
Friedrich - Museum, Italie-
nische Plastik.
12.00 Uhr: Pergamon-Museum.
van Dyck, Studie zu einem Bilde „Romulus und Remus“
München, Privatbesitz
Textilien im Wiener
Kunstgewerbemuseum
Im Zuge der Neuaufstellungen im öster-
reichischen Museum für Kunst und Industrie
sind nun von Dr. Garger die ägyptischen
Wirk- und Webarbeiten aus dem ersten nach-
christlichen Jahrtausend in dankenswerter
Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
worden. Die Ausstellung zeigt dieselbe Art der
Darbietung, die sich schon früher bewährt hat
(Schautafeln an der Vorderseite der Vorrats-
kasten) und die durch die Schlichtheit der Mon-
tierung den Ausstellungsgegenständen sehr zu-
gute kommt. Der Grundstock der umfang-
KUNSTHAUS MALMEDE
Köln a. Rhein
Unter Sachsenhausen 33
Antike Kunst
in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,
Antiquitäten
Ankauf Verkauf
Direktion: D r. A. Breuer. Schriftleitung: Dr. Werner Richard Deusch. — Redaktions-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom: G. Rein-
both /Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. in. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62,
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Muhuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19