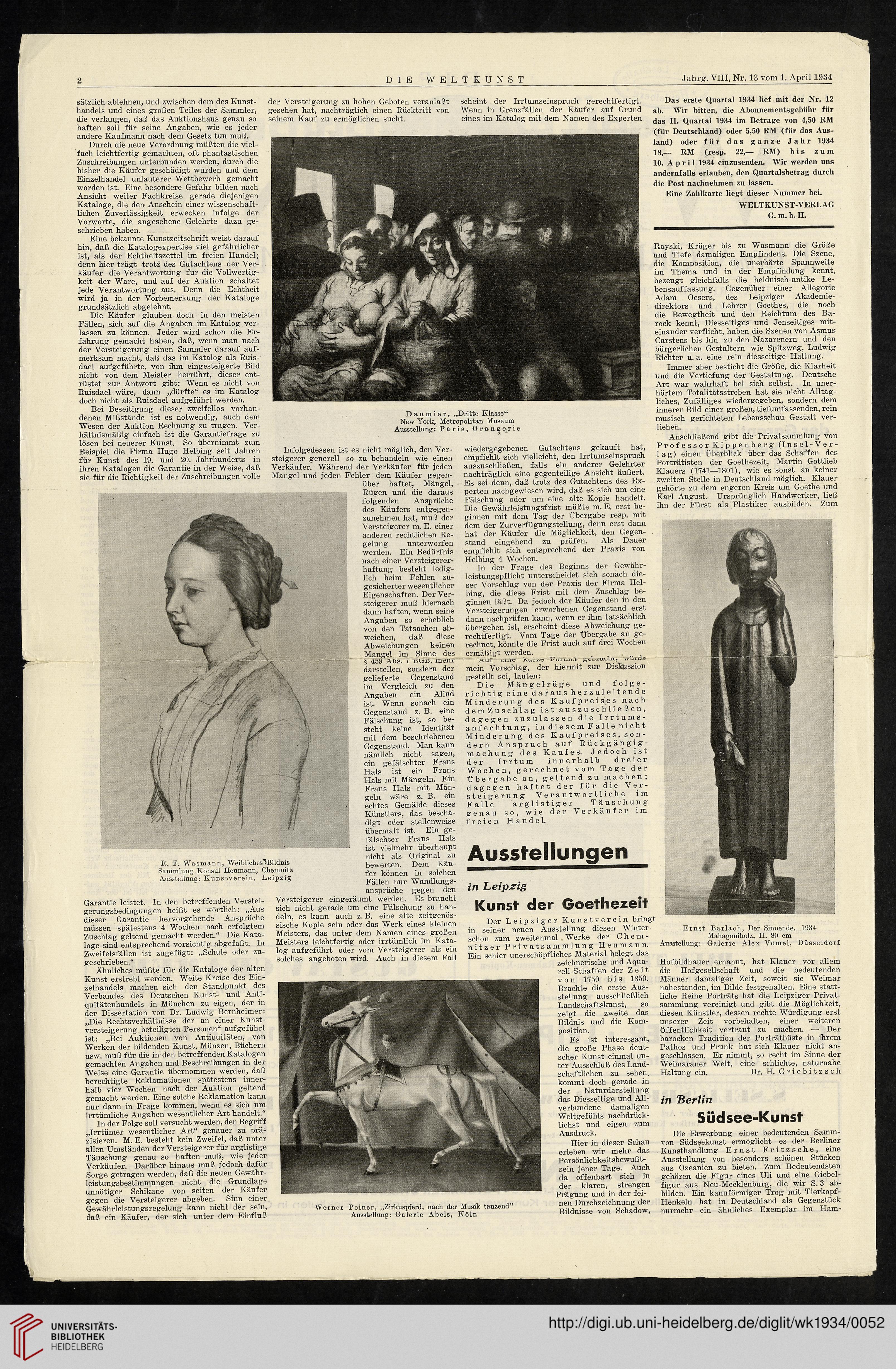2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934
sätzlich ablehnen, und zwischen dem des Kunst-
handels und eines großen Teiles der Sammler,
die verlangen, daß das Auktionshaus genau so
haften soll für seine Angaben, wie es jeder
andere Kaufmann nach dem Gesetz tun muß.
Durch die neue Verordnung müßten die viel-
fach leichtfertig gemachten, oft phantastischen
Zuschreibungen unterbunden werden, durch die
bisher die Käufer geschädigt wurden und dem
Einzelhandel unlauterer Wettbewerb gemacht
worden ist. Eine besondere Gefahr bilden nach
Ansicht weiter Fachkreise gerade diejenigen
Kataloge, die den Anschein einer wissenschaft-
lichen Zuverlässigkeit erwecken infolge der
Vorworte, die angesehene Gelehrte dazu ge-
schrieben haben.
Eine bekannte Kunstzeitschrift weist darauf
hin, daß die Katalogexpertise viel gefährlicher
ist, als der Echtheitszettel im freien Handel;
denn hier trägt trotz des Gutachtens der Ver-
käufer die Verantwortung für die Vollwertig-
keit der Ware, und auf der Auktion schaltet
jede Verantwortung aus. Denn die Echtheit
wird ja in der Vorbemerkung der Kataloge
grundsätzlich abgelehnt.
Die Käufer glauben doch in den meisten
Fällen, sich auf die Angaben im Katalog ver-
lassen zu können. Jeder wird schon die Er-
fahrung gemacht haben, daß, wenn man nach
der Versteigerung einen Sammler darauf auf-
merksam macht, daß das im Katalog als Ruis-
dael aufgeführte, von ihm eingesteigerte Bild
nicht von dem Meister herrührt, dieser ent-
rüstet zur Antwort gibt: Wenn es nicht von
Ruisdael wäre, dann „dürfte“ es im Katalog
doch nicht als Ruisdael aufgeführt werden.
Bei Beseitigung dieser zweifellos vorhan-
denen Mißstände ist es notwendig, auch dem
Wesen der Auktion Rechnung zu tragen. Ver-
hältnismäßig einfach ist die Garantiefrage zu
lösen bei neuerer Kunst. So übernimmt zum
Beispiel die Firma Hugo Helbing seit Jahren
für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts in
ihren Katalogen die Garantie in der Weise, daß
sie für die Richtigkeit der Zuschreibungen volle
Garantie leistet. In den betreffenden Verstei-
gerungsbedingungen heißt es wörtlich: „Aus
dieser Garantie hervorgehende Ansprüche
müssen spätestens 4 Wochen nach erfolgtem
Zuschlag geltend gemacht werden.“ Die Kata-
loge sind entsprechend vorsichtig abgefaßt. In
Zweifelsfällen ist zugefügt: „Schule oder zu-
geschrieben.“
Ähnliches müßte für die Kataloge der alten
Kunst erstrebt werden. Weite Kreise des Ein-
zelhandels machen sich den Standpunkt des
Verbandes des Deutschen Kunst- und Anti-
quitätenhandels in München zu eigen, der in
der Dissertation von Dr. Ludwig Bernheimer:
„Die Rechtsverhältnisse der an einer Kunst-
versteigerung beteiligten Personen“ aufgeführt
ist: „Bei Auktionen von Antiquitäten, von
Werken der bildenden Kunst, Münzen, Büchern
usw. muß für die in den betreffenden Katalogen
gemachten Angaben und Beschreibungen in der
Weise eine Garantie übernommen werden, daß
berechtigte Reklamationen spätestens inner-
halb vier Wochen nach der Auktion geltend
gemacht werden. Eine solche Reklamation kann
nur dann in Frage kommen, wenn es sich um
irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.“
In der Folge soll versucht werden, den Begriff
„Irrtümer wesentlicher Art“ genauer zu prä-
zisieren. M. E. besteht kein Zweifel, daß unter
allen Umständen der Versteigerer für arglistige
Täuschung genau so haften muß, wie jeder
Verkäufer. Darüber hinaus muß jedoch dafür
Sorge getragen werden, daß die neuen Gewähr-
leistungsbestimmungen nicht die Grundlage
unnötiger Schikane von Seiten der Käufer
gegen die Versteigerer abgeben. Sinn einer
Gewährleistungsregelung kann nicht der sein,
daß ein Käufer, der sich unter dem Einfluß
der Versteigerung zu hohen Geboten veranlaßt
gesehen hat, nachträglich einen Rücktritt von
seinem Kauf zu ermöglichen sucht.
Infolgedessen ist es nicht möglich, den Ver-
steigerer generell so zu behandeln wie einen
Verkäufer. Während der Verkäufer für jeden
Mangel und jeden Fehler dem Käufer gegen-
über haftet, Mängel,
Rügen und die daraus
folgenden Ansprüche
des Käufers entgegen-
zunehmen hat, muß der
Versteigerer m. E. einer
anderen rechtlichen Re-
gelung unterworfen
werden. Ein Bedürfnis
nach einer Versteigerer-
haftung besteht ledig-
lich beim Fehlen zu-
gesicherter wesentlicher
Eigenschaften. Der Ver-
steigerer muß hiernach
dann haften, wenn seine
Angaben so erheblich
von den Tatsachen ab-
weichen, daß diese
Abweichungen keinen
Mangel im Sinne des
§ 4öü ADs. ± ütiB. inenx
darstellen, sondern der
gelieferte Gegenstand
im Vergleich zu den
Angaben ein Aliud
ist. Wrenn sonach ein
Gegenstand z. B. eine
Fälschung ist, so be-
steht keine Identität
mit dem. beschriebenen
Gegenstand. Man kann
nämlich nicht sagen,
ein gefälschter Frans
Hals ist ein Frans
Hals mit Mängeln. Ein
Frans Hals mit Män-
geln wäre z. B. ein
echtes Gemälde dieses
Künstlers, das beschä-
digt oder stellenweise
übermalt ist. Ein ge-
fälschter Frans Hals
ist vielmehr überhaupt
nicht als Original zu
bewerten. Dem Käu-
fer können in solchen
Fällen nur Wandlungs-
ansprüche gegen den
Versteigerer eingeräumt werden. Es braucht
sich nicht gerade um eine Fälschung zu han-
deln, es kann auch z. B. eine alte zeitgenös-
sische Kopie sein oder das Werk eines kleinen
Meisters, das unter dem Namen eines großen
Meisters leichtfertig oder irrtümlich im Kata-
log auf geführt oder vom Versteigerer als ein
solches angeboten wird. Auch in diesem Fall
scheint der Irrtumseinspruch gerechtfertigt.
Wenn in Grenzfällen der Käufer auf Grund
eines im Katalog mit dem Namen des Experten
wiedergegebenen Gutachtens gekauft hat,
empfiehlt sich vielleicht, den Irrtumseinspruch
auszuschließen, falls ein anderer Gelehrter
nachträglich eine gegenteilige Ansicht äußert.
Es sei denn, daß trotz des Gutachtens des Ex-
perten nachgewiesen wird, daß es sich um eine
Fälschung oder um eine alte Kopie handelt.
Die Gewährleistungsfrist müßte m. E. erst be-
ginnen mit dem Tag der Übergabe resp. mit
dem der Zurverfügungstellung, denn erst dann
hat der Käufer die Möglichkeit, den Gegen-
stand eingehend zu prüfen. Als Dauer
empfiehlt sich entsprechend der Praxis von
Helbing 4 Wochen.
In der Frage des Beginns der Gewähr-
leistungspflicht unterscheidet sich sonach die-
ser Vorschlag von der Praxis der Firma Hel-
bing, die diese Frist mit dem Zuschlag be-
ginnen läßt. Da jedoch der Käufer den in den
Versteigerungen erworbenen Gegenstand erst
dann nachprüfen kann, wenn er ihm tatsächlich
übergeben ist, erscheint diese Abweichung ge-
rechtfertigt. Vom Tage der Übergabe an ge-
rechnet, könnte die Frist auch auf drei Wochen
ermäßigt werden.
au! exxiv auxz.c FvxxxxA* gvLx-aclxi., würde
mein Vorschlag, der hiermit zur Diskussion
gestellt sei, lauten:
Die Mängelrüge und folge-
richtig eine daraus herzuleitende
Minderung des Kaufpreises nach
dem Zuschlag ist auszuschließen,
dagegen zuzulassen die Irrtums-
anfechtung, i n di e s e m F a 11 e n i c h t
Minderung des Kaufpreises, Son-
de r n Anspruch auf Rückgängig-
machung des Kaufes. Jedoch ist
der Irrtum innerhalb dreier
Wochen, gerechnet vom Tage der
Übergabe an, geltend zu machen;
dagegen haftet der für die Ver-
steigerung Verantwortliche im
Falle arglistiger Täuschung
genau so, wie der Verkäufer im
freien Handel.
Ausstellungen
in Leipzig
Kunst der Goethezeit
Der Leipziger Kunstverein bringt
in seiner neuen Ausstellung diesen Winter
schon zum zweitenmal Werke der Chem-
nitzer Privatsammlung Heumann.
Ein schier unerschöpfliches Material belegt das
zeichnerische und Aqua-
rell-Schaffen der Zeit
von 1750 b i s 1850.
Brachte die erste Aus-
stellung ausschließlich
Landschaftskunst, so
zeigt die zweite das
Bildnis und die Kom-
position.
Es ist interessant,
die große Phase deut-
scher Kunst einmal un-
ter Ausschluß des Land-
schaftlichen zu sehen,
kommt doch gerade in
der Naturdarstellung
das Diesseitige und All-
verbundene damaligen
Weltgefühls nachdrück-
lichst und eigen zum
Ausdruck.
Hier in dieser Schau
erleben wir mehr das
Persönlichkeitsbewußt-
sein jener Tage. Auch
da offenbart sich in
der klaren, strengen
Prägung und in der fei-
nen Durchzeichnung der
Bildnisse von Schadow,
Werner Peiner, „Zirkuspferd, nach der Musik tanzend“
Ausstellung: Galerie Abels, Köln
R. F. Wasmann, WeiblichesTBildnis
Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz
Ausstellung: Kunstverein, Leipzig
Daumie r, „Dritte Klasse“
New York, Metropolitan Museum
Ausstellung: Paris, Orangerie
Das erste Quartal 1934 lief mit der Nr. 12
ab. Wir bitten, die Abonnementsgebühr für
das II. Quartal 1934 im Betrage von 4,50 RM
(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-
land) oder für das ganze Jahr 1934
18,— RM (resp. 22,— RM) bis zum
10. April 1934 einzusenden. Wir werden uns
andernfalls erlauben, den Quartalsbetrag durch
die Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
Rayski, Krüger bis zu Wasmann die Größe
und Tiefe damaligen Empfindens. Die Szene,
die Komposition, die unerhörte Spannweite
im Thema und in der Empfindung kennt,
bezeugt gleichfalls die heidnisch-antike Le-
bensauffassung. Gegenüber einer Allegorie
Adam Oesers, des Leipziger Akademie-
direktors und Lehrer Goethes, die noch
die Bewegtheit und den Reichtum des Ba-
rock kennt, Diesseitiges und Jenseitiges mit-
einander verflicht, haben die Szenen von Asmus
Carstens bis hin zu den Nazarenern und den
bürgerlichen Gestaltern wie Spitzweg, Ludwig
Richter u. a. eine rein diesseitige Haltung.
Immer aber besticht die Größe, die Klarheit
und die Vertiefung der Gestaltung. Deutsche
Art war wahrhaft bei sich selbst. In uner-
hörtem Totalitätsstreben hat sie nicht Alltäg-
liches, Zufälliges wiedergegeben, sondern dem
inneren Bild einer großen, tiefumfassenden, rein
musisch gerichteten Lebensschau Gestalt ver-
liehen.
Anschließend gibt die Privatsammlung von
Professor Kippen berg (Insel-Ver-
lag) einen Überblick über das Schaffen des
Porträtisten der Goethezeit, Martin Gottlieb
Klauers (1741—1801), wie es sonst an keiner
zweiten Stelle in Deutschland möglich. Klauer
gehörte zu dem engeren Kreis um Goethe und
Karl August. Ursprünglich Handwerker, ließ
ihn der Fürst als Plastiker ausbilden. Zum
Ernst Barlach, Der Sinnende. 1934
Mahagoniholz, H. 80 cm
Ausstellung: Galerie Alex Vömel, Düsseldorf
Hofbildhauer ernannt, hat Klauer vor allem
die Hofgesellschaft und die bedeutenden
Männer damaliger Zeit, soweit sie Weimar
nahestanden, im Bilde festgehalten. Eine statt-
liche Reihe Porträts hat die Leipziger Privat-
sammlung vereinigt und gibt die Möglichkeit,
diesen Künstler, dessen rechte Würdigung erst
unserer Zeit Vorbehalten, einer weiteren
Öffentlichkeit vertraut zu machen. — Der
barocken Tradition der Porträtbüste in ihrem
Pathos und Prunk hat sich Klauer nicht an-
geschlossen. Er nimmt, so recht im Sinne der
Weimaraner Welt, eine schlichte, naturnahe
Haltung ein. Dr. H. Griebitzsch
in "Berlin
Südsee-Kunst
Die Erwerbung einer bedeutenden Samm-
von Südseekunst ermöglicht es der Berliner
Kunsthandlung Ernst Fritzsche, eine
Ausstellung von besonders schönen Stücken
aus Ozeanien zu bieten. Zum Bedeutendsten
gehören die Figur eines Uli und eine Giebel-
figur aus Neu-Mecklenburg, die wir S. 3 ab-
bilden. Ein kanuförmiger Trog mit Tierkopf-
Henkeln hat in Deutschland als Gegenstück
nurmehr ein ähnliches Exemplar im Ham-
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934
sätzlich ablehnen, und zwischen dem des Kunst-
handels und eines großen Teiles der Sammler,
die verlangen, daß das Auktionshaus genau so
haften soll für seine Angaben, wie es jeder
andere Kaufmann nach dem Gesetz tun muß.
Durch die neue Verordnung müßten die viel-
fach leichtfertig gemachten, oft phantastischen
Zuschreibungen unterbunden werden, durch die
bisher die Käufer geschädigt wurden und dem
Einzelhandel unlauterer Wettbewerb gemacht
worden ist. Eine besondere Gefahr bilden nach
Ansicht weiter Fachkreise gerade diejenigen
Kataloge, die den Anschein einer wissenschaft-
lichen Zuverlässigkeit erwecken infolge der
Vorworte, die angesehene Gelehrte dazu ge-
schrieben haben.
Eine bekannte Kunstzeitschrift weist darauf
hin, daß die Katalogexpertise viel gefährlicher
ist, als der Echtheitszettel im freien Handel;
denn hier trägt trotz des Gutachtens der Ver-
käufer die Verantwortung für die Vollwertig-
keit der Ware, und auf der Auktion schaltet
jede Verantwortung aus. Denn die Echtheit
wird ja in der Vorbemerkung der Kataloge
grundsätzlich abgelehnt.
Die Käufer glauben doch in den meisten
Fällen, sich auf die Angaben im Katalog ver-
lassen zu können. Jeder wird schon die Er-
fahrung gemacht haben, daß, wenn man nach
der Versteigerung einen Sammler darauf auf-
merksam macht, daß das im Katalog als Ruis-
dael aufgeführte, von ihm eingesteigerte Bild
nicht von dem Meister herrührt, dieser ent-
rüstet zur Antwort gibt: Wenn es nicht von
Ruisdael wäre, dann „dürfte“ es im Katalog
doch nicht als Ruisdael aufgeführt werden.
Bei Beseitigung dieser zweifellos vorhan-
denen Mißstände ist es notwendig, auch dem
Wesen der Auktion Rechnung zu tragen. Ver-
hältnismäßig einfach ist die Garantiefrage zu
lösen bei neuerer Kunst. So übernimmt zum
Beispiel die Firma Hugo Helbing seit Jahren
für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts in
ihren Katalogen die Garantie in der Weise, daß
sie für die Richtigkeit der Zuschreibungen volle
Garantie leistet. In den betreffenden Verstei-
gerungsbedingungen heißt es wörtlich: „Aus
dieser Garantie hervorgehende Ansprüche
müssen spätestens 4 Wochen nach erfolgtem
Zuschlag geltend gemacht werden.“ Die Kata-
loge sind entsprechend vorsichtig abgefaßt. In
Zweifelsfällen ist zugefügt: „Schule oder zu-
geschrieben.“
Ähnliches müßte für die Kataloge der alten
Kunst erstrebt werden. Weite Kreise des Ein-
zelhandels machen sich den Standpunkt des
Verbandes des Deutschen Kunst- und Anti-
quitätenhandels in München zu eigen, der in
der Dissertation von Dr. Ludwig Bernheimer:
„Die Rechtsverhältnisse der an einer Kunst-
versteigerung beteiligten Personen“ aufgeführt
ist: „Bei Auktionen von Antiquitäten, von
Werken der bildenden Kunst, Münzen, Büchern
usw. muß für die in den betreffenden Katalogen
gemachten Angaben und Beschreibungen in der
Weise eine Garantie übernommen werden, daß
berechtigte Reklamationen spätestens inner-
halb vier Wochen nach der Auktion geltend
gemacht werden. Eine solche Reklamation kann
nur dann in Frage kommen, wenn es sich um
irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.“
In der Folge soll versucht werden, den Begriff
„Irrtümer wesentlicher Art“ genauer zu prä-
zisieren. M. E. besteht kein Zweifel, daß unter
allen Umständen der Versteigerer für arglistige
Täuschung genau so haften muß, wie jeder
Verkäufer. Darüber hinaus muß jedoch dafür
Sorge getragen werden, daß die neuen Gewähr-
leistungsbestimmungen nicht die Grundlage
unnötiger Schikane von Seiten der Käufer
gegen die Versteigerer abgeben. Sinn einer
Gewährleistungsregelung kann nicht der sein,
daß ein Käufer, der sich unter dem Einfluß
der Versteigerung zu hohen Geboten veranlaßt
gesehen hat, nachträglich einen Rücktritt von
seinem Kauf zu ermöglichen sucht.
Infolgedessen ist es nicht möglich, den Ver-
steigerer generell so zu behandeln wie einen
Verkäufer. Während der Verkäufer für jeden
Mangel und jeden Fehler dem Käufer gegen-
über haftet, Mängel,
Rügen und die daraus
folgenden Ansprüche
des Käufers entgegen-
zunehmen hat, muß der
Versteigerer m. E. einer
anderen rechtlichen Re-
gelung unterworfen
werden. Ein Bedürfnis
nach einer Versteigerer-
haftung besteht ledig-
lich beim Fehlen zu-
gesicherter wesentlicher
Eigenschaften. Der Ver-
steigerer muß hiernach
dann haften, wenn seine
Angaben so erheblich
von den Tatsachen ab-
weichen, daß diese
Abweichungen keinen
Mangel im Sinne des
§ 4öü ADs. ± ütiB. inenx
darstellen, sondern der
gelieferte Gegenstand
im Vergleich zu den
Angaben ein Aliud
ist. Wrenn sonach ein
Gegenstand z. B. eine
Fälschung ist, so be-
steht keine Identität
mit dem. beschriebenen
Gegenstand. Man kann
nämlich nicht sagen,
ein gefälschter Frans
Hals ist ein Frans
Hals mit Mängeln. Ein
Frans Hals mit Män-
geln wäre z. B. ein
echtes Gemälde dieses
Künstlers, das beschä-
digt oder stellenweise
übermalt ist. Ein ge-
fälschter Frans Hals
ist vielmehr überhaupt
nicht als Original zu
bewerten. Dem Käu-
fer können in solchen
Fällen nur Wandlungs-
ansprüche gegen den
Versteigerer eingeräumt werden. Es braucht
sich nicht gerade um eine Fälschung zu han-
deln, es kann auch z. B. eine alte zeitgenös-
sische Kopie sein oder das Werk eines kleinen
Meisters, das unter dem Namen eines großen
Meisters leichtfertig oder irrtümlich im Kata-
log auf geführt oder vom Versteigerer als ein
solches angeboten wird. Auch in diesem Fall
scheint der Irrtumseinspruch gerechtfertigt.
Wenn in Grenzfällen der Käufer auf Grund
eines im Katalog mit dem Namen des Experten
wiedergegebenen Gutachtens gekauft hat,
empfiehlt sich vielleicht, den Irrtumseinspruch
auszuschließen, falls ein anderer Gelehrter
nachträglich eine gegenteilige Ansicht äußert.
Es sei denn, daß trotz des Gutachtens des Ex-
perten nachgewiesen wird, daß es sich um eine
Fälschung oder um eine alte Kopie handelt.
Die Gewährleistungsfrist müßte m. E. erst be-
ginnen mit dem Tag der Übergabe resp. mit
dem der Zurverfügungstellung, denn erst dann
hat der Käufer die Möglichkeit, den Gegen-
stand eingehend zu prüfen. Als Dauer
empfiehlt sich entsprechend der Praxis von
Helbing 4 Wochen.
In der Frage des Beginns der Gewähr-
leistungspflicht unterscheidet sich sonach die-
ser Vorschlag von der Praxis der Firma Hel-
bing, die diese Frist mit dem Zuschlag be-
ginnen läßt. Da jedoch der Käufer den in den
Versteigerungen erworbenen Gegenstand erst
dann nachprüfen kann, wenn er ihm tatsächlich
übergeben ist, erscheint diese Abweichung ge-
rechtfertigt. Vom Tage der Übergabe an ge-
rechnet, könnte die Frist auch auf drei Wochen
ermäßigt werden.
au! exxiv auxz.c FvxxxxA* gvLx-aclxi., würde
mein Vorschlag, der hiermit zur Diskussion
gestellt sei, lauten:
Die Mängelrüge und folge-
richtig eine daraus herzuleitende
Minderung des Kaufpreises nach
dem Zuschlag ist auszuschließen,
dagegen zuzulassen die Irrtums-
anfechtung, i n di e s e m F a 11 e n i c h t
Minderung des Kaufpreises, Son-
de r n Anspruch auf Rückgängig-
machung des Kaufes. Jedoch ist
der Irrtum innerhalb dreier
Wochen, gerechnet vom Tage der
Übergabe an, geltend zu machen;
dagegen haftet der für die Ver-
steigerung Verantwortliche im
Falle arglistiger Täuschung
genau so, wie der Verkäufer im
freien Handel.
Ausstellungen
in Leipzig
Kunst der Goethezeit
Der Leipziger Kunstverein bringt
in seiner neuen Ausstellung diesen Winter
schon zum zweitenmal Werke der Chem-
nitzer Privatsammlung Heumann.
Ein schier unerschöpfliches Material belegt das
zeichnerische und Aqua-
rell-Schaffen der Zeit
von 1750 b i s 1850.
Brachte die erste Aus-
stellung ausschließlich
Landschaftskunst, so
zeigt die zweite das
Bildnis und die Kom-
position.
Es ist interessant,
die große Phase deut-
scher Kunst einmal un-
ter Ausschluß des Land-
schaftlichen zu sehen,
kommt doch gerade in
der Naturdarstellung
das Diesseitige und All-
verbundene damaligen
Weltgefühls nachdrück-
lichst und eigen zum
Ausdruck.
Hier in dieser Schau
erleben wir mehr das
Persönlichkeitsbewußt-
sein jener Tage. Auch
da offenbart sich in
der klaren, strengen
Prägung und in der fei-
nen Durchzeichnung der
Bildnisse von Schadow,
Werner Peiner, „Zirkuspferd, nach der Musik tanzend“
Ausstellung: Galerie Abels, Köln
R. F. Wasmann, WeiblichesTBildnis
Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz
Ausstellung: Kunstverein, Leipzig
Daumie r, „Dritte Klasse“
New York, Metropolitan Museum
Ausstellung: Paris, Orangerie
Das erste Quartal 1934 lief mit der Nr. 12
ab. Wir bitten, die Abonnementsgebühr für
das II. Quartal 1934 im Betrage von 4,50 RM
(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-
land) oder für das ganze Jahr 1934
18,— RM (resp. 22,— RM) bis zum
10. April 1934 einzusenden. Wir werden uns
andernfalls erlauben, den Quartalsbetrag durch
die Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
Rayski, Krüger bis zu Wasmann die Größe
und Tiefe damaligen Empfindens. Die Szene,
die Komposition, die unerhörte Spannweite
im Thema und in der Empfindung kennt,
bezeugt gleichfalls die heidnisch-antike Le-
bensauffassung. Gegenüber einer Allegorie
Adam Oesers, des Leipziger Akademie-
direktors und Lehrer Goethes, die noch
die Bewegtheit und den Reichtum des Ba-
rock kennt, Diesseitiges und Jenseitiges mit-
einander verflicht, haben die Szenen von Asmus
Carstens bis hin zu den Nazarenern und den
bürgerlichen Gestaltern wie Spitzweg, Ludwig
Richter u. a. eine rein diesseitige Haltung.
Immer aber besticht die Größe, die Klarheit
und die Vertiefung der Gestaltung. Deutsche
Art war wahrhaft bei sich selbst. In uner-
hörtem Totalitätsstreben hat sie nicht Alltäg-
liches, Zufälliges wiedergegeben, sondern dem
inneren Bild einer großen, tiefumfassenden, rein
musisch gerichteten Lebensschau Gestalt ver-
liehen.
Anschließend gibt die Privatsammlung von
Professor Kippen berg (Insel-Ver-
lag) einen Überblick über das Schaffen des
Porträtisten der Goethezeit, Martin Gottlieb
Klauers (1741—1801), wie es sonst an keiner
zweiten Stelle in Deutschland möglich. Klauer
gehörte zu dem engeren Kreis um Goethe und
Karl August. Ursprünglich Handwerker, ließ
ihn der Fürst als Plastiker ausbilden. Zum
Ernst Barlach, Der Sinnende. 1934
Mahagoniholz, H. 80 cm
Ausstellung: Galerie Alex Vömel, Düsseldorf
Hofbildhauer ernannt, hat Klauer vor allem
die Hofgesellschaft und die bedeutenden
Männer damaliger Zeit, soweit sie Weimar
nahestanden, im Bilde festgehalten. Eine statt-
liche Reihe Porträts hat die Leipziger Privat-
sammlung vereinigt und gibt die Möglichkeit,
diesen Künstler, dessen rechte Würdigung erst
unserer Zeit Vorbehalten, einer weiteren
Öffentlichkeit vertraut zu machen. — Der
barocken Tradition der Porträtbüste in ihrem
Pathos und Prunk hat sich Klauer nicht an-
geschlossen. Er nimmt, so recht im Sinne der
Weimaraner Welt, eine schlichte, naturnahe
Haltung ein. Dr. H. Griebitzsch
in "Berlin
Südsee-Kunst
Die Erwerbung einer bedeutenden Samm-
von Südseekunst ermöglicht es der Berliner
Kunsthandlung Ernst Fritzsche, eine
Ausstellung von besonders schönen Stücken
aus Ozeanien zu bieten. Zum Bedeutendsten
gehören die Figur eines Uli und eine Giebel-
figur aus Neu-Mecklenburg, die wir S. 3 ab-
bilden. Ein kanuförmiger Trog mit Tierkopf-
Henkeln hat in Deutschland als Gegenstück
nurmehr ein ähnliches Exemplar im Ham-