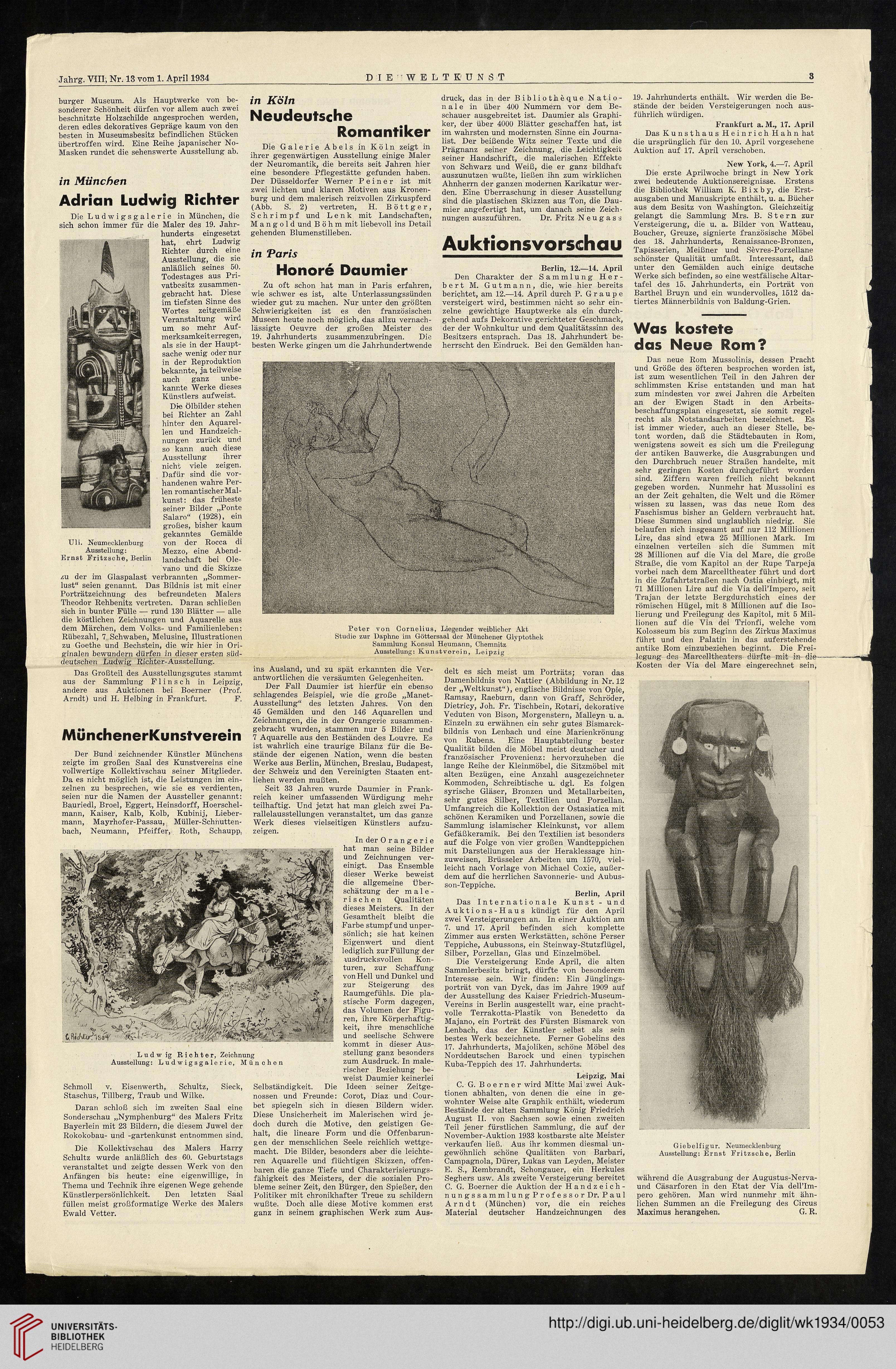DIE'WELT KUNST
3
Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934
in München
Au ktio ns vo rsch a u
Uli. Neumecklenburg
Ausstellung:
Ernst Fritzsche, Berlin
Ludwig Richter, Zeichnung
Ausstellung: Ludwigsgalerie, München
In der Orangerie
hat man seine Bilder
und Zeichnungen ver-
einigt. Das Ensemble
dieser Werke beweist
die allgemeine Über-
schätzung der male-
rischen Qualitäten
dieses Meisters. In der
Gesamtheit bleibt die
Farbe stumpfund unper-
sönlich; sie hat keinen
Eigenwert und dient
lediglich zur Füllung der
ausdrucksvollen Kon-
turen, zur Schaffung
von Hell und Dunkel und
zur Steigerung des
Raumgefühls. Die pla-
stische Form dagegen,
das Volumen der Figu-
ren, ihre Körperhaftig-
keit, ihre menschliche
und seelische Schwere
kommt in dieser Aus-
stellung ganz besonders
zum Ausdruck. In male-
rischer Beziehung be-
weist Daumier keinerlei
Ideen seiner Zeitge-
Corot, Diaz und Cour-
diesen Bildern wider.
Die Kollektivschau des
burger Museum. Als Hauptwerke von be-
sonderer Schönheit dürfen vor allem auch zwei
beschnitzte Holzschilde angesprochen werden,
deren edles dekoratives Gepräge kaum von den
besten in Museumsbesitz befindlichen Stücken
übertroffen wird. Eine Reihe japanischer No-
Masken rundet die sehenswerte Ausstellung ab.
Der Bund zeichnender Künstler Münchens
zeigte im großen Saal des Kunstvereins eine
vollwertige Kollektivschau seiner Mitglieder.
Da es nicht möglich ist, die Leistungen im ein-
zelnen zu besprechen, wie sie es verdienten,
seien nur die Namen der Aussteller genannt:
Bauriedl, Broel, Eggert, Heinsdorff, Hoerschel-
mann, Kaiser, Kalb, Kolb, Kubinij, Lieber-
mann, Mayrhofer-Passau, Müller-Schnutten-
bach, Neumann, Pfeiffer, Roth, Schaupp,
Peter von Cornelius, Liegender weiblicher Akt
Studie zur Daphne im Göttersaal der Münchener Glyptothek
Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz
Ausstellung: Kunstverein, Leipzig
Berlin, April
Das Internationale Kunst - und
Auktions-Haus kündigt für den April
zwei Versteigerungen an. In einer Auktion am
7. und 17. April befinden sich komplette
Zimmer aus ersten Werkstätten, schöne Perser
Teppiche, Aubussons, ein Steinway-Stutzflügel,
Silber, Porzellan, Glas und Einzelmöbel.
Die Versteigerung Ende April, die alten
Sammlerbesitz bringt, dürfte von besonderem
Interesse sein. Wir finden: Ein Jünglings-
porträt von van Dyck, das im Jahre 1909 auf
der Ausstellung des Kaiser Friedrich-Museum-
Vereins in Berlin ausgestellt war, eine pracht-
volle Terrakotta-Plastik von Benedetto da
Majano, ein Porträt des Fürsten Bismarck von
Lenbach, das der Künstler selbst als sein
bestes Werk bezeichnete. Ferner Gobelins des
17. Jahrhunderts, Majoliken, schöne Möbel des
Norddeutschen Barock und einen typischen
Kuba-Teppich des 17. Jahrhunderts.
Leipzig, Mai
C. G. Boerner wird Mitte Mai zwei Auk-
tionen abhalten, von denen die eine in ge-
wohnter Weise alte Graphik enthält, wiederum
Bestände der alten Sammlung König Friedrich
August II. von Sachsen sowie einen zweiten
Teil jener fürstlichen Sammlung, die auf der
November-Auktion 1933 kostbarste alte Meister
verkaufen ließ. Aus ihr kommen diesmal un-
gewöhnlich schöne Qualitäten von Barbari,
Campagnola, Dürer, Lukas van Leyden, Meister
E. S., Rembrandt, Schongauer, ein Herkules
Seghers usw. Als zweite Versteigerung bereitet
C. G. Boerner die Auktion der Handzeich-
nungssammlung Professor Dr. Paul
Arndt (München) vor, die ein reiches
Material deutscher Handzeichnungen des
druck, das in der Bibliotheque Natio-
nale in über 400 Nummern vor dem Be-
schauer ausgebreitet ist. Daumier als Graphi-
ker, der über 4000 Blätter geschaffen hat, ist
im wahrsten und modernsten Sinne ein Journa-
list. Der beißende Witz seiner Texte und die
Prägnanz seiner Zeichnung, die Leichtigkeit
seiner Handschrift, die malerischen Effekte
von Schwarz und Weiß, die er ganz bildhaft
auszunutzen wußte, ließen ihn zum wirklichen
Ahnherrn der ganzen modernen Karikatur wer-
den. Eine Überraschung in dieser Ausstellung
sind die plastischen Skizzen aus Ton, die Dau-
mier angefertigt hat, um danach seine Zeich-
nungen auszuführen. Dr. Fritz N e u g a s s
Berlin, 12.—14. April
Den Charakter der Sammlung Her-
bert M. Gutmann, die, wie hier bereits
berichtet, am 12.—14. April durch P. Graupe
versteigert wird, bestimmen nicht so sehr ein-
zelne gewichtige Hauptwerke als ein durch-
gehend aufs Dekorative gerichteter Geschmack,
der der Wohnkultur und dem Qualitätssinn des
Besitzers entsprach. Das 18. Jahrhundert be-
herrscht den Eindruck. Bei den Gemälden han¬
delt es sich meist um Porträts; voran das
Damenbildnis von Nattier (Abbildung in Nr. 12
der „Weltkunst“), englische Bildnisse von Opie,
Ramsay, Raeburn, dann von Graff, Schröder,
Dietricy, Joh. Fr. Tischbein, Rotari, dekorative
Veduten von Bison, Morgenstern, Malleyn u. a.
Einzeln zu erwähnen ein sehr gutes Bismarck-
bildnis von Lenbach und eine Marienkrönung
von Rubens. Eine Hauptabteilung bester
Qualität bilden die Möbel meist deutscher und
französischer Provenienz: hervorzuheben die
lange Reihe der Kleinmöbel, die Sitzmöbel mit
alten Bezügen, eine Anzahl ausgezeichneter
Kommoden, Schreibtische u. dgl. Es folgen
syrische Gläser, Bronzen und Metallarbeiten,
sehr gutes Silber, Textilien und Porzellan.
Umfangreich die Kollektion der Ostasiatica mit
schönen Keramiken und Porzellanen, sowie die
Sammlung islamischer Kleinkunst, vor allem
Gefäßkeramik. Bei den Textilien ist besonders
auf die Folge von vier großen Wandteppichen
mit Darstellungen aus der Heraklessage hin-
zuweisen, Brüsseler Arbeiten um 1570, viel-
leicht nach Vorlage von Michael Coxie, außer-
dem auf die herrlichen Savonnerie- und Aubus-
son-Teppiche.
ins Ausland, und zu spät erkannten die Ver-
antwortlichen die versäumten Gelegenheiten.
Der Fall Daumier ist hierfür ein ebenso
schlagendes Beispiel, wie die große „Manet-
Ausstellung“ des letzten Jahres. Von den
45 Gemälden und den 146 Aquarellen und
Zeichnungen, die in der Orangerie zusammen-
gebracht wurden, stammen nur 5 Bilder und
7 Aquarelle aus den Beständen des Louvre. Es
ist wahrlich eine traurige Bilanz für die Be-
stände der eigenen Nation, wenn die besten
Werke aus Berlin, München, Breslau, Budapest,
der Schweiz und den Vereinigten Staaten ent-
liehen werden mußten.
Seit 33 Jahren wurde Daumier in Frank-
reich keiner umfassenden Würdigung mehr
teilhaftig. Und jetzt hat man gleich zwei Pa-
rallelausstellungen veranstaltet, um das ganze
Werk dieses vielseitigen Künstlers aufzu-
zeigen.
Selbständigkeit. Die
nossen und Freunde:
bet spiegeln sich in
Diese Unsicherheit im Malerischen wird je-
doch durch die Motive, den geistigen Ge-
halt, die lineare Form und die Offenbarun-
gen der menschlichen Seele reichlich wettge-
macht. Die Bilder, besonders aber die leichte-
ren Aquarelle und flüchtigen Skizzen, offen-
baren die ganze Tiefe und Charakterisierungs-
fähigkeit des Meisters, der die sozialen Pro-
bleme seiner Zeit, den Bürger, den Spießer, den
Politiker mit chronikhafter Treue zu schildern
wußte. Doch alle diese Motive kommen erst
ganz in seinem graphischen Werk zum Aus-
Zn Paris
Honore Daumier
Zu oft schon hat man in Paris erfahren,
wie schwer es ist, alte Unterlassungssünden
wieder gut zu machen. Nur unter den größten
Schwierigkeiten ist es den französischen
Museen heute noch möglich, das allzu vernach-
lässigte Oeuvre der großen Meister des
19. Jahrhunderts zusammenzubringen. Die
besten Werke gingen um die Jahrhundertwende
in Köln
Neudeutsche
Romantiker
Die Galerie Abels in Köln zeigt in
ihrer gegenwärtigen Ausstellung einige Maler
der Neuromantik, die bereits seit Jahren hier
eine besondere Pflegestätte gefunden haben.
Der Düsseldorfer Werner P e i n e r ist mit
zwei lichten und klaren Motiven aus Kronen-
burg und dem malerisch reizvollen Zirkuspferd
(Abb. S. 2) vertreten, H. Böttger,
Schrimpf und Lenk mit Landschaften,
Mangold und Böhm mit liebevoll ins Detail
gehenden Blumenstilleben.
Adrian Ludwig Richter
Die Ludwigsgalerie in München, die
sich schon immer für die Maler des 19. Jahr-
hunderts eingesetzt
hat, ehrt Ludwig
Richter durch eine
Ausstellung, die sie
anläßlich seines 50.
Todestages aus Pri-
vatbesitz zusammen-
gebracht hat. Diese
im tiefsten Sinne des
Wortes zeitgemäße
Veranstaltung wird
um so mehr Auf-
merksamkeiterregen,
als sie in der Haupt-
sache wenig oder nur
in der Reproduktion
bekannte, ja teilweise
auch ganz unbe-
kannte Werke dieses
Künstlers aufweist.
Die Ölbilder stehen
bei Richter an Zahl
hinter den Aquarel-
len und Handzeich-
nungen zurück und
so kann auch diese
Ausstellung ihrer
nicht viele zeigen.
Dafür sind die vor-
handenen wahre Per-
len romantischerMal-
kunst: das früheste
seiner Bilder „Ponte
Salaro“ (1928), ein
großes, bisher kaum
gekanntes Gemälde
von der Rocca di
Mezzo, eine Abend-
landschaft bei Ole-
vano und die Skizze
zu der im Glaspalast verbrannten „Sommer-
lust“ seien genannt. Das Bildnis ist mit einer
Porträtzeichnung des befreundeten Malers
Theodor Rehbenitz vertreten. Daran schließen
sich in bunter Fülle —■ rund 130 Blätter — alle
die köstlichen Zeichnungen und Aquarelle aus
dem Märchen, dem Volks- und Familienleben:
Rübezahl, 7 Schwaben, Melusine, Illustrationen
zu Goethe und Bechstein, die wir hier in Ori-
ginalen bewundern dürfen in dieser ersten süd-
deutschen Ludwig Richter-Ausstellung.
Das Großteil des Ausstellungsgutes stammt
aus der Sammlung F1 i n s c h in Leipzig,
andere aus Auktionen bei Boerner (Prof.
Arndt) und H. Helbing in Frankfurt. F.
Schmoll v. Eisenwerth, Schultz, Sieck,
Staschus, Tillberg, Traub und Wilke.
Daran schloß sich im zweiten Saal eine
Sonderschau „Nymphenburg“ des Malers Fritz
Bayerlein mit 23 Bildern, die diesem Juwel der
Rokokobau- und -gartenkunst entnommen sind.
Malers Harry
Schultz wurde anläßlich des 60. Geburtstags
veranstaltet und zeigte dessen Werk von den
Anfängen bis heute: eine eigenwillige, in
Thema und Technik ihre eigenen Wege gehende
Künstlerpersönlichkeit. Den letzten Saal
füllen meist großformatige Werke des Malers
Ewald Vetter.
19. Jahrhunderts enthält. Wir werden die Be-
stände der beiden Versteigerungen noch aus-
führlich würdigen.
Frankfurt a. M., 17. April
Das Kunsthaus Heinrich Hahn hat
die ursprünglich für den 10. April vorgesehene
Auktion auf 17. April verschoben.
New York, 4.—7. April
Die erste Aprilwoche bringt in New York
zwei bedeutende Auktionsereignisse. Erstens
die Bibliothek William K. B i x b y, die Erst-
ausgaben und Manuskripte enthält, u. a. Bücher
aus dem Besitz von Washington. Gleichzeitig
gelangt die Sammlung Mrs. B. Stern zur
Versteigerung, die u. a. Bilder von Watteau,
Boucher, Greuze, signierte französische Möbel
des 18. Jahrhunderts, Renaissance-Bronzen,
Tapisserien, Meißner und Sevres-Porzellane
schönster Qualität umfaßt. Interessant, daß
unter den Gemälden auch einige deutsche
Werke sich befinden, so eine westfälische Altar-
tafel des 15. Jahrhunderts, ein Porträt von
Barthel Bruyn und ein wundervolles, 1512 da-
tiertes Männerbildnis von Baldung-Grien.
Was kostete
das Neue Rom?
Das neue Rom Mussolinis, dessen Pracht
und Größe des öfteren besprochen worden ist,
ist zum wesentlichen Teil in den Jahren der
schlimmsten Krise entstanden und man hat
zum mindesten vor zwei Jahren die Arbeiten
an der Ewigen Stadt in den Arbeits-
beschaffungsplan eingesetzt, sie somit regel-
recht als Notstandsarbeiten bezeichnet. Es
ist immer wieder, auch an dieser Stelle, be-
tont worden, daß die Städtebauten in Rom,
wenigstens soweit es sich um die Freilegung
der antiken Bauwerke, die Ausgrabungen und
den Durchbruch neuer Straßen handelte, mit
sehr geringen Kosten durchgeführt worden
sind. Ziffern waren freilich nicht bekannt
gegeben worden. Nunmehr hat Mussolini es
an der Zeit gehalten, die Welt und die Römer
wissen zu lassen, was das neue Rom des
Faschismus bisher an Geldern verbraucht hat.
Diese Summen sind unglaublich niedrig. Sie
belaufen sich insgesamt auf nur 112 Millionen
Lire, das sind etwa 25 Millionen Mark. Im
einzelnen verteilen sieh die Summen mit
28 Millionen auf die Via del Mare, die große
Straße, die vom Kapitol an der Rupe Tarpeja
vorbei nach dem Marcelltheater führt und dort
in die Zufahrtstraßen nach Ostia einbiegt, mit
71 Millionen Lire auf die Via deHTmpero, seit
Trajan der letzte Bergdurchstich eines der
römischen Hügel, mit 8 Millionen auf die Iso-
lierung und Freilegung des Kapitol, mit 5 Mil-
lionen auf die Via dei Trionfi, welche vom
Kolosseum bis zum Beginn des Zirkus Maximus
führt und den Palatin in das auferstehende
antike Rom einzubeziehen beginnt. Die Frei-
legung des Marcelltheaters dürfte mit in- die—
Kosten der Via del Mare eingerechnet sein,
Giebelfigur. Neumecklenburg
Ausstellung: Ernst Fritzsche, Berlin
während die Ausgrabung der Augustus-Nerva-
und Cäsarforen in den Etat der Via dell’Im-
pero gehören. Man wird nunmehr mit ähn-
lichen Summen an die Freilegung des Circus
Maximus herangehen. G. R.
3
Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934
in München
Au ktio ns vo rsch a u
Uli. Neumecklenburg
Ausstellung:
Ernst Fritzsche, Berlin
Ludwig Richter, Zeichnung
Ausstellung: Ludwigsgalerie, München
In der Orangerie
hat man seine Bilder
und Zeichnungen ver-
einigt. Das Ensemble
dieser Werke beweist
die allgemeine Über-
schätzung der male-
rischen Qualitäten
dieses Meisters. In der
Gesamtheit bleibt die
Farbe stumpfund unper-
sönlich; sie hat keinen
Eigenwert und dient
lediglich zur Füllung der
ausdrucksvollen Kon-
turen, zur Schaffung
von Hell und Dunkel und
zur Steigerung des
Raumgefühls. Die pla-
stische Form dagegen,
das Volumen der Figu-
ren, ihre Körperhaftig-
keit, ihre menschliche
und seelische Schwere
kommt in dieser Aus-
stellung ganz besonders
zum Ausdruck. In male-
rischer Beziehung be-
weist Daumier keinerlei
Ideen seiner Zeitge-
Corot, Diaz und Cour-
diesen Bildern wider.
Die Kollektivschau des
burger Museum. Als Hauptwerke von be-
sonderer Schönheit dürfen vor allem auch zwei
beschnitzte Holzschilde angesprochen werden,
deren edles dekoratives Gepräge kaum von den
besten in Museumsbesitz befindlichen Stücken
übertroffen wird. Eine Reihe japanischer No-
Masken rundet die sehenswerte Ausstellung ab.
Der Bund zeichnender Künstler Münchens
zeigte im großen Saal des Kunstvereins eine
vollwertige Kollektivschau seiner Mitglieder.
Da es nicht möglich ist, die Leistungen im ein-
zelnen zu besprechen, wie sie es verdienten,
seien nur die Namen der Aussteller genannt:
Bauriedl, Broel, Eggert, Heinsdorff, Hoerschel-
mann, Kaiser, Kalb, Kolb, Kubinij, Lieber-
mann, Mayrhofer-Passau, Müller-Schnutten-
bach, Neumann, Pfeiffer, Roth, Schaupp,
Peter von Cornelius, Liegender weiblicher Akt
Studie zur Daphne im Göttersaal der Münchener Glyptothek
Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz
Ausstellung: Kunstverein, Leipzig
Berlin, April
Das Internationale Kunst - und
Auktions-Haus kündigt für den April
zwei Versteigerungen an. In einer Auktion am
7. und 17. April befinden sich komplette
Zimmer aus ersten Werkstätten, schöne Perser
Teppiche, Aubussons, ein Steinway-Stutzflügel,
Silber, Porzellan, Glas und Einzelmöbel.
Die Versteigerung Ende April, die alten
Sammlerbesitz bringt, dürfte von besonderem
Interesse sein. Wir finden: Ein Jünglings-
porträt von van Dyck, das im Jahre 1909 auf
der Ausstellung des Kaiser Friedrich-Museum-
Vereins in Berlin ausgestellt war, eine pracht-
volle Terrakotta-Plastik von Benedetto da
Majano, ein Porträt des Fürsten Bismarck von
Lenbach, das der Künstler selbst als sein
bestes Werk bezeichnete. Ferner Gobelins des
17. Jahrhunderts, Majoliken, schöne Möbel des
Norddeutschen Barock und einen typischen
Kuba-Teppich des 17. Jahrhunderts.
Leipzig, Mai
C. G. Boerner wird Mitte Mai zwei Auk-
tionen abhalten, von denen die eine in ge-
wohnter Weise alte Graphik enthält, wiederum
Bestände der alten Sammlung König Friedrich
August II. von Sachsen sowie einen zweiten
Teil jener fürstlichen Sammlung, die auf der
November-Auktion 1933 kostbarste alte Meister
verkaufen ließ. Aus ihr kommen diesmal un-
gewöhnlich schöne Qualitäten von Barbari,
Campagnola, Dürer, Lukas van Leyden, Meister
E. S., Rembrandt, Schongauer, ein Herkules
Seghers usw. Als zweite Versteigerung bereitet
C. G. Boerner die Auktion der Handzeich-
nungssammlung Professor Dr. Paul
Arndt (München) vor, die ein reiches
Material deutscher Handzeichnungen des
druck, das in der Bibliotheque Natio-
nale in über 400 Nummern vor dem Be-
schauer ausgebreitet ist. Daumier als Graphi-
ker, der über 4000 Blätter geschaffen hat, ist
im wahrsten und modernsten Sinne ein Journa-
list. Der beißende Witz seiner Texte und die
Prägnanz seiner Zeichnung, die Leichtigkeit
seiner Handschrift, die malerischen Effekte
von Schwarz und Weiß, die er ganz bildhaft
auszunutzen wußte, ließen ihn zum wirklichen
Ahnherrn der ganzen modernen Karikatur wer-
den. Eine Überraschung in dieser Ausstellung
sind die plastischen Skizzen aus Ton, die Dau-
mier angefertigt hat, um danach seine Zeich-
nungen auszuführen. Dr. Fritz N e u g a s s
Berlin, 12.—14. April
Den Charakter der Sammlung Her-
bert M. Gutmann, die, wie hier bereits
berichtet, am 12.—14. April durch P. Graupe
versteigert wird, bestimmen nicht so sehr ein-
zelne gewichtige Hauptwerke als ein durch-
gehend aufs Dekorative gerichteter Geschmack,
der der Wohnkultur und dem Qualitätssinn des
Besitzers entsprach. Das 18. Jahrhundert be-
herrscht den Eindruck. Bei den Gemälden han¬
delt es sich meist um Porträts; voran das
Damenbildnis von Nattier (Abbildung in Nr. 12
der „Weltkunst“), englische Bildnisse von Opie,
Ramsay, Raeburn, dann von Graff, Schröder,
Dietricy, Joh. Fr. Tischbein, Rotari, dekorative
Veduten von Bison, Morgenstern, Malleyn u. a.
Einzeln zu erwähnen ein sehr gutes Bismarck-
bildnis von Lenbach und eine Marienkrönung
von Rubens. Eine Hauptabteilung bester
Qualität bilden die Möbel meist deutscher und
französischer Provenienz: hervorzuheben die
lange Reihe der Kleinmöbel, die Sitzmöbel mit
alten Bezügen, eine Anzahl ausgezeichneter
Kommoden, Schreibtische u. dgl. Es folgen
syrische Gläser, Bronzen und Metallarbeiten,
sehr gutes Silber, Textilien und Porzellan.
Umfangreich die Kollektion der Ostasiatica mit
schönen Keramiken und Porzellanen, sowie die
Sammlung islamischer Kleinkunst, vor allem
Gefäßkeramik. Bei den Textilien ist besonders
auf die Folge von vier großen Wandteppichen
mit Darstellungen aus der Heraklessage hin-
zuweisen, Brüsseler Arbeiten um 1570, viel-
leicht nach Vorlage von Michael Coxie, außer-
dem auf die herrlichen Savonnerie- und Aubus-
son-Teppiche.
ins Ausland, und zu spät erkannten die Ver-
antwortlichen die versäumten Gelegenheiten.
Der Fall Daumier ist hierfür ein ebenso
schlagendes Beispiel, wie die große „Manet-
Ausstellung“ des letzten Jahres. Von den
45 Gemälden und den 146 Aquarellen und
Zeichnungen, die in der Orangerie zusammen-
gebracht wurden, stammen nur 5 Bilder und
7 Aquarelle aus den Beständen des Louvre. Es
ist wahrlich eine traurige Bilanz für die Be-
stände der eigenen Nation, wenn die besten
Werke aus Berlin, München, Breslau, Budapest,
der Schweiz und den Vereinigten Staaten ent-
liehen werden mußten.
Seit 33 Jahren wurde Daumier in Frank-
reich keiner umfassenden Würdigung mehr
teilhaftig. Und jetzt hat man gleich zwei Pa-
rallelausstellungen veranstaltet, um das ganze
Werk dieses vielseitigen Künstlers aufzu-
zeigen.
Selbständigkeit. Die
nossen und Freunde:
bet spiegeln sich in
Diese Unsicherheit im Malerischen wird je-
doch durch die Motive, den geistigen Ge-
halt, die lineare Form und die Offenbarun-
gen der menschlichen Seele reichlich wettge-
macht. Die Bilder, besonders aber die leichte-
ren Aquarelle und flüchtigen Skizzen, offen-
baren die ganze Tiefe und Charakterisierungs-
fähigkeit des Meisters, der die sozialen Pro-
bleme seiner Zeit, den Bürger, den Spießer, den
Politiker mit chronikhafter Treue zu schildern
wußte. Doch alle diese Motive kommen erst
ganz in seinem graphischen Werk zum Aus-
Zn Paris
Honore Daumier
Zu oft schon hat man in Paris erfahren,
wie schwer es ist, alte Unterlassungssünden
wieder gut zu machen. Nur unter den größten
Schwierigkeiten ist es den französischen
Museen heute noch möglich, das allzu vernach-
lässigte Oeuvre der großen Meister des
19. Jahrhunderts zusammenzubringen. Die
besten Werke gingen um die Jahrhundertwende
in Köln
Neudeutsche
Romantiker
Die Galerie Abels in Köln zeigt in
ihrer gegenwärtigen Ausstellung einige Maler
der Neuromantik, die bereits seit Jahren hier
eine besondere Pflegestätte gefunden haben.
Der Düsseldorfer Werner P e i n e r ist mit
zwei lichten und klaren Motiven aus Kronen-
burg und dem malerisch reizvollen Zirkuspferd
(Abb. S. 2) vertreten, H. Böttger,
Schrimpf und Lenk mit Landschaften,
Mangold und Böhm mit liebevoll ins Detail
gehenden Blumenstilleben.
Adrian Ludwig Richter
Die Ludwigsgalerie in München, die
sich schon immer für die Maler des 19. Jahr-
hunderts eingesetzt
hat, ehrt Ludwig
Richter durch eine
Ausstellung, die sie
anläßlich seines 50.
Todestages aus Pri-
vatbesitz zusammen-
gebracht hat. Diese
im tiefsten Sinne des
Wortes zeitgemäße
Veranstaltung wird
um so mehr Auf-
merksamkeiterregen,
als sie in der Haupt-
sache wenig oder nur
in der Reproduktion
bekannte, ja teilweise
auch ganz unbe-
kannte Werke dieses
Künstlers aufweist.
Die Ölbilder stehen
bei Richter an Zahl
hinter den Aquarel-
len und Handzeich-
nungen zurück und
so kann auch diese
Ausstellung ihrer
nicht viele zeigen.
Dafür sind die vor-
handenen wahre Per-
len romantischerMal-
kunst: das früheste
seiner Bilder „Ponte
Salaro“ (1928), ein
großes, bisher kaum
gekanntes Gemälde
von der Rocca di
Mezzo, eine Abend-
landschaft bei Ole-
vano und die Skizze
zu der im Glaspalast verbrannten „Sommer-
lust“ seien genannt. Das Bildnis ist mit einer
Porträtzeichnung des befreundeten Malers
Theodor Rehbenitz vertreten. Daran schließen
sich in bunter Fülle —■ rund 130 Blätter — alle
die köstlichen Zeichnungen und Aquarelle aus
dem Märchen, dem Volks- und Familienleben:
Rübezahl, 7 Schwaben, Melusine, Illustrationen
zu Goethe und Bechstein, die wir hier in Ori-
ginalen bewundern dürfen in dieser ersten süd-
deutschen Ludwig Richter-Ausstellung.
Das Großteil des Ausstellungsgutes stammt
aus der Sammlung F1 i n s c h in Leipzig,
andere aus Auktionen bei Boerner (Prof.
Arndt) und H. Helbing in Frankfurt. F.
Schmoll v. Eisenwerth, Schultz, Sieck,
Staschus, Tillberg, Traub und Wilke.
Daran schloß sich im zweiten Saal eine
Sonderschau „Nymphenburg“ des Malers Fritz
Bayerlein mit 23 Bildern, die diesem Juwel der
Rokokobau- und -gartenkunst entnommen sind.
Malers Harry
Schultz wurde anläßlich des 60. Geburtstags
veranstaltet und zeigte dessen Werk von den
Anfängen bis heute: eine eigenwillige, in
Thema und Technik ihre eigenen Wege gehende
Künstlerpersönlichkeit. Den letzten Saal
füllen meist großformatige Werke des Malers
Ewald Vetter.
19. Jahrhunderts enthält. Wir werden die Be-
stände der beiden Versteigerungen noch aus-
führlich würdigen.
Frankfurt a. M., 17. April
Das Kunsthaus Heinrich Hahn hat
die ursprünglich für den 10. April vorgesehene
Auktion auf 17. April verschoben.
New York, 4.—7. April
Die erste Aprilwoche bringt in New York
zwei bedeutende Auktionsereignisse. Erstens
die Bibliothek William K. B i x b y, die Erst-
ausgaben und Manuskripte enthält, u. a. Bücher
aus dem Besitz von Washington. Gleichzeitig
gelangt die Sammlung Mrs. B. Stern zur
Versteigerung, die u. a. Bilder von Watteau,
Boucher, Greuze, signierte französische Möbel
des 18. Jahrhunderts, Renaissance-Bronzen,
Tapisserien, Meißner und Sevres-Porzellane
schönster Qualität umfaßt. Interessant, daß
unter den Gemälden auch einige deutsche
Werke sich befinden, so eine westfälische Altar-
tafel des 15. Jahrhunderts, ein Porträt von
Barthel Bruyn und ein wundervolles, 1512 da-
tiertes Männerbildnis von Baldung-Grien.
Was kostete
das Neue Rom?
Das neue Rom Mussolinis, dessen Pracht
und Größe des öfteren besprochen worden ist,
ist zum wesentlichen Teil in den Jahren der
schlimmsten Krise entstanden und man hat
zum mindesten vor zwei Jahren die Arbeiten
an der Ewigen Stadt in den Arbeits-
beschaffungsplan eingesetzt, sie somit regel-
recht als Notstandsarbeiten bezeichnet. Es
ist immer wieder, auch an dieser Stelle, be-
tont worden, daß die Städtebauten in Rom,
wenigstens soweit es sich um die Freilegung
der antiken Bauwerke, die Ausgrabungen und
den Durchbruch neuer Straßen handelte, mit
sehr geringen Kosten durchgeführt worden
sind. Ziffern waren freilich nicht bekannt
gegeben worden. Nunmehr hat Mussolini es
an der Zeit gehalten, die Welt und die Römer
wissen zu lassen, was das neue Rom des
Faschismus bisher an Geldern verbraucht hat.
Diese Summen sind unglaublich niedrig. Sie
belaufen sich insgesamt auf nur 112 Millionen
Lire, das sind etwa 25 Millionen Mark. Im
einzelnen verteilen sieh die Summen mit
28 Millionen auf die Via del Mare, die große
Straße, die vom Kapitol an der Rupe Tarpeja
vorbei nach dem Marcelltheater führt und dort
in die Zufahrtstraßen nach Ostia einbiegt, mit
71 Millionen Lire auf die Via deHTmpero, seit
Trajan der letzte Bergdurchstich eines der
römischen Hügel, mit 8 Millionen auf die Iso-
lierung und Freilegung des Kapitol, mit 5 Mil-
lionen auf die Via dei Trionfi, welche vom
Kolosseum bis zum Beginn des Zirkus Maximus
führt und den Palatin in das auferstehende
antike Rom einzubeziehen beginnt. Die Frei-
legung des Marcelltheaters dürfte mit in- die—
Kosten der Via del Mare eingerechnet sein,
Giebelfigur. Neumecklenburg
Ausstellung: Ernst Fritzsche, Berlin
während die Ausgrabung der Augustus-Nerva-
und Cäsarforen in den Etat der Via dell’Im-
pero gehören. Man wird nunmehr mit ähn-
lichen Summen an die Freilegung des Circus
Maximus herangehen. G. R.