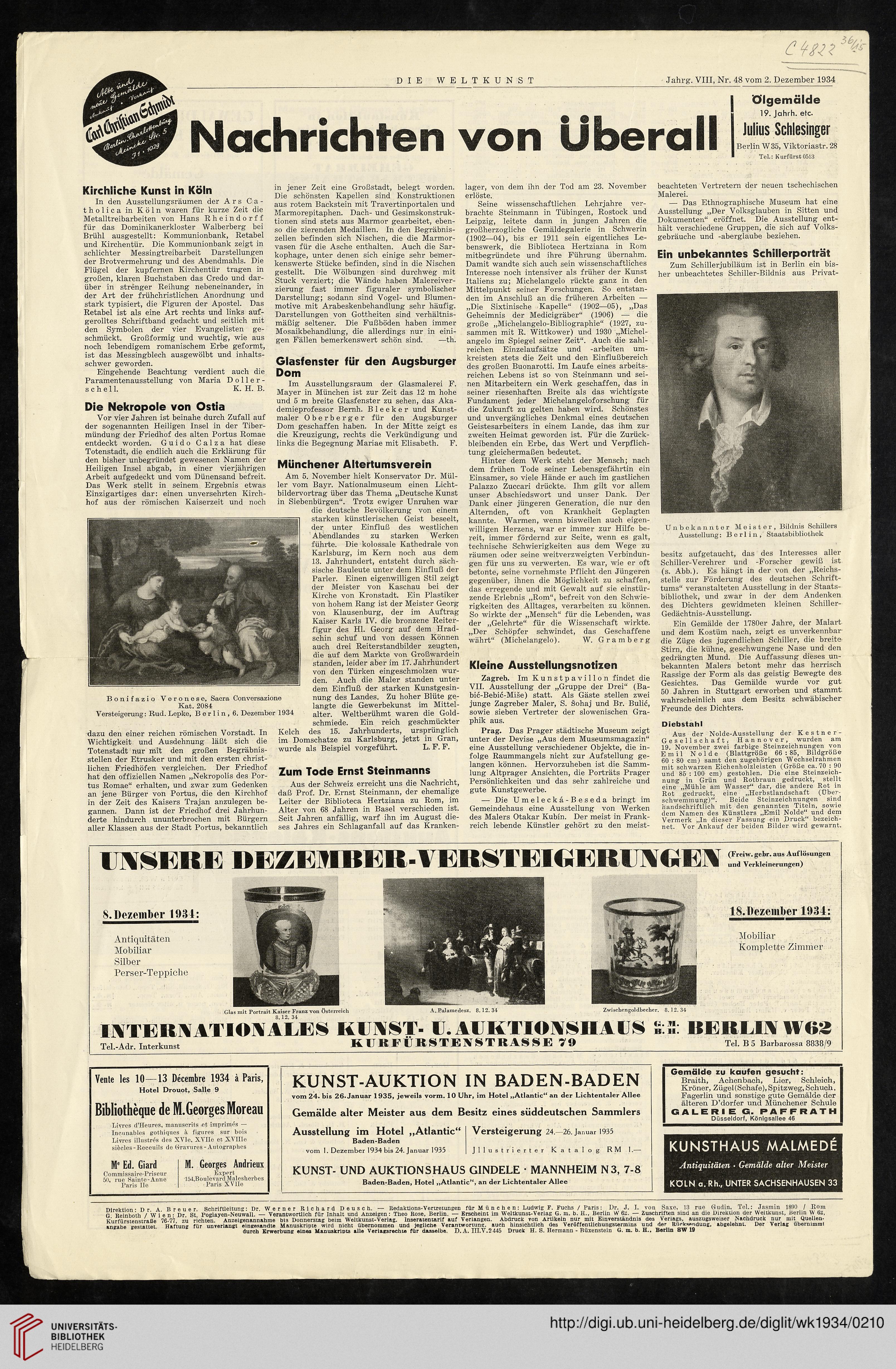DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 48 vom 2. Dezember 1934
Nachrichten von überall
Ölgemälde
19. Jahrh. etc.
Julius Schlesinger
Berlin W35, Viktoriastr. 28
Tel.: Kurfürst 0513
Kirchliche Kunst in Köln
In den Ausstellungsräumen der Ars C a -
tholica in Köln waren für kurze Zeit die
Metalltreibarbeiten von Hans Rheindorff
für das Dominikanerkloster Walberberg bei
Brühl ausgestellt: Kommunionbank, Retabel
und Kirchentür. Die Kommunionbank zeigt in
schlichter Messingtreibarbeit Darstellungen
der Brotvermehrung und des Abendmahls. Die
Flügel der kupfernen Kirchentür tragen in
großen, klaren Buchstaben das Credo und dar-
über- in strenger Reihung nebeneinander, in
der Art der frühchristlichen Anordnung und
stark typisiert, die Figuren der Apostel. Das
Retabel ist als eine Art rechts und links auf-
gerolltes Schriftband gedacht und seitlich mit
den Symbolen der vier Evangelisten ge-
schmückt. Großformig und wuchtig, wie aus
noch lebendigem romanischem Erbe geformt,
ist das Messingblech ausgewölbt und inhalts-
schwer geworden.
Eingehende Beachtung verdient auch die
Paramentenausstellung von Maria Doller-
schell. K. H. B.
Die Nekropole von Ostia
Vor vier Jahren ist beinahe durch Zufall auf
der sogenannten Heiligen Insel in der Tiber-
mündung der Friedhof des alten Portus Romae
entdeckt worden. Guido Calza hat diese
Totenstadt, die endlich auch die Erklärung für
den bisher unbegründet gewesenen Namen der
Heiligen Insel abgab, in einer vierjährigen
Arbeit aufgedeckt und vom Dünensand befreit.
Das Werk stellt in seinem Ergebnis etwas
Einzigartiges dar: einen unversehrten Kirch-
hof aus der römischen Kaiserzeit und noch
dazu den einer reichen römischen Vorstadt. In
Wichtigkeit und Ausdehnung läßt sich die
Totenstadt nur mit den großen Begräbnis-
stellen der Etrusker und mit den ersten christ-
lichen Friedhöfen vergleichen. Der Friedhof
hat den offiziellen Namen „Nekropolis des Por-
tus Romae“ erhalten, und zwar zum Gedenken
an jene Bürger von Portus, die den Kirchhof
in der Zeit des Kaisers Trajan anzulegen be-
gannen. Dann ist der Friedhof drei Jahrhun-
derte hindurch ununterbrochen mit Bürgern
aller Klassen aus der Stadt Portus, bekanntlich
in jener Zeit eine Großstadt, belegt worden.
Die schönsten Kapellen sind Konstruktionen
aus rotem Backstein mit Travertinportalen und
Marmorepitaphen. Dach- und Gesimskonstruk-
tionen sind stets aus Marmor gearbeitet, eben-
so die zierenden Medaillen. In den Begräbnis-
zellen befinden sich Nischen, die die Marmor-
vasen für die Asche enthalten. Auch die Sar-
kophage, unter denen sich einige sehr bemer-
kenswerte Stücke befinden, sind in die Nischen
gestellt. Die Wölbungen sind durchweg mit
Stuck verziert; die Wände haben Malereiver-
zierung fast immer figuraler symbolischer
Darstellung; sodann sind Vogel- und Blumen-
motive mit Arabeskenbehandlung sehr häufig.
Darstellungen von Gottheiten sind verhältnis-
mäßig seltener. Die Fußböden haben immer
Mosaikbehandlung, die allerdings nur in eini-
gen Fällen bemerkenswert schön sind. —th.
Glasfenster für den Augsburger
Dom
Im Ausstellungsraum der Glasmalerei F.
Mayer in München ist zur Zeit das 12 m hohe
und 5 m breite Glasfenster zu sehen, das Aka-
demieprofessor Bernh. B 1 e e k e r und Kunst-
maler Oberberger für den Augsburger
Dom geschaffen haben. In der Mitte zeigt es
die Kreuzigung, rechts die Verkündigung und
links die Begegnung Mariae mit Elisabeth. F.
Münchener Altertumsverein
Am 5. November hielt Konservator Dr. Mül-
ler vom Bayr. Nationalmuseum einen Licht-
bildervortrag über das Thema „Deutsche Kunst
in Siebenbürgen“. Trotz ewiger Unruhen war
die deutsche Bevölkerung von einem
starken künstlerischen Geist beseelt,
der unter Einfluß des westlichen
Abendlandes zu starken Werken
führte. Die kolossale Kathedrale von
Karlsburg, im Kern noch aus dem
13. Jahrhundert, entsteht durch säch-
sische Bauleute unter dem Einfluß der
Parier. Einen eigenwilligen Stil zeigt
der Meister von Kaschau bei der
Kirche von Kronstadt. Ein Plastiker
von hohem Rang ist der Meister Georg
von Klausenburg, der im Auftrag
Kaiser Karls IV. die bronzene Reiter-
figur des Hl. Georg auf dem Hrad-
schin schuf und von dessen Können
auch drei Reiterstandbilder zeugten,
die auf dem Markte von Großwardein
standen, leider aber im 17. Jahrhundert
von den Türken eingeschmolzen wur-
den. Auch die Maler standen unter
dem Einfluß der starken Kunstgesin-
nung des Landes. Zu hoher Blüte ge-
langte die Gewerbekunst im Mittel-
alter. Weltberühmt waren die Gold-
schmiede. Ein reich geschmückter
Kelch des 15. Jahrhunderts, ursprünglich
im Domschatze zu Karlsburg, jetzt in Gran,
wurde als Beispiel vorgeführt. L. F. F.
Zum Tode Ernst Steinmanns
Aus der Schweiz erreicht uns die Nachricht,
daß Prof. Dr. Ernst Steinmann, der ehemalige
Leiter der Biblioteca Hertziana zu Rom, im
Alter von 68 Jahren in Basel verschieden ist.
Seit Jahren anfällig, warf ihn im August die-
ses Jahres ein Schlaganfall auf das Kranken-
lager, von dem ihn der Tod am 23. November
erlöste.
Seine wissenschaftlichen Lehrjahre ver-
brachte Steinmann in Tübingen, Rostock und
Leipzig, leitete dann in jungen Jahren die
großherzogliche Gemäldegalerie in Schwerin
(1902—04), bis er 1911 sein eigentliches Le-
benswerk, die Biblioteca Hertziana in Rom
mitbegründete und ihre Führung übernahm.
Damit wandte sich auch sein wissenschaftliches
Interesse noch intensiver als früher der Kunst
Italiens zu; Michelangelo rückte ganz in den
Mittelpunkt seiner Forschungen. So entstan-
den im Anschluß an die früheren Arbeiten •—
„Die Sixtinische Kapelle“ (1902—05), „Das
Geheimnis der Medicigräber“ (1906) — die
große „Michelangelo-Bibliographie“ (1927, zu-
sammen mit R. Wittkower) und 1930 „Michel-
angelo im Spiegel seiner Zeit“. Auch die zahl-
reichen Einzelaufsätze und -arbeiten um-
kreisten stets die Zeit und den Einflußbereich
des großen Buonarotti. Im Laufe eines arbeits-
reichen Lebens ist so von Steinmann und sei-
nen Mitarbeitern ein Werk geschaffen, das in
seiner riesenhaften Breite als das wichtigste
Fundament jeder Michelangeloforschung für
die Zukunft zu gelten haben wird. Schönstes
und unvergängliches Denkmal eines deutschen
Geistesarbeiters in einem Lande, das ihm zur
zweiten Heimat geworden ist. Für die Zurück-
bleibenden ein Erbe, das Wert und Verpflich-
tung gleichermaßen bedeutet.
Hinter dem Werk steht der Mensch; nach
dem frühen Tode seiner Lebensgefährtin ein
Einsamer, so viele Hände er auch im gastlichen
Palazzo Zuccari drückte. Ihm gilt vor allem
unser Abschiedswort und unser Dank. Der
Dank einer jüngeren Generation, die nur den
Alternden, oft von Krankheit Geplagten
kannte. Warmen, wenn bisweilen auch eigen-
willigen Herzens, war er immer zur Hilfe be-
reit, immer fördernd zur Seite, wenn es galt,
technische Schwierigkeiten aus dem Wege zu
räumen oder seine weitverzweigten Verbindun-
gen für uns zu verwerten. Es war, wie er oft
betonte, seine vornehmste Pflicht den Jüngeren
gegenüber, ihnen die Möglichkeit zu schaffen,
das erregende und mit Gewalt auf sie einstür-
zende Erlebnis „Rom“, befreit von den Schwie-
rigkeiten des Alltages, verarbeiten zu können.
So wirkte der „Mensch“ für die Lebenden, was
der „Gelehrte“ für die Wissenschaft wirkte.
„Der Schöpfer schwindet, das Geschaffene
währt“ (Michelangelo). W. Gramberg
Kleine Ausstellungsnotizen
Zagreb. Im Kunstpavillon findet die
VII. Ausstellung der „Gruppe der Drei“ (Ba-
bic-Bebic-Mise) statt. Als Gäste stellen zwei
junge Zagreber Maler, S. Sohaj und Br. Bulic,
sowie sieben Vertreter der slowenischen Gra-
phik aus.
Prag. Das Prager städtische Museum zeigt
unter der Devise „Aus dem Museumsmagazin“
eine Ausstellung verschiedener Objekte, die in-
folge Raummangels nicht zur Aufstellung ge-
langen können. Hervorzuheben ist die Samm-
lung Altprager Ansichten, die Porträts Prager
Persönlichkeiten und das sehr zahlreiche und
gute Kunstgewerbe.
— Die Umeleckä-Beseda bringt im
Gemeindehaus eine Ausstellung von Werken
des Malers Otakar Kubin. Der meist in Frank-
reich lebende Künstler gehört zu den meist-
Bonifazio Veronese, Sacra Conversazione
Kat. 2084
Versteigerung: Bud. Lepke, Berlin, 6. Dezember 1934
beachteten Vertretern der neuen tschechischen
Malerei.
— Das Ethnographische Museum hat eine
Ausstellung „Der Volksglauben in Sitten und
Dokumenten“ eröffnet. Die Ausstellung ent-
hält verschiedene Gruppen, die sich auf Volks-
gebräuche und -aberglaube beziehen.
Ein unbekanntes Schillerporträt
Zum Schillerjubiläum ist in Berlin ein bis-
her unbeachtetes Schiller-Bildnis aus Privat-
Un bekannter Meister, Bildnis Schillers
Ausstellung: Berlin, Staatsbibliothek
besitz aufgetaucht, das des Interesses aller
Schiller-Verehrer und -Forscher gewiß ist
(s. Abb.). Es hängt in der von der „Reichs-
stelle zur Förderung des deutschen Schrift-
tums“ veranstalteten Ausstellung in der Staats-
bibliothek, und zwar in der dem Andenken
des Dichters gewidmeten kleinen Schiller-
Gedächtnis-Ausstellung.
Ein Gemälde der 1780er Jahre, der Malart
und dem Kostüm nach, zeigt es unverkennbar-
die Züge des jugendlichen Schiller, die breite.-
Stirn, die kühne, geschwungene Nase und den
gedrängten Mund. Die Auffassung dieses un-
bekannten Malers betont mehr das herrisch
Rassige der Form als das geistig Bewegte des
Gesichtes. Das Gemälde wurde vor gut
50 Jahren in Stuttgart erworben und stammt
wahrscheinlich aus dem Besitz schwäbischer
Freunde des Dichters.
Diebstahl
Aus der Nolde-Ausstellung der Kestner-
Gesellschaft, Hannover, wurden am
19. November zwei farbige Steinzeichnungen von
Emil Nolde (Blattgröße 66 : 85, Bildgröße
60 : 80 cm) samt den zugehörigen Wechselrahmen
mit schwarzen Eichenholzleisten (Größe ca. 70 90
und 85 : 100 cm) gestohlen. Die eine Steinzeich-
nung in Grün und Rotbraun gedruckt, stellt
eine „Mühle am Wasser“ dar, die andere Rot in
Rot gedruckt, eine „Herbstlandschaft (Über-
schwemmung)“. Beide Steinzeichnungen sind
handschriftlich mit den genannten Titeln, sowie
dem Namen des Künstlers „Emil Nolde“ und dem
Vermerk „In dieser Fassung ein Druck“ bezeich-
net. Vor Ankauf der beiden Bilder wird gewarnt.
IXSERE DEZEMBER-VERSTEIGERI AG E^\
8. Dezember 1934:
Antiquitäten
Mobiliar
Silber
Perser-Teppiche
Glas mit Portrait Kaiser Franz von Österreich
8.12. 34
A. Palamedesz. 8.12. 34
Zwischengoldbecher. 8.12.34
18. Dezember 1934:
Mobiliar
komplette Zimmer
INTERNATIONALES KUNST- U. AUKTIONSIIAUS 2.3: III Kl.lXHIi»
Tel.-Adr. Interkunst K. U R F Ü R S T E A S T R AS SE *70 Tel. B 5 Barbarossa 8838/9
Direktion: D r. A. Breuer. Schriftleitung: Dr. Werner Richard Deusch. — Redaktions-Vertretungen für M ü n c h e n: Ludwig F. Fuchs / Paris: Dr. J. I. von Saxe, 13 rue Gudin, Tel.: Jasmin 1890 / Rom
G. Reinboth / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62,
Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrecht« für dasselbe. D.A. III.V.2445 Druck H. S. Hermann - Büxenstein G. m. b. H., Berlin SW 19